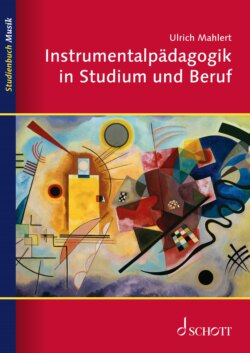Читать книгу Instrumentalpädagogik in Studium und Beruf - Ulrich Mahlert - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fremdbestimmtheit und Autonomie
ОглавлениеIch habe lange und frei studieren können. Meine Klavierausbildung brachte ich zügig zu Ende, weil ich in Musikwissenschaft promovieren und auch Germanistik und Philosophie studieren wollte. Verlängerungen des Studiums im Promotionsstudiengang waren kein Problem. Heute sind Studiengänge an Musikhochschulen und Universitäten viel strenger organisiert. Die Studienzeiten sind stark limitiert und Studierenden wird weitgehend vorgeschrieben, was sie zu lernen haben. Die Reglements zu meiner Studienzeit in den in 1970er Jahren waren – zumindest in den Studiengängen, die nicht zu Staatsexamina führten – vergleichsweise lax. Es war leicht, die erforderlichen Veranstaltungsbelege zu bekommen. Ich studierte, was mich interessierte, und machte Gebrauch von dem, was sich mir bot. (Freilich denke ich heute, dass ich mich noch für vieles mehr hätte interessieren und engagieren sollen.)
Die Freiheit hatte allerdings auch erhebliche Schwächen. Im Musikwissenschaftsstudium etwa wurden fachliche Grundkompetenzen nur sehr rudimentär vermittelt. Dazu zählen Tonsatz, Gehörbildung, Kontrapunkt, Analyse, wissenschaftliches »Handwerkszeug« wie Recherchieren, Bibliografieren, Kenntnisse von Methoden des Forschens etc. Ein für verschiedene Forschungsprojekte befähigendes propädeutisches Studium gab es nicht. Ich hatte das Glück, einige musiktheoretische Grundlagen in meinem pädagogischen und künstlerischen Studium an der Musikhochschule erworben zu haben, bevor ich intensiv Musikwissenschaft an der Universität studierte. Für manche Studierende ohne musikpraktische Ausbildung waren die dortige Freiheit des Studiums und das Fehlen eines Curriculums, das Fähigkeiten systematisch vermittelte, zum Teil verhängnisvoll. Jahrelang irrlichterten sie mit einem frühzeitig gewählten Dissertationsthema herum, dem sie konzeptionell und methodisch nicht gewachsen waren. Im Musikwissenschaftsstudium, wie ich es kennenlernte, wurde vernachlässigt, dass mündiges, selbstbestimmtes Studieren nicht voraussetzungslos praktiziert werden kann. Curriculare Vorgaben mögen fremdbestimmend erscheinen, liefern aber ein »Rüstzeug«, mit dem dann autonom gewählte und gestaltete Lernwege möglich sind.
Ein wichtiges Erlebnis, das für meine Auffassung von wünschenswerter Autonomie modellhaft und nachhaltig wirksam wurde, war ein musikpädagogisches Seminar von Lars Ulrich Abraham, der 1969 an der Freiburger Musikhochschule die Nachfolge von Erich Doflein als Professor für Musikpädagogik angetreten hatte. (Die folgenden Ausführungen nach Mahlert 2011, S. 50 f.) Das Seminar war thematisch nicht gebunden, der Titel entsprechend offen formuliert. Mehrere Sitzungen lang sprach man über dies und das. Abraham war freundlich und zugewandt, ging gelegentlich dem einen oder anderen Gedanken ein wenig nach, warf hier und da ein anregendes Aperçu ein; im Wesentlichen aber hielt er sich zurück. Er dozierte nicht, gab nichts vor. Nach einigen Sitzungen wurde es einigen Studierenden unbehaglich. Sie fragten sich, was die Veranstaltung wohl »bringen« solle und stellten diese Frage im Seminar. Abraham griff sie interessiert auf: »Ja, was wollen Sie denn lernen? Das müssen Sie entscheiden. Es ist Ihr Seminar.« Die Studierenden waren überrascht und verblüfft. So etwas hatten sie bisher von keinem Hochschullehrer gehört. Abrahams Verhalten wirkte erleuchtend. Die Teilnehmer begriffen: Unser Studium ist dazu da, unseren Lernbedürfnissen gerecht zu werden – und nicht dazu, uns zu Rezipienten von vorgegebenen Inhalten zu degradieren. Ab da verlief das Seminar anders: Die Teilnehmer begannen, ihre Interessen einzubringen. Es geschah ungeübt, ungeordnet und im Ganzen nur teilweise ersprießlich. Aber es war ein erster Gehversuch auf dem Neuland der Selbstbestimmtheit.
Abraham ließ übrigens die Studierenden auch die Themen, über die eine musikpädagogische Prüfungsklausur zu schreiben war, selbst bestimmen. Jeder konnte also ein von ihm gewähltes Thema bearbeiten. Manche konservativen Lehrer nahmen daran Anstoß; das war für sie ein libertärer Verfall von akademischen Leistungsansprüchen. Damit dachten sie allerdings zu kurz. Mehr noch als das Schreiben der Klausur war die Wahl des Themas für die meisten Studierenden eine schwierige Aufgabe. Sie merkten, dass ihnen im Studium ihre eigenen Interessen weitgehend verschattet geblieben waren. Die Findung und Formulierung eines persönlich bedeutsamen Themas führten zu einem wertvollen Lernprozess.
Auch Eggebrecht ermutigte seine Studierenden, ihren eigenen Fragen nachzugehen, sie ernst zu nehmen und sich nicht vorschnell von außen inhaltliche und methodische Vorgaben machen zu lassen. Bisweilen nahm er Doktoranden in der Anfangsphase ihrer Beschäftigung mit einem Thema im Doktorandencolloquium in Schutz vor weiter fortgeschrittenen Teilnehmern, die mit dem Gestus der Überlegenheit die noch defizitären Vorlagen der Jüngeren kritisierten. »Lass die mal, die hat da was, das sie umtreibt, mach ihr das nicht einfach kaputt.« In dieser Art schützte und stärkte Eggebrecht Studierende, die Mut zu eigenen Fragen und Interessen entwickelten.
Wie haben solche Erfahrungen in meine eigene Hochschularbeit hineingewirkt? Von ihnen beeinflusst scheinen mir zwei persönliche Grundanliegen:
•Studierende sollen Subjekt und nicht Objekt ihres Studiums sein. Lehrende sind dazu da, Studierende zur Entfaltung ihrer individuellen Potenziale zu ermutigen, sie anzuregen, ihre Interessen und Möglichkeiten zu erkunden und sie auf den oft verschlungenen Wegen ihres Lernens zu begleiten. Bürokratische Hemmnisse sind zu ignorieren oder mit Fantasie zu umgehen. Gerade in Zeiten zunehmender Bevormundung durch Reglements staatlicher Bildungsadministration sollen Lehrende und besonders Leiter von Studiengängen sich in erster Linie als Anwälte von Studierenden und nicht als solche von vorgegebenen »Ordnungen« fühlen. »Ermöglichen statt verhindern« war eine meiner Leitdevisen. Dieser Selbstappell weckt Mut und Ideen in einem flexiblen Umgang mit »Sachzwängen«, eröffnet Grauzonen und ermöglicht, Studierenden individuell gerecht zu werden.
•Lehrveranstaltungen sollen Studierenden fachliche Grundlagen vermitteln und sie zu explorativer Tätigkeit anregen. Lehre und Forschung gehören auch in Lehrveranstaltungen zusammen: Jede noch so gekonnte Darstellung bleibt unzureichend, sofern sie nicht Neugier erzeugt und Eigentätigkeit der Studierenden bewirkt. Neben Seminaren zu bestimmten Schwerpunktthemen habe ich viele Jahre im Jahresturnus zweisemestrige Überblicksveranstaltungen über musikpädagogische Grundlagenthemen angeboten. In Seminaren fanden »Tiefbohrungen« statt, in Überblicksveranstaltungen eher »Ausleuchtungen und Vermessungen weiter Landschaften«.
Vorgaben von Inhalten können Fremdbestimmungen sein – und zwar dann, wenn keine Vermittlung zwischen ihnen und dem Horizont der Lernenden stattfindet. Es geht also darum, möglichst in jeder Sitzung bei den Studierenden aus dem noch Fremden etwas Reizvolles, Verheißungsvolles entstehen zu lassen und dafür zu sorgen, dass durch Fesselung der Aufmerksamkeit Nähe und Vertrauen zu dem zunächst noch Fremden entsteht, woraus sich dann der Wunsch nach Aneignung ergeben mag. Erstrebenswert scheint mir eine Balance von Vorgabe (»zeigen, was es gibt«) und Anregung zu eigenem Forschen (»dem nachgehen, was ich wissen will«). (Näheres dazu in Kapitel 9, S. 135f.)