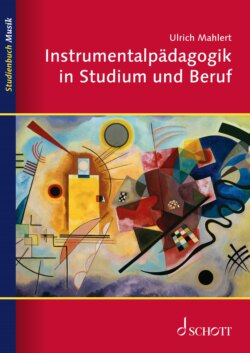Читать книгу Instrumentalpädagogik in Studium und Beruf - Ulrich Mahlert - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.Selbstwahrnehmungen und persönliche Lernwege
ОглавлениеDer Versuch, ein Fachgebiet zu überblicken, in dem man viele Jahre tätig war, ist unvermeidlich von persönlichen Erfahrungen geprägt. Zunächst stammen sie aus der beruflichen Arbeit und dem Nachdenken über das eigene Tun. Sie reichen aber noch weiter zurück, nämlich in die frühere Lerngeschichte. Sozialisation und Personalisation in Kindheit und Jugend – wie auch immer weiterentwickelt, bejaht, kritisch betrachtet oder gar bekämpft – bilden die Grundlage späterer Aktivitäten und wirken in sie hinein. Man gelangt kaum heraus aus dem Bedingungsgefüge gemachter Erfahrungen.
Der Einfluss persönlicher Lernwege auf die Art, das eigene Arbeitsgebiet zu betrachten, zeigt sich auch an der Position des Betrachters. Sie erfolgt von einem bestimmten Punkt der eigenen Lebensgeschichte aus. Selbst der mögliche Versuch, verschiedene, weniger subjektive Positionen zu beziehen, wird bestimmt von der persönlichen Begrenztheit: Im Wunsch, sie auszuweiten, ist deren Wahrnehmung wirksam.
Ich spüre eine Hemmung, in der Ich-Form und dann auch noch von mir selbst zu schreiben. Dabei habe ich es persönlich gern, wenn Autoren im Blick auf eine gewählte Thematik auch sich selbst ins Spiel bringen und sich als Darstellende reflektieren. Es interessiert mich, welche Beziehungen sie zu ihren Gegenständen haben und welche Geschichte die Autoren zu ihnen geführt hat. Dadurch verstehe ich das Dargestellte besser und tiefer. Es wird mir deutlich, wie die Ausführungen an die Person des Schreibenden gebunden sind. Das regt an, auch aus alternativen Perspektiven auf die Thematik zu blicken.
Die Scheu, in Veröffentlichungen über ein Fachgebiet »ich« zu sagen, hat mit den Normen wissenschaftlichen Schreibens zu tun. Auch ich habe diese Normen im Studium gelernt und bis heute weitgehend praktiziert. Ihnen zufolge sind persönliche »Ansichten« möglichst zu vermeiden. Denn zur Wissenschaftlichkeit gehört eine objektive Betrachtungsweise, die sich von den Bedingtheiten, Zufälligkeiten und Beschränktheiten persönlicher Erfahrungen frei macht. Tatsächlich aber sind Objektivität und Subjektivität unlöslich miteinander verschränkt. Objektivität ist nicht entsubjektivierbar. In jeder Bemühung um Objektivität steckt ein subjektiver Impuls, und umgekehrt lässt sich die Einbeziehung subjektiver Erfahrungen in die Reflexion durchaus mit einem Streben nach Objektivität verbinden.
Die in diesem Kapitel ausgeführten Überlegungen zu meinen fachlich relevanten Eigenschaften und den ihnen zugrunde liegenden Erfahrungen können kaum im engeren Sinn als wissenschaftlich gelten. Trotzdem erscheinen sie mir unverzichtbar, um das Anliegen dieses Buchs – eine persönliche Bestandsaufnahme des eigenen Fachs und seines Umkreises – zu verwirklichen. Der beabsichtigte Versuch macht es erforderlich, mich nicht nur fachlich zu positionieren, sondern zumindest ein Stück weit meinen persönlichen Bildungsprozess zu klären. Denn er prägt meine Wahrnehmung meines eigenen Fachs und meiner Position in ihm. Vielleicht werden meine Einblicke in die eigene Lerngeschichte immerhin einem nicht unwesentlichen Kriterium von Wissenschaftlichkeit gerecht: dem der Nachvollziehbarkeit. Darum jedenfalls bemühe ich mich. Meine Selbstbesinnungen sollen nachvollziehbar sein – als Versuch, eigene frühe und spätere Lernerfahrungen in ihrer nachhaltigen Wirkung auf die berufliche Arbeit erkennbar zu machen.
Klar ist, dass meine Bemühung um Selbstklärung nicht vollständig gelingen kann. Subjektivität lässt sich nur begrenzt objektivieren. Zum einen ist die eigene Selbstbeobachtung durch viele blinde Flecken eingeschränkt, zum anderen hat jedes Ich und so auch das eines sorgfältig Reflektierenden keine feste Identität; seine Kontur ist nicht scharf gezogen, sondern schemenhaft und frei flottierend. »Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.« (Bloch 1963, S. 11) Die an sich selbst wahrgenommenen Eigenschaften sind nicht starr und normiert, sondern Qualitäten, die sich im alltäglichen Handeln immer wieder in diversen Mischungen und Dominanzen verbinden. Und die Lernerfahrungen, die ihr Entstehen und ihre Regsamkeit mutmaßlich verursacht, mitbewirkt oder verstärkt haben, sind autoreflexive Wahrnehmungen, aber keine in ihrem Wirkungspotenzial sicher verifizierbare Geschehnisse.
In die Bemühung um Selbstklärung mischt sich Scheu vor Selbstbespiegelung und Selbstinszenierung. Anderen Menschen vorgeführte Autoreflexionen bewegen sich zwischen der Skylla der Eitelkeit und der Charybdis des bescheidenen Understatements. Besonders Deutungen, die nach Geschlossenheit und Rundung streben, erscheinen fragwürdig. Aus dieser Gefahr gibt es keinen sicheren Ausweg. Aber vielleicht kann sie durch das Bewussthalten der beiden virulenten Tendenzen etwas gemindert werden.
Das Prinzip, das ich für meine berufsbezogene Selbstreflexion wähle, soll transparent sein. Ich versuche nicht, mein Leben und meine persönliche Entwicklung als Zusammenhang darzustellen. Das wäre Sache einer Autobiografie. Vielmehr konzentriere ich mich auf einige Motive und Eigenschaftsmuster, die ich häufig in meiner beruflichen Arbeit an mir wahrgenommen habe, und versuche, deren Hintergründen und Motiven in früheren Lebensphasen nachzuspüren. Je älter ich werde, desto größer wird die Bedeutung bestimmter früher Lernerfahrungen – vielleicht auch deshalb, weil ich immer wieder über sie nachgedacht habe und sie so zu Modellen pädagogischen Lernens wurden.
Manchmal wirken einzelne, mitunter sogar kurze, blitzartige Erfahrungen lebenslang weiter, darunter positive wie negative. Es entstehen nicht nur Tugenden und Ideale, sondern zum Teil auch Hypotheken. Einige entwickeln sich im Berufsleben zu Leitmotiven, andere sind polare Tendenzen, zwischen denen fortlaufend Bewegungen und Positionierungen stattfinden. Licht- und Schattenseiten gehören zusammen. Für manche Probleme können nicht immer befriedigende Lösungen und Verhaltensweisen gefunden werden.
Ich wünsche und hoffe, dass meine selbstexplorativen Ausführungen den Leser anregen, sich mit der Gemengelage der eigenen beruflichen Identität zu beschäftigen und ihrer Genese nachzugehen. Selbstreflexive Gedanken an das Gelesene zu knüpfen, Folgerungen daraus zu ziehen, zwischen dem Profil der geschilderten Person und den eigenen Bedingungen, Erlebnissen und Erfahrungen hin- und herzudenken – das kann zur Selbstklärung beitragen. Und diese ist eine nützliche, ja unverzichtbare Voraussetzung mündigen Handelns, das dem Handelnden selbst und anderen guttut. (Kapitel 10 wird die Thematik des persönlichen Selbstkonzepts aufgreifen und weiterführen.)
Nun also einige Punkte meiner persönlichen beruflichen Selbstdiagnose mit Gedanken zu ihrer Vermitteltheit. Nur wenige besonders prägende Personen möchte ich ansprechen – Lehrer vor allem. Ich verzichte darauf, näher ins Familiäre zu gehen, obwohl sicher mancherlei beruflich relevante Motive durch meine Eltern, Brüder und das »Klima« in der Familie beeinflusst wurden.