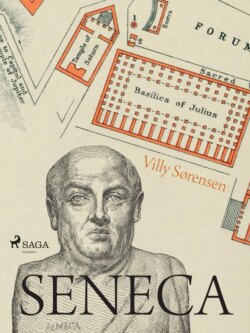Читать книгу Seneca - Ein Humanist an Neros Hof - Villy Sørensen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Geschichte und Moral Geschichte und Schicksal
ОглавлениеZwischen den alten Kulturen und der modernen Industriekultur besteht der entscheidende Unterschied, daß die Alten am Alten festhielten, während die Neuen das Neue feiern. „Die Sitten der Väter“ waren für die Römer die höchste moralische Qualitätsbezeichnung. Sie suchten in allen Fällen den Präzedenzfall, was insofern seltsam war, als es – trotz Alexander dem Großen – für ihre eigene Welteroberung keinen Präzedenzfall gibt. Die kleine Bauern- und Sippengesellschaft im ältesten Rom breitete sich im Laufe der Zeit über den größten Teil der bekannten Welt aus; dies verlangte von den Römern andere Sitten als die der Vorväter und führte zu inneren Krisen, und als Rom im Jahre 146 v. Chr. seinen letzten ernsthaften Widersacher, Karthago, besiegt hatte, geriet Rom in einen Zwiespalt mit sich selbst. Doch nach Meinung der Römer lag das nicht daran, daß sie die primitive Einstellung der Vorväter beibehalten hatten, sondern daran, daß die Sitten der Vorväter in Vergessenheit geraten waren.
So sehr die Römer auch Geschichte schufen und Geschichte schrieben, auf den Gedanken, daß die Menschen ihre eigene Geschichte schaffen, kamen sie nicht. Zwar gibt es ein paar alte römische Sprichwörter, die besagen, daß jeder seines Glückes Schmied sei und daß dem Kühnen das Glück beistehe, aber sie sagen eben gerade, daß der Mensch durch seine Kühnheit das Glück auf seine Seite bringen kann. Er kann sein Glück schmieden, es jedoch nicht eigenmächtig „machen“. So waren die kühnen Römer Werkzeuge des Glücks, der fortuna, und ließ das Glück sie im Stich, dann äußerte sich das in fehlender Kühnheit, in versagender Moral.
In der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. nahm sich der Grieche Polybios vor zu schildern, wie fast die gesamte Welt in weniger als fünfzig Jahren unter die Herrschaft Roms gelangt war. Das lag seiner Meinung nach an der moralischen Überlegenheit der Römer und an ihrer Verfassung, die ihm als die beste der Welt erschien. Doch zu zeigen, wie das alles zugegangen war, bedeutete für ihn, durch „unsere Darstellung den Leser die Lenkung des gesamten Geschehens durch die Tyche ... ineins ... zusammenschauen lassen;“ denn das Werk der Römer verstand er als das „schönste und segensreichste Walten der Tyche“.1 („Tyche“ entspricht der fortuna der Römer.) Polybios meinte den Keim moralischen Verfalls bereits in dem siegreichen Rom zu sehen, aber er erblickte darin keine Ursache dafür, daß das Schicksal oder das Glück Rom im Stich lassen würde, sondern eher ein Zeugnis dafür. Daß das Schicksal den Lauf der Geschichte bestimmt, heißt, daß alles in der Geschichte mit der gleichen „natürlichen Notwendigkeit“ wie in der Natur abläuft. Alles, was in der Zeit entsteht, muß mit der Zeit vergehen, auch der Staat ist einem „gesetzmäßigen Kreislauf“ unterworfen, und wenn er nicht von außen zerstört wird, dann löst er sich von innen her auf, genau dann, wenn er – wie Rom – zu unbestreitbarer Überlegenheit gelangt ist.2
Was Polybios als eine allgemeine historische Gesetzmäßigkeit darstellte, meinten die römischen Geschichtsschreiber hundert Jahre später erfahren zu haben. Zur Zeit von Julius Cäsar schrieb Sallust: „Indes, als der Staat durch Anstrengung und Gerechtigkeit gewachsen, gewaltige Könige im Krieg bezwungen, wilde Stämme und ungeheure Völker mit Gewalt unterworfen waren, Karthago, die Rivalin des Römischen Reiches, von Grund auf vernichtet worden war, alle Meere und Länder offenstanden, da begann die Schicksalsgöttin (fortuna) zu wüten und alles durcheinanderzubringen. Leute, die Strapazen, Gefahren, unentschiedene und harte Lagen leicht ertragen hatten, denen wurden die Muße und der Reichtum, sonst wünschenswerte Dinge, zur Last und zum Unglück. Und so wuchs zunächst die Gier nach Geld, dann die nach der Herrschaft, das war gleichsam der Brennstoff für alles Übel.“3
Diese Darstellung entstand unter dem Eindruck der Bürgerkriege, die Rom hundert Jahre lang heimgesucht hatten. Aber als Octavian den Bürgerkrieg beendet hatte und zum Augustus erhoben worden war und überall Frieden herrschte, da hielt Livius nichtsdestoweniger die Zeit für gekommen zu untersuchen, welche Eigenschaften eigentlich Rom die Weltherrschaft gesichert hatten und wie es zuging, daß die Sitten danach immer schlechter geworden waren, um während seiner Zeit völlig in Auflösung zu geraten. Auch nach Livius’ Meinung war es der Reichtum, der die Habgier verschuldet hatte: der Reichtum und die Macht, die man durch die guten Eigenschaften gewonnen hatte, führten sozusagen zu den schlechten, zu Hab- und Machtgier. Dies ist scheinbar eine gute materialistische Erklärung: die Vorväter konnten leicht genügsam sein, solange die Verhältnisse ihnen nichts anderes gestatteten. Der Reichtum, den insbesondere die Eroberungen im Osten während der Zeit der Bürgerkriege nach Rom brachten, veränderte die ökonomische und politische Struktur der römischen Gesellschaft und trug dazu bei, den alten Gemeinsinn zu untergraben. Doch wenn die Geschichtsschreiber wohl auch einen Zusammenhang zwischen Reichtum und moralischem Verfall andeuten konnten, so vermochten sie doch keine andere Ursache für diesen moralischen Verfall zu erblicken, als daß die Sitten allmählich verfallen waren, und das wiederum erklärten sie damit, daß fortuna zu rasen begonnen habe. Die Römer besaßen einen so eingefleischten Schicksalsglauben, daß es ihnen nicht einfiel, nach materiellen Ursachen der verderblichen Begierde nach materiellen Gütern, die sie luxuria nannten, zu suchen. Seltsam war nach Livius’ Meinung nicht, daß die Sitten verfielen, denn das war das Gesetz der Geschichte, sondern daß es so lange gedauert hatte, bis der Verfall in Rom einsetzte: „in keinen Staat drang so spät Habsucht und Üppigkeit (luxuria) ein; es gab keinen Staat, wo Armut und Sparsamkeit so hoch und so lange in Ehren standen“.4
Wenn als selbstverständlich gilt, daß das Geschick bestimmt hat, was später geschehen soll, dann liegt es nahe, daß man Auskunft über die Zukunft einzuholen sucht. Vor allen öffentlichen Beschlüssen deutete man in Rom bestimmte Vorzeichen. Die Auguren lasen die Auspizien aus dem Verhalten der Vögel, die Haruspices aus den Eingeweiden der Opfertiere. Natürlich kann derjenige, der sich einen Einblick in die Zukunft verschafft hat, mit größerer Autorität sprechen als derjenige, der sich nur an seine eigene Meinung halten kann, und das Recht der Zukunftsdeutung, das auspicium, war denn verständlicherweise auch den höchsten Autoritäten im Staat vorbehalten. Es war ein politisches Machtmittel, und die Römer waren realpolitisch genug, um die heiligen Omina zu manipulieren, wenn es ihnen politische Vorteile verschaffte. Eine Amtsperson konnte so eine Volksversammlung verhindern, indem sie behauptete, sie habe es donnern hören. Dadurch darf man sich jedoch nicht zu der Annahme verleiten lassen, die Obrigkeitsvertreter hätten überhaupt nicht an die Omina geglaubt, die sie zuweilen herbeischwindelten. Kindliche Gemüter, die beim Spiel mogeln, vergessen ihre Mogelei oft und erinnern sich nur noch, daß das Glück mit ihnen war. Sogar der souveräne Julius Cäsar, den man von allen Römern am ehesten in Verdacht haben kann, er habe großzügig über Dinge hinweggesehen, in die andere Großes hineinsahen, glaubte zumindest an sein eigenes Glück, an die fortuna.