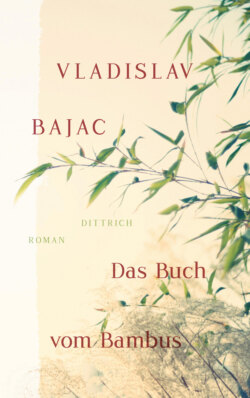Читать книгу Das Buch vom Bambus - Vladislav Bajac - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
Оглавление»Habe ich mit meinem früheren Leben abgeschlossen?«, fragte ich mich, als ich vor dem verschlossenen Tor des Klosters Dabu-ji stand. »Bin ich mir sicher, dass die Vergangenheit wirklich Vergangenheit bleiben wird?« Natürlich war ich mir nicht sicher. Ich wünschte es mir zwar, glaubte aber, meinen Wunsch nach Vergessen leichter erfüllen zu können, wenn ich mir sagte, die Vergangenheit gebe es nicht. Aber wie, wenn es sie nun einmal gab? Ich suchte nach einem Weg, der das bereits Geschehene nicht leugnen, aber die Reste der Vergangenheit mit dem Willen aussöhnen würde, ein mir unbekanntes Ziel zu erreichen. Ich suchte nach etwas, was auf mich wartete. Etwas Vertrautes zu wählen, war keine Lösung. Ich musste es zulassen, dass mich neue Erfahrungen von der Fäulnis befreien, die sich wie ein Spinnennetz über meine Seele gelegt hatte.
Als schlimmster Feind erweist sich das, was bleibt. Der Mensch kämpft gegen größten Schmerz an, ohne nachzudenken oder einen Plan zu haben, weil die Natur ihm befiehlt, sich zur Wehr zu setzen. In einem solchen Moment sucht man nicht nach einer Lösung, sondern nur nach Schutz, nach einem Ausweg aus dem Schmerz. Ist der Sieg nicht vollkommen, erweist sich das, was von der Verletzung zurückbleibt, als schlimmer denn die Verletzung selbst. Man weiß nicht, wie man mit den Überbleibseln umgehen soll, kann ihnen nichts anhaben, denn sie zu besiegen, heißt, eine erprobte, sichtbare, sichere Lösung zu haben. Und das wiederum erfordert einen starken, abgebrühten Kämpfer, der mit dem Sieg etwas anzufangen weiß. Wer ausgelaugt ist, weil er einen Fels bezwungen hat, besitzt nicht mehr die Kraft, auch noch die Steinchen aufzusammeln, und er wird verletzlicher denn zuvor, als die Trompeten zum Angriff riefen.
Genauso stand ich nun vor dem großen, hölzernen Tor von Dabu-ji.
Es wurde mir von jemandem geöffnet, den ich nicht sehen konnte. Vielleicht war es aber auch von selbst aufgegangen. Vor mir lag ein beidseits von jungen Bambuspflanzen gesäumter Kiesweg, der zur Veranda von einem der Gebäude führte. Auf einem breiten Treppenabsatz mit einer Bank blieb ich stehen. Über ihr begann die blitzsaubere Veranda aus dunklen, glatten Dielen. Ich setzte den Hut ab, machte den Gürtel auf, nahm mein Bündel vom Rücken und legte alles vor mir ab. Um mich bemerkbar zu machen, schlug ich die Glocke, dann holte ich das Papier mit meinem Bittgesuch hervor. Halb auf der Bank sitzend beugte ich mich vornüber und ließ den Kopf auf meine Hände sinken, die auf dem Bündel lagen. In dieser Haltung wartete ich, dass jemand kommt. Nach mehr als zwei Stunden, in denen ich mich nicht zu rühren wagte, hörte ich Schritte näher kommen. Ohne den Kopf zu heben, sah ich eine Hand, die mein Bittschreiben aufhob. Eine Stimme fragte:
»Wer bist du?«
»Mein Name ist Cao und ich möchte hier Unsui werden.«
»Bei welchem Röshi hast du früher gelernt?«
»Ich hatte keinen Lehrer außer meinem Willen.«
»Warte einen Augenblick«, und weg war er.
Ich harrte noch einige Stunden in derselben Haltung aus, bevor ein zweiter Mönch erschien.
»Dieses Kloster hat genug Schüler. Wir können dich nicht aufnehmen.«
Ich blieb hartnäckig und bewegte mich keinen Zentimeter. Ich wusste, dass man meine Ausdauer und Willenskraft auf die Probe stellt und mich nicht aus den Augen lässt. Die Schmerzen im Rücken, in den Knien und in den Zehen wurden stärker. Gegen Abend kam der erste Mönch wieder.
»Hier herrscht strenge Disziplin. Geh besser an einen anderen Ort.«
Für mich, einen Anfänger, konnte es keinen anderen Ort geben. Gäbe ich jetzt auf, würde sich das schnell herumsprechen, und kein einziges Kloster würde mich mehr aufnehmen. Ausschlaggebend war einzig meine Ausdauer.
Die Schmerzen wurden unerträglich, doch ich presste mich weiter fest an meine Hände und den Boden unter mir. Niwazume verlangte nicht nur Bewegungslosigkeit, sondern auch vollkommene Stille. Ich ging auf keinen der abweisenden und beleidigenden Sätze ein, die man an mich richtete. Hätte ich auch nur ein Wort gesagt, wäre ich sofort hinausgeworfen und nie wieder durch ein Shöji gelassen worden.
Es wurde Abend. Den Körper spürte ich nicht mehr. Ich glaubte jeden Moment zusammenzubrechen. Da kam ein Mönch herbei und stellte mir eine Schale mit Reis hin. Mit langsamen Bewegungen, die meine Schmerzen und die Angst vor der Ohnmacht verbergen sollten, setzte ich mich auf und aß. Sogleich nahm ich wieder meine vorherige Haltung ein. Diesmal musste ich nicht lange warten. Man sagte mir, dass ich im Tankaryo übernachten könne und am Morgen das Kloster verlassen müsse. Die dünne Schilfmatte, die ich erhielt, schien mir so bequem, dass ich einschlief, sobald ich mich hingelegt hatte. Ich hatte weder Träume noch Albträume. Ich schlief nur ein, und als ich einen Augenblick später wieder wach wurde, war es Morgen. Schnell rollte ich den Futon zusammen und nahm am Platz vom Vortag, entgegen der gestrigen Aufforderung, den Garten zu verlassen, wieder meine demütige Haltung ein. Ein wenig an den Schmerz im Körper gewöhnt, ertrug ich das Warten auf neue Herausforderungen leichter. Zu Mittag erhielt ich, begleitet von neuen Kränkungen, dasselbe Essen wie am Vortag. Gegen Abend war aller Schmerz von zuvor ausgelöscht, betäubt von Schwellungen an Armen und Beinen. Ich fühlte, dass auch mein Gesicht aufgedunsen und geschwollen war. Der Mönch erschien erneut.
»Da du den aufrichtigen Wunsch zu haben scheinst, zu uns zu kommen, werden wir dich ins Tankaryo lassen. Glaub aber nicht, dass jetzt alles in Ordnung ist und deine Mühen abnehmen werden. Es kann dir jederzeit passieren, dass wir dich hinauswerfen.«
Die nächsten vier Tage verbrachte ich in einem geschlossenen Raum. Alles, was ich sah, war eine Hand, welche die volle Essensschale brachte und die leere wieder mitnahm. Im Tankaryo zu sein, hieß, dass ich nur die vorübergehende Erlaubnis bekommen hatte, mich in diesem abgegrenzten Raum aufzuhalten. Die echten Prüfungen standen mir noch bevor. Ich musste die ganze Zeit in sitzender Haltung verbringen, etwas bequemer als vorher, und mich auf mich selbst und mein Inneres konzentrieren. Die Zazen-Übung konnte ich nur dann unterbrechen, wenn mir das Essen gebracht wurde. Es stand mir frei, nachts einige Stunden zu schlafen, doch ich nutzte sie fast alle zum Zazen. Der erschwerende Umstand, dass ich zuvor keinen Meister gehabt hatte und dass mir nur gebildete Laien ihre persönlichen Erfahrungen vermittelt hatten, ließ mir keine Wahl: Ich musste den Wunsch zu bleiben bis zum Schluss zeigen. Das zweite Problem war meine laienhafte Kenntnis des Zazen: Ich wusste nicht, was es in mir hervorrufen, was es verändern und erreichen soll. Die Erzählungen anderer genügten dabei nicht. Daher versuchte ich, so ruhig wie möglich zu sein und alle störenden Gedanken auszuschalten. Ich hatte so viel Zeit vor mir, dass ich sie, wie ich bereits wusste, mit irgendetwas ausfüllen musste. In den ersten zwei Tagen gingen mir verschiedene Gedanken durch den Kopf, die mich ziemlich durcheinanderbrachten. Zum Glück erinnerte ich mich immer wieder beizeiten, wo ich war und warum. Daraufhin behalf ich mir eine Weile damit, alle Handlungen und Bewegungen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt vor dem Kloster und in seinem Garten ausgeführt hatte, an mir vorüberziehen zu lassen. Wenn ich es mir recht überlegte, hatte ich das Tor zum Kloster selbst geöffnet. Ich hatte es nur leicht berührt, und ein prächtiges Ambiente war zum Vorschein gekommen. Dabu-ji lag auf der Spitze des Bergs Shito, genauer gesagt, auf der letzten Hochebene vor dem Gipfel. Als die große Pforte aufging, gab sie den Blick auf die Vegetation und die Pfade hinter dem Kloster frei, die aus den Dächern der Klosterbauten herauszuwachsen schienen. Die Stille war beinahe vollkommen. Die Vögel des Morgens hatten bereits ihr Lied gesungen und waren jetzt mit ihren täglichen Pflichten beschäftigt. Man hörte nur das leise Rauschen des Baches, der sich mit aller Geschwindigkeit, die das Gefälle des Bergs hergab, in die Ebene ergoss, dort langsamer wurde und wie ein selbstgefälliger farbenprächtiger Paradiesvogel stolz seine Schönheit zeigte, um daraufhin mit den Worten »So, nun habt ihr gesehen, wie ich sein kann« ungestüm seinen Weg fortzusetzen, als habe er im Tal eine wichtige Verabredung, zu der er schon längst zu spät kommt.
Nachdem ich, von den unermüdlichen Wächtern noch unbeobachtet, das Bambusspalier zur Veranda des Zendō durchschritten hatte, erblickte ich vor dem Haupteingang zur Zazen-Halle die Statue des königlichen Hüters des Tempels, in der Pose von erwarteter Gefahr, mit furchteinflößendem halb geöffneten Mund und auf den Eindringling gerichteten Augen. Das Fenster des Zendō gleich neben ihm hatte einen hölzernen Rahmen in Form einer Flammenspitze. Sollte all das unerwünschte Besucher abschrecken und die Unsicheren davon abhalten, hier länger zu verweilen?
Auf der Veranda nahe der Stelle, an der ich mein Gepäck abgesetzt hatte, hinter einer großen Glocke, die zusammen mit einem hölzernen Schlägel an einem Gestell hing, stand eine Leinwand mit großen, wohlgeschwungenen, aber mir unbekannten kalligraphischen Zeichen. In diesem Moment war mir durch den Kopf gegangen, dass mir eigentlich alles Unbekannte Angst einjagt. Ich hatte recht. Unwissenheit gebiert Angst.
Diese Erkenntnis half mir, mein unbeholfenes Zazen ruhiger und zuversichtlicher fortzusetzen. Ich hörte auf mich zu fragen, was ich hier eigentlich mache, was ich will und dergleichen mehr.
Gegen Ende des vierten Tages ließ man mich wissen, dass ich mich den anderen Unsui des Klosters Dabu-ji anschließen könne.
Weisungsgemäß fand ich mich wieder unterhalb der Veranda ein. Einer der Schüler brachte mir einen Kübel Wasser. Ich zog meine Strohsandalen und die Tabi aus. Ich musste mir gründlich die Füße waschen, um nicht versehentlich die Tatamis in einem der Räume schmutzig zu machen. Als ich mir die Füße begoss, erhielt ich einen kräftigen Schlag auf den Rücken. Über mir stand einer der Aufseher mit einem Stock in der Hand.
»Vergeude keinen Tropfen Wasser!«
Schweigend band ich Strümpfe und Sandalen aneinander und schlüpfte in die Holzsandalen, die ich bekommen hatte, um sie außerhalb der Räume zu tragen. Ich richtete mich auf und sah mich um. Alles um mich herum strahlte Ruhe aus. Ich fragte mich, ob ich sie auch in mir finden würde.