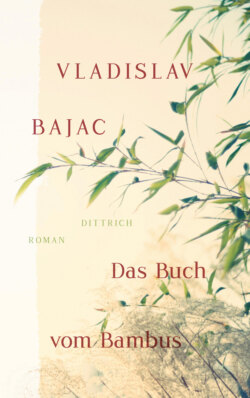Читать книгу Das Buch vom Bambus - Vladislav Bajac - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XVII
ОглавлениеIch hatte den Rōshi zufriedengestellt?! Ich hatte vor allem mich selbst zufriedengestellt. Die Worte, die er an mich gerichtet hatte, waren vollkommen klar. Ich musste mich nicht fragen, ob er etwas ahnte. Er weiß alles! Er weiß, wer ich bin! Seit wann? Das ist unwichtig. Er hatte sich genauso verhalten, wie er es mich lehrte: Er hatte mir nicht nur zu verstehen gegeben, dass er meine Vergangenheit kannte, sondern mich gleich der Versuchung, der Gefahr ausgesetzt, hatte es mir überlassen, ob ich etwas riskieren würde, ob ich mich herauswinden, bereuen, Verachtung zeigen oder triumphieren würde. Was davon ich zeigen würde, hing von mir ab. Dem Rōshi wäre es am liebsten gewesen, wenn ich gar nichts gezeigt hätte. Fast wäre mir das auch gelungen. Zumindest hatte ich auf sein Lob nichts entgegnet. Ich stand wieder ganz am Anfang. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes – ein Schüler. Ich hatte geglaubt, das größte Geheimnis seit Bestehen dieses Klosters zu hüten, und war ertappt worden wie ein Kind beim Stehlen. Es gibt also jemanden, der über allem und jedem steht und mein Dunkel beherrscht, aber nicht steuert. Dieser Jemand ist da, um mich sanft zum Wasser zu führen, wo es am seichtesten ist.
Es war gut, dass ich mich nicht hilflos fühlte. Ich hatte festen Boden unter mir, und der hieß Sicherheit oder Überzeugung oder Kies. Das war bis vor kurzem anders gewesen – als ich mir noch zu viele Fragen, unmögliche Forderungen und Fallen stellte.
Welche Veränderungen musste ich durchgemacht haben, wenn mich der arme Meno nicht erkannte? Vielleicht hätte er mich ja auch erkannt, wenn er mich nur genauer betrachtet hätte. Doch warum hätte er das tun sollen? Tote betrachtet man nicht. Oder besser: Nach Toten sucht man nicht.
Meno war der Grund, wieder an eine Frau zu denken. Er hatte mich an die Geburt, die Liebe erinnert. Nicht jedoch, wenn ich es mir genauer überlegte, an jene schmerzlichen Ereignisse, die mich zur Flucht gezwungen, dann aber vor dem Grauen bewahrt hatten. War es möglich, dass ich, obwohl man mich an die jüngste Vergangenheit erinnert hatte, auf dem Weg dazu war, sie nicht als Widersacher und Feind zu sehen? Wenn es mir gelungen war, mich über einen Gegner wie diesen zu erheben, und das sogar ohne Absicht, würde ich mit Gleichmut auf den kommenden Tag warten und ihn, wenn nötig, auch bezwingen können. Sein Kommen war unvermeidlich, doch ich trat nicht voller Angst den Rückzug vor ihm an. Früher hätte ich das einen Sieg genannt!
Der Hinweis des Lehrers, Nachdenken erschwere den Weg zur Erleuchtung, war ständig in meinem Hinterkopf präsent. In dieser Sache fühlte ich mich unsicher. Ich hatte noch einen langen Weg vor mir, um mich von der lähmenden Vergangenheit zu lösen. Ich glaube, der Rōshi sah mir meine Langsamkeit nach. Er wusste, dass die Last der Irrtümer, die ich mit mir herumschleppte, um ein Vielfaches schwerer wog als das Päckchen, das andere Schüler zu tragen hatten. Obwohl auch ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, viel zu reden, wollte ich den Meister an meinen großen, stillen Empfindungen teilhaben lassen. Den Rōshi zu fragen, was Erleuchtung sei, war das Letzte, was ein Schüler tun durfte. Zur Antwort hätte ich ein »Mu!« oder einen Schlag auf den Kopf oder irgendeine unverständliche Erklärung bekommen, die mich nur noch mehr verwirrt und abgelenkt hätte. Reaktionen wie diese dienten ja auch dazu, die allzu Neugierigen eindringlich daran zu erinnern, dass man die Buddhaschaft nicht durch Fragen erlangt. Doch ich wollte das Risiko eingehen. Ich erwartete nicht, das Geheimnis dieses erhabenen Zustands zu ergründen, und auch nicht, augenblicklich den Sinn meines Lebens zu verstehen. Ich wollte die Meinung des Rōshi über das hören, was ein Gesprächspartner wie ich nicht von sich aus verstehen kann, weil er das, was man ihm sagen wird, nicht erlebt hat. Weder konnte ich wissen, was der Meister mir sagen würde, noch war ich mir sicher, ob er mein Bedürfnis verstehen würde, ihn anzuhören. Auch wenn er gar nichts zu mir sagen sollte, würde mir das nichts ausmachen, wenn er nur Verständnis für mich aufbrächte.
Dann überlegte ich es mir aber doch anders. Hatte mir der Meister nicht schon genug Vertrauen entgegengebracht? Hatte er nicht schon mehr als genug bei unserer letzten Begegnung gesagt? Ausgerechnet jetzt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich allmählich der neuen Ordnung anpasse, soll ich mich dem Unbekannten stellen und die Ungewissheit schneller besiegen, die, wenn sie denn eine war, ihr Wesen ja nicht ändert, nur weil man ihre Zeit beschneidet. Und alles nur, weil ich von Ungeduld durchdrungen bin! Nein, der Grund, wie vernünftig und berechtigt er mir auch erschien, war nicht ausreichend.
Ich glaube, dass mich etwas anderes auf diese Gedanken gebracht hatte. Wenn ich nicht begierig war zu erfahren, was hinter der Lehre stand, warum dann ein derartiges Verlangen, ein Wort des Meisters zu hören? Ich dachte immer mehr über ihn nach und begann mich zu fragen, warum. Der Rōshi verhielt sich zu mir genauso wie zu allen anderen Unsui, doch seit er mir zu verstehen gegeben hatte, dass er viel mehr über mich wusste, als ich mir vorstellen konnte, hatte sich mein Verhältnis zu ihm geändert. Mich zog seine Fähigkeit an, Wissen, Gefühle und Risiko zu etwas zu vereinen, das ich Weisheit nannte. Dieses Wort konnte leichter als andere die Erfahrung eines ganzen Lebens ertragen und die Erfahrungen anderer aufnehmen, die diese Weisheit noch nicht besaßen – als wolle es sie einfrieren und für den Moment bewahren, da auch ich endlich meine eigene Weisheit erlangen würde und imstande wäre, sie gut erhalten von ihm zu übernehmen und mit neuen Erfahrungen zum Kern dessen zu formen, was aus mir entstehen würde.
Ich merkte erst jetzt, dass ich im Garten umherging. Es kam mir vor, als sei ich schon seit Stunden auf den Pfaden unterwegs. Ich blickte mich um. Niemand war in der Nähe. Ich setzte mich unter die Blätter einer großen Palme und bemerkte ein kräftiges Rot am Himmel. Abende wie diesen gab es hier häufig. Zu wem mochte dieses Rot wohl gehören – zur untergehenden goldenen Sonne oder zur heraufziehenden Dunkelheit? Es war keine Brücke zwischen Tag und Nacht. Es trennte sie, unterstrich ihre Verschiedenheit, trug das eine zu Grabe und gebar das andere. Zu wem aber gehörte es?
Der Meister? Der Vater! Hier war die Verbindung. Wie die Zwischenzeit, die ich am Himmel gesehen hatte, fühlte auch ich mich irgendwie dazwischen. Hier der in Vergessenheit geratende Vater, da der sich in meinem Inneren zeigende Meister. Wie doch Kinder ihren Vater anders als alle anderen sehen! Meiner war für die anderen ein Herrscher mit eiserner Hand und großem Reichtum gewesen, ich aber hatte das fast gar nicht bemerkt. Auf der Straße kam er ihnen prächtig gekleidet vor, ich jedoch sah, dass er den rechten Fuß ein wenig nachzog. Trotzdem hatte er einen schönen Gang. Wenn er aus vollem Halse lachte, sahen die Leute – meine Mutter eingeschlossen – einen Sturm heraufziehen und hielten sich von ihm fern, ich jedoch machte Freude in ihm aus. Irgendwer lag falsch. Oder hatten alle recht?
Gerade ging mir auch etwas durch den Kopf, was mir zuvor nicht in den Sinn gekommen war: Es war wohl so, dass ich zu meinem Vater bis zu seinem Tod ein Verhältnis hatte, in dem er ein von mir erschaffenes Bild war, während ihn die anderen ihrer Sichtweise und Überzeugung nach in Erinnerung behielten. Folglich hatte jeder Mensch so viele Gesichter, wie es Menschen gab, die ihn charakterisierten. Schwieriger festzustellen war, ob – unabhängig von dieser Schlussfolgerung – jeder Mensch auch tatsächlich so viele Gesichter in sich trug, wie es Bilder von ihm bei anderen geben konnte. Das klingt für mich so unglaublich, dass es sogar stimmen könnte.
Beinahe unbemerkt war noch ein Mensch tief in mein Leben eingedrungen. Würde auch ich mich bald fragen, zu wem ich gehöre?