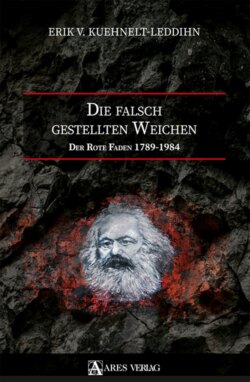Читать книгу Die falsch gestellten Weichen - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 15
9. DIE NATIONALDEMOKRATIE
ОглавлениеDer Vormärz Europas, die Periode vor dem Wiener Kongreß bis zum Revolutionsjahr 1848, erweckte, wie wir schon sagten, den Anschein einer Konsolidierung des Ancien Régime in einer erneuten Form, und dies obwohl bald da, bald dort ein Wetterleuchten zu sehen war. Das Bürgertum hatte sich mit der leicht veränderten Ordnung trotz der Romantik noch nicht abgefunden. Zwar sprach man allenthalben noch mit großem Abscheu über die gräßlichen ‚Auswüchse‘ der Französischen Revolution, aber die Gestalt Napoleons hatte doch überall (auch in den Ländern, die von ihm unterjocht worden waren) einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. In der Erinnerung lebte er nicht nur als militärischer Heros, sondern auch als Mediator der Französischen Revolution, in einer gemilderten Form auch als ‚Reformator‘. Was nun blieb, war der Code Napoléon im Rheinland (bis auf unsere Tage), die Zusammenlegung zahlreicher Herrschaften im Süden und Westen des Deutschen Bundes (aber nicht in seiner Mitte), es blieben die allgemeine Wehrpflicht und auch eine beginnende Verbürgerlichung des Offizierskorps und es kam, abgesehen von der industriellen Revolution, langsam ein Näherrücken der Staaten und Völker durch die Eisenbahn. Vor allem aber kam eine Steigerung des Nationalgefühls als kollektive Kraft nicht neben, sondern mit der Demokratie. Volksherrschaft und völkische Herrschaft sind verwandte Begriffe. Das Bürgertum war zusehends demokratisch und national gesinnt. Während aber nun in Frankreich die Revolution von 1848 einen vorwiegend demokratischen Charakter trug, hatten, die Revolutionen in Mitteleuropa einen ebenso demokratischen wie nationalen, im östlichen Mitteleuropa wie auch in Italien einen betont nationalen Charakter – wohl auch mit einer Spitze gegen die „fremde Dynastie“. Diese Revolutionen wurden alle niedergeschlagen, es folgten Jahre der „Reaktion“, doch die Sache der demokratisierten, also der konstitutionellen Monarchie (wenn auch noch nicht der Republik) machte nach diesem Rückschlag weitere Fortschritte. Außer in Frankreich war es allenthalben deutlich, daß diese „Erhebungen“ noch keinen echten Massencharakter hatten. In Frankreich allerdings gingen die Uhren anders: Dort war nicht nur die Erinnerung an die Französische Revolution noch lebendig; dort gab es in den großen Städten ein echtes Proletariat.1) (Auch in England rührten sich die Chartisten im Jahre 1848 zum letztenmal.) Deshalb fand die achtundvierziger Revolution in Frankreich in zwei Wellen, einer bürgerlichen und einer proletarischen, statt. Die proletarische wurde zweimal (1848 und 1851) in großen Blutbädern niedergekämpft. Die Bitternis, die davon übrigblieb, führte 1871 zur Pariser Kommune. Mitteleuropa blieb von diesem neuen Phänomen verschont. Es sei aber auch hier vermerkt, daß die Monarchen stets mit überraschender Leichtigkeit abdizierten, während die bürgerlichen Kräfte ein viel stärkeres Stehvermögen zeigten.2)
Nun aber war um die Jahrhundertmitte das Bürgertum ein starker und im weiteren Sinn des Wortes auch ein elitärer Stand, der sich in einer freien Wirtschaft durch eine hohe Selektion auszeichnete. Auch hatte das Bürgertum eine asketische Tradition, die im Adel nur bruchstückhaft vorhanden war. Dieses bürgerliche Selbstbewußtsein schwächte sich zwar im 19. Jahrhundert ab, als es sich – zum Teil erfolgreich – an den Adel zu assimilieren suchte, adelige Sitten, Gebräuche und Umgangsformen übernahm. Im alten Deutschen Reich gab es auch ein recht standesbewußtes Patriziat, das besonders in den früheren Reichsstädten beheimatet war. (Man sehe sich da einmal die monumentalen Grabmäler der Familie Bonhoeffer in Schwäbisch-Hall an!) Dazu kamen die Nobilitierungen, die besonders in Österreich und Bayern sehr häufig waren und bewußt zur Elitenbildung beitrugen. Davon zeugen zum Beispiel die Standbilder der berühmten Professoren vor der Wiener Technischen Universität. Von acht der dort vertretenen Männer waren sieben Adelige oder Geadelte.3) Und von der Wiener Ökonomischen Schule waren oder sind fast alle Leuchten adeliger Herkunft.4))
Es war nur zu natürlich, daß das zu Bildung und Vermögen gekommene Bürgertum einen Platz an der Sonne und an der Ausübung der politischen Gewalt ein Mitspracherecht haben wollte. Tatsächlich beendete die Revolution von 1848 alle adeligen Privilegien mit der Ausnahme der Fideikommisse, eine Einrichtung, die im Grunde jedem Engländer offenstand und bei uns nur dank unseres Erbrechts ein Privileg darstellte.5)
Doch der Nationalismus, durch die napoleonischen Kriege auch im Herzen Europas wachgerufen, fand östlich des Rheins einen noch stärkeren Widerhall als die Demokratie, und zwar ganz besonders dort, wo es eine „Fremdherrschaft“ gab. Je weiter östlich und südlich, desto stärker der „Nationalismus“. Die Bindungen – und das war neu – waren nun nicht mehr vertikal, sondern horizontal. Staat und Volk wurden zunehmend gleichgesetzt, die Stände wichen den Klassen und man beschnüffelte sich nun nach der „Volkszugehörigkeit“. Geschichtliche Grenzen bedeuteten weniger und weniger. Ein „vaterloses“ Herdengefühl machte sich allenthalben bemerkbar. „Welche Sprache sprichst du? Welcher Sitte folgst du?“ Das waren die Fragen, die nunmehr gestellt wurden und nicht vielleicht: „Welchem Herren dienst du?“ Und da war auf einmal dem Mann aus Aussig der Dresdner „näher“ als ein Tscheche aus Prag – obwohl der Aussiger und der Prager beide Böhmen waren. Der Serbe aus der Vojvodina sah nicht mehr nach Buda, sondern schielte nach Belgrad, dem Triestiner lag Rom oder Turin näher als Wien. Gottfried von Herder hatte schon früher die Slawen „entdeckt“. Die Teilungen hatten den Patriotismus6) der Polen zwar nicht aufgehoben, aber illusorisch gemacht. Es blieb ihnen nun als „Bindemittel“ nur mehr der Nationalismus übrig, der sich mit der Zeit aber nur religiös oder sozialistisch ausrichten konnte. Die Gleichsetzung des Polentums mit der Kirche war in Hinsicht auf die russische und die preußische Teilungsmacht höchst natürlich, die sozialistische Tendenz in der Abwehr der Petersburger Spaltungstendenzen auch nicht überraschend, versuchte doch die russische Regierung, das Bauerntum gegen den Grundbesitz und die Städter aufzuhetzen. Es entwickelte sich daher ein polnischer „nationaler Sozialismus“, der auch im Adel7) und im Bürgertum Unterstützung fand. Der Widerstand sollte „kollektiv“ werden. Zweifellos aber brachte der Nationalismus unsägliches Elend über Europa: Er war schon ein Faktor im Ersten Weltkrieg, wurde aber mit 1918 ein entscheidendes Element in der Großen Europäischen Dauerkrise.
Das nationale Problem berührte aber vor allem das seit 1804 bestehende „Kaiserthum Österreich“. Franz IL, Römischer Kaiser, nahm damals in Hinsicht auf die Tatsache, daß Napoleon auch die römische Kaiserwürde anstrebte8) und daß auch alle deutschen Fürsten mit Ausnahme des preußischen Königs Vasallen Napoleons waren, den Titel eines Kaisers von Österreich an. Zwei Jahre später, nach der Gründung des Rheinbunds, entsagte er der römischen Kaiserwürde. Damit war das Ende des Ersten Reichs gekommen. 1815 wurde das Römisch-Deutsche Reich trotz Protestes des Nuntius nicht erneuert; das zentralistische Kaisertum Österreich, das Königreich Preußen und der Deutsche Bund nahmen seinen Platz ein. Der „Kaiser“ residierte allerdings weiter in Wien, der Doppeladler, die Volkshymne und die Schwarzgoldenen Farben waren auf Österreich übergegangen, und der österreichische Delegierte war in Frankfurts Paulskirche ex-officio der Vorsitzende bei den Versammlungen des Deutschen Bundes. Doch nach der Bildung des neuen Kaisertums, das sicherlich historisch-organisch gewachsen war und sich von der Grenze Piemonts bis zur Ukraine erstreckte, war kein neuer, allgemein akzeptierter Patriotismus entstanden. Die innere Struktur dieses neu-alten Gebildes war nicht sorgfältig durchdacht und in so vieler Beziehung fragwürdig. Das einigende Band der gemeinsamen Dynastie, die weithin gemeinsame Religion und die Armee9) genügten nicht, um schwersten Niederlagen und größtem Druck standzuhalten.
Man darf nicht vergessen, daß zum Beispiel ein Ungar einem Land angehörte, das 896 gegründet wurde und seit 1001 ein Königreich war, ein Land mit Grenzen, die Élisée Reclus, der große französische Geograph, für die idealsten Europas hielt. Die heilige Wenzelskrone, die Böhmen, Mähren und Schlesien verband, ging ins 10. Jahrhundert zurück. Kroatien mit Dalmatien und zum Teil mit Bosnien war einer der ältesten Staaten Europas. Auch das nunmehr geteilte Polen existierte schon im 10. Jahrhundert – von der Republik Ragusa ganz zu schweigen.10) Im Vergleich zu diesen uralten Staatswesen war selbst das alpine Österreich ein historisches Flickwerk, recht neu, ein Land das erst im 14. Jahrhundert Tirol einverleibt hatte und Salzburg gar erst mehr als 400 Jahre nach dem friedlichen Anschluß von Triest. (Ohne Habsburg hätte Österreich zweifellos nicht über das Salzkammergut hinausgereicht!) Allerdings waren Triest, die Küstenlande und was heute Slowenien genannt wird alte habsburgische Erblande. Der böl mische König war Kurfürst des Römisch-Deutschen Reiches, der österreichische Erzherzog war es nicht. Zudem war der österreichische Erzherzogstitel auf dem gefälschten Privilegium Maius gegründet. Die „Erblande“ waren Erbgut der schweizerischen, dann schweizerisch-lothringischen Habsburger, sicherlich das vornehmste und, sagen wir es ohne Zögern, das beste und humanste Herrschergeschlecht, das Europa je hervorgebracht hatte. Aber dennoch müssen wir hier die Frage stellen: Wie konnte man von einem Ungarn (gleichgültig ob er Magyare oder Nichtmagyare war), von einem Böhmen deutscher oder nichtdeutscher Zunge, von einem Dalmatiner kroatischer, italienischer oder serbischer Abstammung verlangen, sich als „Österreicher“ zu fühlen? Das war nicht nur für „national“, sondern auch für geschichtlich denkende Menschen nicht allzu leicht. Es war dies einfacher bei Soldaten oder bei Beamten, die einen Eid dem gemeinsamen Herrscher geleistet hatten und zu ihrem Monarchen in einer Art von Feudalverhältnis standen. Mit dem katholischen Klerus war das wieder anders: Dieser entstammte zumeist dem mittleren (zumal auch den unteren, bäuerlichen) Schichten, und da waren nationalistische Tendenzen nicht selten. Das war besonders dort der Fall, wo es keinen „nationalen“ Adel gab, wie zum Beispiel in der Slowakei und in Slowenien,11) und der Klerus somit als Erster und Zweiter Stand auch eine politische Führerrolle innehatte. Auch gab es in der Monarchie einen besonders starken Nationalismus der nichtkatholischen Gebiete, wie in den reformierten Komitaten Ungarns, der lutherischen Nordwest-Slowakei, den Überresten der Reformation in Böhmen und Mähren, denn die Dynastie hatte schließlich die Gegenreformation „am Gewissen“.
Doch war die Lage innerhalb des Kaisertums Österreich insoweit noch komplizierter, als es ein flüchtiger Blick vermittelt, weil es innerhalb seiner historischen Kronländer ethnische Minderheiten gab, was sich gerade im Jahre 1848 explosiv auswirkte. Der Aufstand der „nationaldemokratischen“ Tschechen in Prag fand keinen Widerhall bei den Deutschböhmen und Deutschmährern. Der ungarische Aufstand fand Slowaken, Siebenbürger Rumänen, südungarische Serben und Kroaten auf der Seite der Habsburger und der Wiener Regierung…, nicht aber die große Mehrheit der ungarländischen Deutschen.12) Es muß auch vermerkt werden, daß bei den Aufständen der von Italienern besiedelten Provinzen Österreichs, der Lombardei und Venetiens, die Mehrzahl der Bauernschaft keine Begeisterung für das Risorgimento zeigte und wacker mit der kaiserlichen Armee kollaborierte.13) Hinter dem Risorgimento standen Bürger, Intellektuelle und ein Teil des Adels. Nach dem Sturz der Bourbonenherrschaft im Königreich beider Sizilien war das einfache Volk ganz und gar nicht auf der Seite der „Befreier“. Jahrelang hatte die neue italienische Regierung gegen höchst populäre Banden von Aufständischen (die allesamt als Briganten hingestellt wurden) zu kämpfen. In den früheren österreichischen Provinzen, wie auch in der Toskana, wo Habsburger regierten, verschlechterte sich nach dem Risorgimento die Verwaltung zusehends. Bis zum heutigen Tag ist die österreichische Herrschaft selbst in Friaul in bester Erinnerung geblieben.14)
Da aber in der Geschichte, besonders in der neueren Geschichte, die Politik in der Städten gemacht wird, ist die Stimmung in den Städten und ganz besonders in den Großstädten von ausschlaggebender Bedeutung. Die Revolutionen im Mittelalter kamen größtenteils vom Land. Nicht der Handwerker oder der Großbürger, sondern der Bauer revoltierte, obwohl auch da natürlich Ausnahmen zu vermerken sind. Der städtische Charakter der Revolutionen zeigte sich im Jahre 1848 mit großer Deutlichkeit.
Sezessionistisch-nationalistische Bewegungen gab es jedoch in den deutschen Landen nicht. Die „Nationale Frage“ drehte sich dort um das Problem Großdeutschland-Kleindeutschland. Die Kleindeutsche Lösung, die 1871 verwirklicht wurde, war die Errichtung eines (Zweiten) Deutschen Reiches unter preußischer Führung. Echt konservative Elemente lehnten dies ab. Selbst ein preußischer König wie Friedrich Wilhelm IV., der „Romantiker auf dem Königsthron“, der sich geweigert hatte, die Krone aus der Hand der Bundesversammlung, „aus der Gosse“, anzunehmen (wie zum Beispiel Louis-Philippe, der sich vom Parlament hatte wählen lassen), erklärte rundweg, daß er doch nicht deutscher Kaiser werden könnte, solange ein Kaiser in Wien residiere.15) Und es war natürlich selbstverständlich, daß die gemäßigte Linke nach Berlin blickte, wie es ja auch seinerzeit die Französischen Revolutionäre getan hatten, denn Berlin, so anders als Wien, war doch ein Hort des Fortschritts.16) Die extreme Linke träumte natürlich von einem zentralistischen Deutschland, in dem die Fürstentümer den Weg allen Fleisches gegangen waren. Diese wären ohne Zweifel ein großes Hindernis auf dem Wege zu einer engmaschigen deutschen Einheit gewesen und hatten doch dauernd mit Reichsfeinden paktiert (die Preußen ganz obenauf!), aber was wäre Deutschland (auch heute) ohne diese separatistischföderale Entwicklung gewesen und geworden, und dasselbe kann man auch von Italien sagen. Heute gibt es in Frankreich kaum ein Geistes- oder Kulturleben von Bedeutung außerhalb von Paris, in England außerhalb von London.17) Es versteht sich jedoch von selbst, daß die katholischen Länder des Deutschen Bundes ein Großdeutschland anstrebten, in dem das katholische Element das Übergewicht gehabt hätte. Doch gab es auch konservative Elemente im evangelischen Deutschland, die für Wien und gegen Berlin waren; die gab es selbst in Preußen.18)
Die Revolution in Böhmen wurde mit Leichtigkeit, die in Berlin unschwer, die in Wien schon schwerer, die in Italien mit Erfolg kriegerisch bekämpft, denn da gab es eine bewaffnete Intervention vom Königreich Sardinien.19) Die größte Gefahr für das österreichische Kaisertum kam jedoch von Ungarn. Hier rächte sich der imperiale Austriazismus am meisten. Obwohl auch diese Revolution einen gemäßigt linken Charakter hatte, war dort der hohe und niedere Adel in seiner überwiegenden Mehrheit auf der Seite der „Aufständischen“. Die Ursache dieser Revolution war staatsrechtlichen Charakters. Der Wiener Zentralismus, der auf die Aufklärung und den überaus fortschrittlichen Joseph II.20) zurückging, war stets bestrebt, die ungarische Autonomie zu beschneiden. Nun hatte Wien auf eine ultimative Aufforderung des ungarischen Reichstags hin beschlossen, dem Land eine weitgehende Selbstverwaltung zu geben. Der Kaiser und König Ferdinand hatte dazu Ja und Amen gesagt. Das aber wollten die im ungarischen Staatsverband lebenden Kroaten nicht und rebellierten unter der Führung ihres Banus Jellačić. Das gab dem Wiener Hof wieder den Mut, die Zusage rückgängig zu machen, was aber einem Wortbruch des Monarchen gleichkam. Um der strafferen, magyarischen Herrschaft zu entkommen – die lateinische Amtssprache war 1844 durch die magyarische ersetzt worden –, fingen Ungarns Nationalitäten an, sich mit Wien gegen Pest zu verbünden. Die Einheit Ungarns war nun durch Wien bedroht, es folgten eine Unabhängigkeitserklärung und ein Sezessionskrieg, mit denen die österreichische Armee, die zugleich in Böhmen, Wien und Italien beschäftigt war (auch in Galizien gab es Unruhen), nicht fertig werden konnte. Prinz Alfred zu Windisch-Grätz21) wurde nach etlichen Siegen und Niederlagen durch den Freiherrn von Weiden, dieser wiederum nach dem Verlust von Ofen (Buda) durch Haynau ersetzt, ein natürlicher Sohn des Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen. Haynau siegte im Westen Ungarns, die Russen fürchteten einen Parallelaufstand in Kongreßpolen und kamen deshalb Wien zu Hilfe, und ihnen ergab sich dann die ungarische Armee. Ungarn wurde dann fast 18 Jahre hindurch diktatorisch von Wien aus verwaltet – bis es 1867 zum „Ausgleich“ kam. Damals also wurde die „Österreich–Ungarische Monarchie“ geboren. Das einigende Band der beiden Länder wurden die Dynastie, die Armee, die gemeinsame Außenpolitik, die Zollunion, die Notenbank und (später) die gemeinsame Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina.
Gerade in der unwahrscheinlich dummen und zudem auch brutalen Behandlung Ungarns nach der Revolution von 1848–49 zeigte sich die große politische Schwäche der Monarchie, die eben in Wirklichkeit konzeptlos war. Nach dem Schweizer Sonderbundskrieg von 1847 und – viel später – nach dem Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten wurde keiner der besiegten Generäle gehenkt. Anders im Falle Ungarns: Es wurden nicht nur der Ministerpräsident Graf Ludwig Batthyány sondern auch dreizehn Heerführer in Arad hingerichtet, von denen die Mehrzahl keinen magyarischen Namen hatte. Zwei von ihnen waren armenischer Abkunft, zwei andere konnten kaum ungarisch sprechen.22) Das Trauma der Aradi vértanúk der „Arader Blutzeugen“, die als „Verräter“ zumeist am Galgen starben, brauchte hundert Jahre um überwunden zu werden.
Doch auch die ungarische Revolution war falsch angelegt gewesen, und zwar besonders durch die Abschaffung der Monarchie. Wir erwähnten schon die Ersetzung des Lateinischen durch das Ungarische als Amtssprache. Auf einmal wurden sich zahlreiche Ungarn bewußt, daß sie nicht Magyaren waren und nun eine äußerst schwierige nicht-indogermanische Staatssprache zu erlernen hatten, denn von den „Nationalitäten“ wurde erwartet, daß sie sich mehr oder weniger „magyarisierten“. Natürlich erweckte das heftige Reaktionen. Es führte schließlich zur Katastrophe des „Friedens“ von Trianon, der das tausendjährige Ungarn in Stücke riß.
Hinter dieser Tragödie des Jahres 1920 steckte auch eine semantische Falle. Auch im Tschechischen gibt es nur ein Wort für „böhmisch“ und „tschechisch“ – český. Im Magyarischen gibt es ebenfalls keinen Unterschied zwischen den Worten „ungarisch“ und „magyarisch“ – nur das Wort magyar. Ein deutschsprechender Ungar bezeichnete sich nicht als Magyare, sondern als Ungar oder „Ungarländer“. (Deutschrussen waren „Rußländer“, der schwedischsprechende Bürger Finnlands nennt sich Finnländer.) Nach der Katastrophe von Trianon dachten kluge Magyaren daran, ihr Land nach einer Wiedervereinigung (lateinisch) Hungaria zu nennen.23) In diesem Hungaria gäbe es dann ein Magyarország, Slovensko, Erdély-Ardealu-Siebenbürgen und so weiter. Eines aber ist in all diesen Spekulationen völlig sicher: Wie schon John Stuart Mill hervorgehoben hatte, ist der multinationale Staat auf einer demo-republikanischen Grundlage kaum denkbar.24) (Dagegen spricht nur das Beispiel der Schweiz, die uns nur zu oft als Irrlicht gedient hat, denn sie kann nicht kopiert werden.)25) Ist doch die parlamentarische Demokratie essentiell nie direkte oder indirekte Herrschaft des ganzen Volkes, sondern lediglich die Herrschaft einer Mehrheit über die Minderheit – mit dem Trost, daß die Minderheit von gestern die Mehrheit von morgen sein kann. Dieser Trost fehlt aber mehr oder weniger im multinationalen Staat, in dem die Parteien einen nationalen (ethnischen) Charakter angenommen haben. Hier tritt dann eine gewisse „Unverrückbarkeit“ ein, ein Phänomen, das allerdings auch dort auftritt, wo die Parteien Klassenparteien geworden sind. In einem ganz überwiegend bäuerlichen Land werden dann nur zu wahrscheinlich Bauernparteien permanent regieren usw. Da aber Ungarn unter Kossuth eine Republik geworden war, wäre ein im Kampf gegen Wien siegreiches Ungarn zeitlich noch viel früher am Nationalitätenproblem gescheitert… analog dem alten Österreich.
Gerade vor dem Ausbruch der Revolution im Jahre 1848 fand das denkwürdige Duell zwischen zwei Führern statt – zwischen Ludwig Kossuth und dem Grafen Stephan Széchenyi. Beide waren in der Opposition gegen den Wiener Zentralismus, aber mit sehr verschiedenen Vorzeichen und Methoden. Kossuth war ein kleiner evangelischer Advokat slowakischer Abstammung,26) Széchenyi hingegen ein Aristokrat mit Welterfahrung, der den Kampf Ungarns um Gleichberechtigung mit der besten und legitimsten Waffe ausfechten wollte: mit der Wirtschaft. Széchenyi war kulturell englisch orientiert. Sein frühes Hauptwerk war der Bau der Kettenbrücke, die Ofen (Buda) mit Pest verband, ein damals einzigartiges technisches und finanzielles Unternehmen, das auch ein adeliges Privileg durchbrach: Alle, auch Adelige, mußten zwei Kreuzer für die Benützung zahlen. Die Formel, daß der Adel dem Land mit seinem Blut, der Bürger aber mit dem Geld dient, war damit zusammengebrochen. Széchenyi wußte genau, daß ein wirtschaftlich starkes Ungarn von Wien nicht mehr restlos abhängig sein mußte. (Nach dem Verlust Venetiens und der Lombardei war Ungarn größer als Österreich, und Pest, nicht Wien, war der geographische Mittelpunkt der Gesamtmonarchie.) In diesem Zweikampf zwischen Kossuth und Széchenyi siegte natürlich der Demagoge, der auch der Mann war, der die Grundlage zu dem tödlichen Nationalitätenproblem geliefert hatte. Kossuth floh nach dem Zusammenbruch der Revolution mit der Königskrone,27) die er am Eisernen Tor, in der damaligen Türkei, vergrub, den alten Verbündeten der ungarischen „Nationalisten“ im Kampf gegen Habsburg. Diesen Kampf gegen Wien setzte dann Kossuth in seinem italienischen Exil fort. Széchenyi aber wurde geistig umnachtet: Das Unglück Ungarns, das er seherisch vorausgeahnt hatte, brachte ihn um seinen Verstand. Er starb in einer Irrenanstalt in Döbling. (Auch die Österreicher, besonders aber der Rheinländer Metternich, hatten ihn völlig verkannt.)