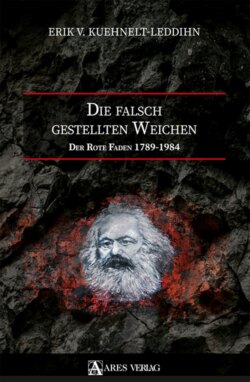Читать книгу Die falsch gestellten Weichen - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 18
12. DIE DONAUMONARCHIE
ОглавлениеWas aber war inzwischen in der Donaumonarchie geschehen? Wir sprachen schon über das österreichische Versäumnis nach 1866, mit dem deutschen Süden in ein engeres Verhältnis zu treten. Da hätte allerdings eine ganz neue Ordnung „ausgedacht“ werden müssen – das Verhältnis zweier Königreiche und eines Großherzogtums zu Wien, und dort mangelte es (wie immer) an Phantasie. Dieses Unterfangen wäre keineswegs von Anfang an hoffnungslos gewesen, und zwar schon deswegen, weil sich im Norden kein außerordentlicher Enthusiasmus für den Einschluß weiterer katholischer Bevölkerungsmassen gezeigt hatte. Auch Bismarck machte Bemerkungen in dieser Richtung. Übrigens gab es auch nach der Reichsgründung zahlreiche Preußen, die sich weigerten, die neue deutsche Flagge, also die preußische mit dem roten Ansatz der Revolution, zu hissen.1) Es wäre also, hätte Wien eine dynamische Politik betrieben, lediglich zum Norddeutschen Bund als Dauereinrichtung gekommen – und wenn überhaupt zu einem deutsch-französischen Krieg, dann wäre in einer Allianz Wien–Berlin mit der Annexion des Elsaß durch ein „Großösterreich“ und Lothringens durch den Norddeutschen Bund zu rechnen gewesen. Die Geschichte Europas (und auch der Welt) wäre eine andere geworden.
Wir schilderten schon die Natur des Ausgleichs von 1867 zwischen Österreich und Ungarn: Nach außen bildeten beide Reichshälften einen Staat, nach innen waren sie weitgehend getrennt. Es gab zwei Staatsbürgerschaften, und die Gesetzgebungen gingen mehr und mehr ihre eigenen Wege: in mancher Beziehung war Ungarn „linker“ als Österreich. Es führte die Zwangeszivilhe ein, gestattete die Scheidung und Wiederverheiratung katholischer Christen und erlaubte die Freimaurerei, die in „Cisleithanien“ (Österreich)2) verboten blieb. Österreich führte allerdings 1907 das direkte, allgemeine und geheime Wahlrecht ein, das in Ungarn erst vor dem Zweiten Weltkrieg zur Verfassung gehörte. (In dieser Beziehung eilte Österreich auch den Vereinigten Staaten voraus.) Die k. u. k. Armee3) war jedoch integrierter als die verschiedenen deutschen Armeen und hatte die deutsche Kommandosprache. (Es gab aber einen österreichischen „Landsturm“ und eine ungarische Honvéd.)
Zwischen beiden „Reichshälften“, der cisleithanischen und der transleithanischen, gab es jedoch auch noch andere tiefgehende Ungleichheiten. Österreich hatte eigentlich, wie die Vereinigten Staaten,4) keinen offiziellen „Namen“; es hieß „amtlich“ sehr bürokratisch und trocken: „Die im Reichrate vertretenen Königreiche und Länder“. (Hingegen gab es „österreichisch“ als Eigenschaftswort, das mit „k.k.“ ersetzt werden konnte, während „k.u.k.“ auf die Doppelmonarchie hinwies.) Österreich war der volkreichere Staat, dem Umfang nach aber der kleinere. Zudem lag das geographische Zentrum der Monarchie eher in Ofen-Pest als in Wien. (Budapest entstand erst 1872 durch die Zusammenlegung dieser beiden Städte.) Wien war vom architektonischen Standpunkt seiner östlichen Schwester überlegen (kein Wunder nach den Verwüstungen der Mongolen und der Türken, denen Europas herrlichste Bibliothek, die Corvina, zum Opfer gefallen war), Budapest hatte hingegen die unvergleichlich schönere Lage und war eine echte Donaustadt.5) Budapest hatte zudem als ungarisches Zentrum, ähnlich wie Paris in Frankreich, einen wirklichen Primat, Wien als österreichische und deutsche Stadt mußte mit Prag, München und Berlin nebst anderen deutschen Städten das Erbe kulturell teilen. Die deutsch-österreichische Provinz zählte damals geistig oder künstlerisch so gut wie nicht. Wien war zwanzigmal größer als Graz oder Linz, fünfzigmal größer als Salzburg oder Innsbruck. (Heute ist das Verhältnis nur mehr eins zu sechs oder eins zu zwölf.) Doch hatte Wien das gemeinsame Kriegsministerium, ein gemeinsames k.u.k. Finanzministerium und vor allem das Außenministerium, daher hatte Budapest keine „diplomatische Welt“; die Konsularwelt, damals scharf getrennt, zählte gesellschaftlich nicht.6) Der Kaiser-König residierte nur vorübergehend in der Burg von Ofen. Es gab natürlich Einrichtungen, die „k.k.“, „k.u.k.“ oder bloß „königlich“ waren. Ungarn hat nämlich, was dem Ausländer (einschließlich dem Österreicher) stets verborgen blieb, eine sehr alte politische Geschichte aristokratisch-republikanischen Charakters, zwar nicht so wie Venedig, aber doch ähnlich der Englands. Die Magna Carta, ein aristokratisches Dokument,7) kommt aus dem Jahre 1215, die „Goldene Bulle“ (Arany Bulla) des Königs Andreas II. ist nur um sieben Jahre jünger. Sie gab dem Adel das Insurrektionsrecht, d. h. das Recht, gegen ihren eigenen König zu revoltieren, ohne der Treulosigkeit bezichtigt zu werden.8) Die Magnatentafel Ungarns nach 1867 hatte auch einen bedeutend aristokratischeren Charakter als das Herrenhaus in Wien. (Anders stand es mit dem Oberhaus nach 1919.)9) Darüber hinaus hatte Ungarn, ähnlich wie Polen, mit dem es so zahlreiche Analogien besitzt, einen äußerst zahlreichen, sehr alten und oft auch sehr armen Kleinadel,10) der die Gewohnheit hatte zu demonstrieren. Ungarn und Polen waren stets „revolutionäre“ Länder.
Transleithanien war „politisch älter“, geographisch – der Karpathenzirkus! – viel abgeschlossener als Österreich, das man vom Bodensee bis zur Ukraine, von der sächsischen Grenze bis Cattaro leicht als geschichtlich-geographischen „Flekkerlteppich“ bezeichnen könnte. 55 Prozent der Ungarn waren Magyaren, aber nur ein Drittel der Bevölkerung Österreichs war deutsch, und das numerische Verhältnis verschob sich immer mehr zugunsten der Slawen, während in Ungarn bis 1918 die Magyarisierung dauernd Erfolge erzielte. Das Magyarentum übte zwar einen Druck auf die Nationalitäten aus, erwies sich aber als äußerst magnetisch. Auch das Judentum magyarisierte sich rasch. Doch am Nationalitätenproblem litten beide, Ungarn und Österreich, wenn auch in sehr verschiedener Weise. Abgesehen davon gab es ein spezifisch ungarisch-kroatisches Problem. Im Pester Parlament hatten die kroatischen Abgeordneten das Recht, kroatisch zu sprechen.11)
Es gab einige „Nationalitäten“ (ungarisch: nemzetiségek die fast restlos innerhalb der Donaumonarchie lebten: die Tschechen, Slowaken, Magyaren,12) Slowenen, Ladiner, Kroaten, „Türken“ (d. h. die islamisierten Kroaten Bosniens). Doch gab es Österreicher, die nach Kleindeutschland hinüberschielten; Italiener, die Irredentisten waren; Ukrainer, die sich als Russen fühlten; Rumänen, deren Loyalität der Regierung in Bukarest galt; Serben, die vom Anschluß an Serbien oder einem serbisch geführten „Südslawien“ träumten, während die Polen nur solange Wien treu bleiben wollten, als es kein Polen gab. Also war die Donaumonarchie vom national-nationalistischen Standpunkt aus entweder zu groß oder auch zu klein. Es hätte zumindestens Polen, ganz Rumänien, Serbien und Montenegro, Friaul und vielleicht gar die Ukraine einschließen müssen. Zweifellos war die erste große Katastrophe in der neueren österreichischen Geschichte der Frieden von Belgrad (1739), als der Kaiser das nördlichste Bosnien, Nordserbien und die kleine Walachei an die Türkei zurückgeben mußte.13) (Der unglücklich verlaufene Krieg, den später Joseph II. an der Seite Rußlands gegen die Türken führte, bestätigte wiederum nur die Donau-Save-Grenze.) Wäre aber der erstgenannte Krieg, den die Türken mit französischer Hilfe gegen die Kaiserlichen führten, gewonnen worden, hätte dann das Römische Reich unter den Habsburgern als der Befreier des christlichen Balkans auftreten können. Bei der nächsten „Gelegenheit“ wären die österreichischen Erblande zur Donaumündung und in der Richtung von Albanien und Makedonien vorgestoßen…
Wie dem auch immer sei: Noch im Jahre 1914 lebte die Mehrheit der Serben innerhalb der Doppelmonarchie – in Ungarn und Kroatien, Bosnien, der Hercegovina und Dalmatien – und nur eine Minderheit im Königreich Serbien. Die meisten Serben waren der Monarchie treu ergeben; der Kaiser hatte den Titel eines Großwojwoden der Wojwodschaft Serbien; einer der besten Generäle der alten Monarchie General Svetozar Boroevic von Bojna, der die elf Isonzoschlachten gegen die Italiener gewann,14) war ein orthodoxer Serbe. Die Kroaten hingegen lebten sowohl im eigentlichen Ungarn wie auch in Kroatien, im (österreichischen) Dalmatien, im (österreichischen) Istrien wie auch in Bosnien, mit noch höherem Prozentsatz allerdings in der Hercegovina.15) Sie waren sowohl um eine nationale Einigung bemüht wie auch um eine größere Autonomie von Budapest, doch war Ungarn (im Gegensatz zum rechtsdralligeren Österreich) sehr zentralistisch eingestellt. Auch versuchten nationalmagyarische Kreise ihre Sprache in Kroatien durchzudrücken, was bei diesem historischen Volk auf großen Widerstand stieß und sogar zeitweilig „illyrische“, d. h. allsüdslawische Gefühle auslöste. Die Slowaken und Rumänen Ungarns (zum Unterschied von den Siebenbürger Sachsen) hatten nur eine sehr dünne Intelligenzschichte und keinen Adel. Soweit er existiert hatte, strebte er der Magyarisierung zu.
Die Doppelmonarchie hatte schwere Probleme. Sie war in das Zeitalter der Nationaldemokratie geraten, und so nagten an ihr nationalistische wie auch politisch-ideologische Kräfte. Der Umstand, daß die Donaumonarchie nur nach historischen und „vertikalen“, nicht aber nach „horizontalen“ und demokratisch-parlamentarischen Gesichtspunkten regiert oder reformiert werden konnte, leuchtete nur wenigen ein. In Ungarn war wenigstens das Wahlrecht derartig frisiert, daß man im Parlament stets mit einer magyarischen Mehrheit irgendwie regieren konnte; doch auch da gab es Pannen! In Österreich war eine deutsche Mehrheit nie zu erwarten: Die Koalitionen, die von Nationalparteien verschiedenster Couleur gebildet wurden, fielen immer wieder auseinander. Im multinationalen Staat, in dem (ungleich der Schweiz) die unmittelbare Loyalität stärker war als die „Zentralloyalität“, ist die Demokratie oder auch die parlamentarisch-konstitutionelle Monarchie ein Nonsens.
Hätte also die Monarchie neu organisiert werden müssen? Im Prinzip sicherlich, doch wäre die praktische Ausführung dieser eigentlich sehr notwendigen Reform äußerst riskant und nur durch einen Gewaltakt möglich gewesen – keinesfalls aber auf konstitutionellem oder auch auf plebiszitärem Weg. Der Mann, der dies tun wollte, war der Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, ein Mann von großer Intelligenz, Energie und Charakter, der sich in vielem radikal von seinem Onkel, dem Kaiser Franz Joseph, und noch mehr von seinem unglückseligen Vetter, dem Kronprinzen Rudolf unterschied. (Beide, Kaiser und Kronprinz, waren „Liberale“, wenn auch von verschiedener Schattierung.) Vielleicht, so müssen wir uns sagen, wäre es besser gewesen, wenn der greise Kaiser im Jahre 1900 oder 1908 nach seinem diamantenen Regierungsjubiläum gestorben und sein Neffe ihm nachgefolgt wäre. Dieser hatte den Plan gefaßt, nach den Trauerfeierlichkeiten, die dem Tod des Kaisers gefolgt wären, eine kurzlebige Militärdiktatur auszurufen – und dies noch vor einer Krönung in Ofen,16) denn bei dieser Gelegenheit hätte er einen Eid auf die ungarische Verfassung geben müssen. Der Plan Franz Ferdinands war es, die Donaumonarchie in einen Föderalstaat mit habsburgischer Spitze umzugestalten, doch ist es bis heute noch nicht klar geworden, wie das im Detail geschehen wäre. Wahrscheinlich hatte diese Neuordnung eher nach historischen denn nach ethnischen Prinzipien erfolgen müssen, denn die Sprachgrenzen in Mittel- und Osteuropa sind so verzahnt, daß sie auch innenpolitisch unbrauchbar gewesen wären. Dieser Raum ist national überhaupt nicht zu ordnen, denn nicht nur gibt es dort sprachliche Inseln und Halbinseln, sondern oft sind auch die Sozialschichten ethnisch bestimmt. So gab es zum Beispiel in Ostgalizien nur ein ganz ephemeres ukrainisches Bürgertum, Großbürgertum und Adel und in Triest nur ein slowenisches Proletariat und Kleinbürgertum. Oft gehörten die Städte der einen und die umliegenden Dörfer einer anderen Nationalität an. Auch veränderten sich die Vérhältnisse dauernd. Am Anfang des 19. Jahrhunderts waren Prag und erst recht Brünn vorwiegend deutsche Städte, die erst mit der Zeit tschechisiert wurden.
Ungarn beziehungsweise die Länder der Heiligen Stephanskrone hätten in einer solchen Reorganisation der Doppelmonarchie ein besonders schwieriges Problem gebildet. Die Beziehungen zwischen Franz Ferdinand und Ungarn waren sehr delikater Natur, doch wäre es eine grobe Vereinfachung zu behaupten, daß sie ganz einfach schlecht waren. Der Thronfolger war ein tief gläubiger katholischer Christ, dem die magyarischen Nationalisten (die „Achtundvierziger“), die jüdisch-progressistische Presse, die antikirchlichen Liberalen und die reformierten Kreise, die habsburgfeindlich eingestellt waren, im Herzen zuwider gewesen sind. Doch sprach der Thronfolger ungarisch (eine Sprache, die ihm sein Lehrer, der Bischof Lányi von Großwardein, beigebracht hatte) und er hatte in seinem Kreis im „Belvedere“ in Wien, wo er amtierte, auch eine Anzahl von Ungarn um sich. Einer dieser war der ungarische Innenminister Josef Kristóffy, der ihm in einem Buch ein wahres Denkmal gesetzt17) und von der Anklage der Ungarnfeindlichkeit freigesprochen hatte. Unklar ist es allerdings, ob der Thronfolger das Verhältnis zwischen Ungarn und Kroatien gelokkert hätte, um dann aus Kroatien, Dalmatien und Bosnien einen Teilstaat der Monarchie zu machen – was die serbischen Nationalisten natürlich fürchteten und schließlich auch zu seiner Ermordung führte. Zweifellos hätte sich Franz Ferdinand in Prag zum König von Böhmen krönen lassen. (Die Familie seiner Frau, die Grafen Chotek, waren Tschechen.) Sicherlich war es von Seiten Franz Josephs ein schweres Versäumnis gewesen, sich nicht in Prag, auch einer alten Kaiserstadt, krönen zu lassen. Dagegen agierten vor allem die Deutschnationalen in ihrer großen Kurzsichtigkeit.