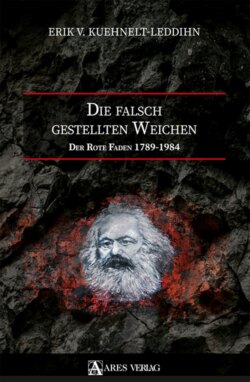Читать книгу Die falsch gestellten Weichen - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 9
3. VOM ERSTEN ZUM DRITTEN NAPOLEON
ОглавлениеDie Französische Revolution endete mit der Militärdiktatur und der fast gelungenen Royalisierung Napoleons. Die Ideen der Französischen Revolution wurden, wenn auch in einer stark gemilderten Form, durch ganz Europa getragen. Der Blutfleck der Revolution tauchte den Kontinent von Gibraltar bis ins Herz Rußlands in ein allumfassendes Blutbad. Dieses Drama endete erst in Waterloo.
Die Wandlung der Französischen Revolution in eine Personaldiktatur, die gewisse tyrannische Züge trug, doch ohne eine Tyrannis im hochmodernen Sinne zu sein, folgte einem bis in die Antike zurückreichenden Schema. Plato hatte dieses vorausgesehen und so auch Polybios, der von einer Anakýklosis, einem Drehen des geschichtlichen Rades sprach. Beide dachten, daß das Königtum von einer Adelsherrschaft abgelöst werden müsse (wie England 1688) und daß diese wiederum einer Demokratie weiche, in der schließlich ein Volkstribun aufstünde, der aber seine Herrschaft – mit der Zeit – „familistisch“ gestalten und damit royalisieren würde. Manchmal fällt allerdings ein Stadium aus. Auch die römische Geschichte liegt ungefähr auf dieser Linie. Cäsar war durch seine Heirat ein Neffe des ‚Demokraten‘ Marius, doch hatte zweifellos das Régime der „Cäsaren“, das Prinzipat, durch die Macht der Armee einen ‚bonapartistischen‘ Charakter. Das vorchristliche Rom ist nicht eine echte Monarchie geworden, mit der Herrschaft von Diokletian ebenfalls nicht, obwohl er sich eine Krone aufsetzte und Proskynesis verlangte.1) Auch gelang Napoleon die „Verköniglichung“ nicht, denn er blieb viel zu sehr ein Volkstribun, um seinem Siegeszug ein Ende zu setzen und sowohl sein Land wie auch seine Herrschaft echt zu konsolidieren. Er war allerdings der Schwiegersohn des österreichischen Kaisers geworden. Hätte er sich nicht in das russische Abenteuer gestürzt, wäre er wahrscheinlich 1821 in Paris im Bett gestorben. Europa wäre mehr oder weniger unter dem Adler seiner Feldstandarten geeint gewesen. (Wie wird es in Indien weitergehen?, fragt man sich. Wird die Tochter Nehrus ihren jüngeren Sohn „einsetzen“ können?)
Das enracinement, die „Einwurzelung“ der neuen Monarchie in Frankreich hätte allerdings eine Friedenszeit gebraucht. Doch muß man hinzusetzen, daß Napoleon sich seiner auch im „Inneren“ gefährdeten Lage sehr wohl bewußt war und seinem Schwiegervater gestand, daß er militärische Niederlagen politisch nicht überstehen könnte. (Das hätte allerdings auch Mussolini wissen müssen, der ein – später verfilmtes – Theaterstück über Napoleons Hundert Tage geschrieben hatte.)
Doch weder die Französische Revolution noch die napoleonische Periode waren im übrigen Europa spurlos vorbeigegangen. Im Gegenteil: diese beiden Ereignisse blieben unvergessen, lösten allerlei Reaktionen, aber auch weitere „unterirdische“ Bewegungen aus. „Obenauf“ hatten wir die Romantik, eine christliche Erneuerung, und das erste Mal in der Geschichte ein systemisiertes konservatives Denken.2) Doch waren eben Dinge geschehen, die viele alte, festgefahrene Begriffe und Traditionen gebrochen hatten. Dabei war der Königsmord nichts Neues. Karl I. von England hatte schon dieses Schicksal erfahren und sein Sterben leitete die Britische Republik ein, das Commonwealth unter Cromwell, einem echten „Führer“ und hervorragenden Praktikanten des Genozids.3) Auch ein Papst als Gefangener Frankreichs war keine Neuheit. Fontainebleau war lediglich ein neues Avignon. Doch die Heirat der Tochter des regierenden Habsburgers mit einem korsischen Abenteurer, der, wenn er schlecht aufgelegt war, im Patois seiner Heimat fluchte, oder auch die Besteigung des schwedischen Königsthrones durch einen anderen Advokatensohn, diesmal aus Pau und nicht aus Ajaccio, waren ebenso Brüche mit der Vergangenheit wie die zahlreichen territorialen Veränderungen während der napoleonischen Kriege, wie auch in der Folge des Wiener Kongresses, der keineswegs ganz so „konservativ“ war, wie manche ihn darstellen wollten.
Die gesellschaftlichen Veränderungen waren nicht so schwerwiegend, und alte Traditionen und Haltungen, die man für verloren glaubte, lebten wieder auf – selbst in Frankreich. Napoleon hatte versucht, den Anschluß an das Alte zu finden und stets mit allen Mitteln danach getrachtet, Überläufer aus dem alten Adel zu bekommen. Gewisse Begriffe – Ehrbegriffe, äußere Modalitäten, Gebräuche – kamen wieder auf. Die „Modernität“ regierte noch lange nicht absolut. Man lese da einmal in den Memoiren des Grafen Caulaincourt nach, wie sich nahe bei Moshajsk auf dem Zuge nach Moskau ein „Zivilist“ dem französischen Lager näherte und einen Soldaten auf Wache nach seinen Eindrücken ausfragte. Von einem Offizier zur Rede gestellt, den der Unbekannte arrogant behandelte, dann als russischer Offizier (Uniform unter dem grauen Mantel!) erkannt und verhaftet, überstellte man ihn schließlich Napoleon. Es war dies ein Baron Wintzingerode, den Napoleon als theoretischen Untertan seines Bruders Jérôme, König von Westphalen, agnoszierte und deshalb als Verräter und Spion zu erschießen drohte. Er brüllte Wintzingerode an und wollte sich auf ihn stürzen, als dieser dem Kaiser kalt und unbewegt erklärte: „Sie werden nichts davon tun, Sire! Ich diene jetzt dem Kaiser Alexander!“ Die französischen Offiziere, entsetzt über die schlechten Manieren ihres Souveräns, rissen Napoleon zurück.4) Zwar wurde Wintzingerode ein Gefangener, dinierte aber mit den Offizieren, Napoleon hingegen trotzte allein in seinem Zelt. Die Fiktion, daß ein Krieg unter Gentlemen geführt wurde, war noch aufrechterhalten worden. Im Ersten Weltkrieg war dies nur noch an der Ostfront der Fall. Im Zweiten Weltkrieg war es damit völlig aus.
Schwerwiegender waren die Gebietsveränderungen. Der Reichsdeputationshauptschluß wurde beim Wiener Kongreß nicht zurückgenommen, zahlreiche kleine und kleinste deutsche Fürstentümer, Reichsstädte und alle Bistümer waren für immer von der Landkarte verschwunden. Die früheren österreichischen Niederlande wurden mit den Generalstaaten zu einem „Königreich der Niederlande“ zusammengelegt, was einen größeren Staat mit einer starken katholischen Mehrheit unter einer reformierten Dynastie ergab.5) Zwar hatten die Flamen und die „Holländer“ eine gemeinsame Literatursprache, doch besaßen diese beiden Völker seit 300 Jahren keine innere Bindung mehr. Sowohl die flämische Oberschichte wie auch die Wallonen sprachen französisch, und so erwies sich diese künstliche Amalgamierung bald als Mißgriff. Den Völkern konnten nicht mehr willkürliche Loyalitäten zugemutet werden. Man wollte Sachsen nicht den Preußen überlassen, dafür aber wurde Preußen mit dem Rheinland entlohnt, was dort auch keine übermäßige Begeisterung hervorrief und zugleich Preußen die Aufgabe zuschob, ein Bollwerk gegen die stetige französische Expansion zu werden. (Auch sollte Rußland etwas bekommen und dafür mußten beide, Preußen und Österreich, herhalten – das Resultat war wie 1945 ein russischer Westruck!) Da man aber Frankreich unter keinen Umständen demütigen wollte, ließ man das damals kaum französisierte Elsaß6) bei Frankreich und beanspruchte auch Lothringen nicht, das kurz vor der Revolution französisch geworden war. (Die lothringischen Grafen waren noch bis 1789 im Mainzer Grafenkollegium vertreten.) Auch hier, beim Kongreß, begegnete man wieder einem „Wunder“: Der Vertreter des besiegten Landes, der Ex-Bischof von Autun, Prinz Talleyrand de Perigord, (napoleonischer) Fürst von Benevent, (neapolitanischer) Herzog von Dino, suspendiert, exkommuniziert, zivil vermählt mit der Madame Grand, spielte dank seiner Intelligenz, seines Wissens und Humors auf dem Wiener Kongreß eine führende Rolle.7) Frankreich war am Ende all seiner Aggressionskriege größer als vor der Revolution. Immerhin, ein weiterer Weltkrieg wurde für hundert Jahre auf der Grundlage des Wiener Kongresses vermieden.
Freilich darf man die Irrtümer, die damals begangen wurden, auch nicht übersehen. Nicht nur die Einwohner von Köln, Mainz, Trier und Münster, die alle unter dem Krummstab gelebt hatten, waren auf einmal „Preußen“ und trugen damit den Namen eines nichtdeutschen, baltischen Volksstamms. Auch die Freiburger, echte Vorderösterreicher, wurden „Badener“ und die Venezianer, stolze Kinder der Res Publica Christianissima, Königin der Meere, waren nun wiederum Österreicher. Vor allem hart war das Schicksal der Polen, die geteilt blieben und überdies ihr Herzland nun für ein Jahrhundert unter russischer Herrschaft sahen. Der berühmte Père Gratry hatte sehr richtig gesagt, daß Europa seit den Teilungen Polens in der Todsünde lebe,8) und dieses Übel wurde noch dadurch ärger gemacht, daß man die preußische und österreichische Beute aus der dritten Teilung den Russen gab, die nunmehr 295 Kilometer von Wien und 305 Kilometer von Berlin ihre Grenzposten stehen hatten. (Vor den drei Teilungen lag die Grenze Polens 450 Kilometer westlich von Moskau!)
Eine herzlich schlechte Lösung war auch die Errichtung des Deutschen Bundes anstelle des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.9) Er war viel zu lose, um gegen fremde Eroberungspläne eine geeinte Front darzustellen. Auch waren nunmehr, da man die alten Reichsgrenzen berücksichtigen wollte, ein Teil des Königreiches Preußen (Ostpreußen, Westpreußen und Posen) und ein Großteil der Donaumonarchie (Galizien, die Bukowina, Ungarn mit Kroatien, Dalmatien, Venetien und die Lombardei) außerhalb des Bundes. Der König von Dänemark (als Herrscher von Holstein) gehörte genau so dem Bund an wie der König der Niederlande (als Souverän des nördlichen Limburg). Selbstverständlich waren auch Luxemburg und Liechtenstein in der evangelischen Paulskirche vertreten, die in Frankfurt am Main nicht unweit von der katholischen Kathedrale stand, in der früher die geheiligten (sacrae nicht sanctae) römisch-deutschen Kaiser gewählt wurden. Diese „Lösung“ war nicht rein national, denn es befanden sich innerhalb der Grenzen des Bundes Nichtdeutsche (Wenden, Tschechen, Mährer, Slowenen, Italiener), dafür aber auch Deutsche außerhalb des Bundes – in Schleswig, in Ost- und Westpreußen, in Posen, in Ungarn, im Elsaß und in Lothringen. Auch war der Bund leider so konstruiert, daß er den deutsch-preußischen Krieg des Jahres 1866 nicht verhindern konnte und natürlich ebensowenig die preußisch-italienische Allianz. Auch kam kein anderer deutscher Staat Österreich zur Hilfe, als es von Napoleon III. angegriffen wurde.
Keineswegs gelöst waren die Verhältnisse auf dem Balkan, wo die Griechen und die Serben sich besonders heftig gegen die türkische Herrschaft wehrten. Die Einverleibung des Königreichs Polen (Kongreßpolens) in Rußland, wie auch die russische Herrschaft über Finnland bargen genau so einen Sprengstoff in sich, wie die Personalunion zwischen Schweden und Norwegen. (Die norwegische Krone, die unter der jahrhundertelangen dänischen Herrschaft nichtexistent gewesen war, wurde nunmehr mit der schwedischen vereint.) Auch hier war es der russische Expansionsdrang, der Unheil gebracht hatte, denn Schweden erhielt die norwegische Krone als Entschädigung für Finnland. Und England hatte seine Position im Mittelmeer wieder ausgebaut: es behielt Malta (und gab es dem Orden nicht zurück), dazu kamen dann noch die Ionischen Inseln. Es dachte nicht daran, Gibraltar aufzugeben, und bekam im 19. Jahrhundert noch zusätzlich Zypern und Ägypten.
Die Französische Revolution schien liquidiert, doch der Schein trog. Der Jubelschrei des amerikanischen Staatsmannes, Gouverneur Morris: „Die Bourbonen sind wieder auf ihrem Thron: Europa ist frei!“,10) war nicht nur verfrüht, sondern auch auf lange Sicht gegenstandslos. Die Französische Revolution spielt in unserem Denken, Fühlen und in unseren Überzeugungen eine verhängnisvolle Rolle. Die niedrigen Leidenschaften, die damals entfacht wurden, glimmen weiter. Die beiden Niederlagen – die der Revolution und die ihres Produkts, Napoleons, – können mit einer Krebsoperation verglichen werden, die den Hauptherd entfernt, aber die schon in der Entwicklung befindlichen Metastasen außeracht läßt. Was dann nachfolgt, ist eine Zeit der Scheingesundheit, bis der Krebs sich wieder unheilvoll bemerkbar macht.