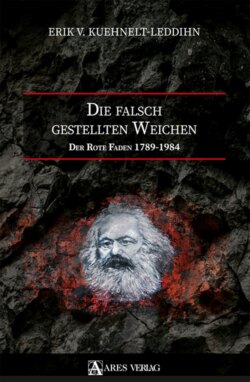Читать книгу Die falsch gestellten Weichen - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 25
19. DER „FORTSCHRITTLICHE“ NORDEN
ОглавлениеDer Norden Europas, dem phänotypisch auch die Niederlande, wenn nicht gar Belgien zuzuzählen sind, ging indessen durch eine Periode relativen Wohlstands und einer gewissen Blüte. Zwar waren die skandinavischen Länder nicht annähernd so reich wie nach dem Ersten oder gar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Niederlande zehrten einigermaßen von ihrem Kolonialreich, wenn auch keineswegs in dem Ausmaß, wie es der Laie annimmt. Und wer die Ziffern über den belgischen Kongo kennt – die Einnahmen, die Ausgaben, die Investitionen, die Dividenden – wird sehen, daß dieser afrikanische Besitz für Belgien viel eher eine Belastung als eine Quelle von Profiten war. Doch über den „Kolonialismus“ wollen wir noch später reden.
Während Dänemark in den Jahren 1814 bis 1940 durch zwei Kriege um Schleswig–Holstein erschüttert wurde, hatte Norwegen nur eine kleine Revolte (gegen das Haus Bernadotte und die Personalunion mit Schweden), und Schweden selbst keinen einzigen Krieg bis auf den heutigen Tag. Doch wenn auch das rein geistige Leben im hohen Norden keine sonderlichen Blüten trieb und weder überragende Philosophen noch Theologen hervorbrachte, so hatten doch die Dänen den höchst genialen Søren Kierkegaard, der in seinem eigenen Land kaum einen Widerhall fand und tatsächlich nur im Ausland, vorwiegend von katholischen Interpreten, gründlich studiert wurde.1) Skandinavien produzierte einen großen Komponisten, Grieg, und das benachbarte Finnland einen anderen – Sibelius. Norwegen dazu einen großen Maler: Munch. Anders aber war es um die Literatur bestellt, denn da haben wir eine ganze Reihe von Männern und Frauen, die sich im goldenen Buch der Dichtung verewigt haben: Bjørnson, Ibsen, Lie, Hamsun, Strindberg, Lagerlöf, Jacobsen, Jørgensen, Undset, Stolpe, Stenius.2) Im Vergleich zur Literatur in der italienischen Sprache (man bedenke, daß Norwegen, Dänemark und Schweden zusammen nur an die 16 Millionen Einwohner zählen) war das eine beachtenswerte Leistung. Umsomehr gab man sich aber dem materiellen Fortschritt hin: Die Demokratie, der Liberalismus und moderne Sozialideen florierten im hohen Norden wie auch in den Niederlanden. Dort hatte der Komfort im Rahmen einer hochbürgerlichen Kultur (mit sehr starkem Konfessions-und Klassenempfinden) eine wahre Spitze erreicht. In Belgien zeigten sich allerdings schon beträchtliche Spannungen zwischen dem französischen und dem flämischen Element.
Als sich Belgien 1830 von den Niederlanden losriß, war ein „Diktat“ des Wiener Kongresses zerbrochen. Seit der Reformation und der Teilung der Niederlande in eine überwiegend kalvinische Republik und in spanische, später österreichische Niederlande hatten sich der Norden und der Süden auseinandergelebt. Bei den „Generalstaaten“ blieben aber noch sehr viele Katholiken, die gewohnt waren als Niedervolk unter kalvinischer Herrschaft, als Bürger dritter Klasse, im Schatten zu leben.3) Das konnte nach 1815 den Flamen und Wallonen nicht zugemutet werden, die schon vor der französischen Invasion gegen die kirchenreformatorischen Verfügungen Josephs II. heftig reagiert hatten. Was nun die Flamen und Wallonen im Aufstand von 1830 einte, war natürlicherweise der katholische Glauben – und selbstverständlich gab ihnen auch der Umstand, daß sie im „Vereinten Königreich“ damals als Katholiken die große Mehrheit bildeten – an die 70 Prozent der Bevölkerung – zusätzlichen Mut. Zudem war im 19. Jahrhundert „Belgien“ volkreicher als der ‚Norden‘.
Doch sprach auch die Oberschichte der Flamen französisch viel eher denn niederländisch. Es muß aber auch im gleichen Atem zugegeben werden, daß das Französische im Norden sehr verbreitet war und noch vor hundert Jahren die Gesellschaft in Limburg und Nord-Brabant häufig unter sich französisch konversierte.4) Nun aber entstand in dem neuen Staat, der auf dem Boden der alten habsburgischen Niederlande stand und „Belgien“ (nach einem alten keltischen Volksstamm) genannt wurde und über den ein zum katholischen Glauben übergetretener König regierte, allmählich eine Spannung zwischen den beiden Volksgruppen – eine Spannung, die sowohl einen nationalen wie auch einen soziologischen Hintergrund hatte. Die Flamen wollten zunehmend, ihre Sprache nicht als „Niedersprache“, sondern dem Französischen ebenbürtig behandelt sehen. In der flämischen Gesellschaft wurde diese Forderung anfänglich nicht ernst genommen: Erst allmählich änderte sich auch in den Oberschichten diese Haltung.5) Die Emanzipationsbewegung der Flamen hatte zum Teil aber auch einen religiösen Charakter. Am Papier waren die Flamen genau so katholische Christen wie die Wallonen, aber letztere (nicht zuletzt dank des Einflusses des benachbarten Frankreichs) standen im Schnitt weiter links als die Flamen, waren viel öfter liberal oder gar sozialistisch. Auch der Einfluß der Freimaurerei war bei ihnen größer. So kam es auch dazu, daß fast alle Betriebe in Belgien (und nicht auch zuletzt im belgischen Kongo) entweder „katholisch“ waren oder den frères, den „Brüdern“, gehörten. Freilich war diese Zweiteilung der sprachlichen nicht analog: So war zwar die Universität von Brüssel eine Institution der Freimaurer, während die Löwens rein katholisch war – aber doch sehr lange ausgesprochen französisch, dann „gemischt“ und schließlich sprachlich radikal geteilt. Da die flämische Geburtenziffer (als die „katholischere“) auch größer als die französische war, kamen die Flamen langsam aus ihrem „Minderheitsstadium“ und deshalb auch aus ihren Minderwertigkeitsgefühlen heraus und konnten es sich somit gestatten, recht aggressiv zu werden. Nur war dies ein sehr langsamer Prozeß, der bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs keineswegs abgeschlossen war. Oft sahen schon damals viele Flamen eher in den Deutschen Eroberern als in den Wallonen ihre Brüder. Die Loyalitäten zerrissen oft die Familien.6) Das Zeitalter der Ziffern, der Wahlen, der Volksvertretungen und des Nationalismus hatte überall seine fatale Wirkung.
In den Niederlanden sah man etwas nicht ganz Unähnliches. Die große Mehrheit bekannte sich als Niederländer (manche von ihnen auch als Holländer)7), doch gab es stets eine sehr kleine Minderheit, die sich Dietsche, also „Deutsche“ nannte, denn vor dem Ausscheiden der Generalstaaten aus dem Heiligen Römischen Reich waren die Niederländer unzweifelhaft ‚Deutsche‘. Darum heißen auch die Niederländer auf Englisch Dutch, und im amerikanischen Slang werden auch heute noch die Deutschen als the Dutch bezeichnet.8) Ein Erasmus von Rotterdam oder ein Papst Hadrian VI. aus Utrecht wurden überall als Deutsche betrachtet. Diese Ursprünge und Gefühle wurden von der deutschen Besatzung in den beiden Weltkriegen weidlich ausgenützt, doch wer mit ihr kollaborierte, hatte oft bitter zu büßen. Tatsächlich bekamen aber durch die deutschen Okkupanten die Flamen (in Ghent) ihre erste Universität, die ihnen nach dem Ersten Weltkrieg zunächst wieder einmal weggenommen wurde.
Zwar waren katholische Parteien in beiden „Niederlanden“ gut organisiert und sehr aktiv, späterhin sogar an einer Mehrzahl von Regierungskoalitionen beteiligt, aber ein eher engherziger Liberalismus beherrschte lange die Szene. Im „Königreich der Niederlande“ gab es sogar zwei kalvinische Parteien.9) Die konfessionellen wie auch die konfessionell-säkularen Gegensätze waren hier viel schärfer als im Deutschen Reich, nicht zuletzt weil auch die ‚niederdeutschen‘ Katholiken besonders kämpferisch sind, und ihre Gegner entweder in einem sektiererischen Liberalismus oder im Kalvinismus (also nicht im Luthertum) zu suchen waren. Die Niederlande sind bis auf den heutigen Tag voll verbissener Gegensätze und dies, obwohl gerade in dieser Region die katholische Kirche in eine (wohl zu erwartende) Krise geriet, und eine enge Zusammenarbeit aller christlicher Konfessionen auf politischem Gebiet jetzt eher die Regel denn die Ausnahme ist.
Außenpolitisch versuchten die beiden Länder, sich aus den großen Spannungen, wenn auch vergeblich, herauszuhalten. Die belgischen Neutralitätskompakte (1831 und 1839), von den Großmächten – Rußland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Preußen – unterschrieben, schützten Belgien nicht vor einer Invasion. (Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Belgien seine Neutralität aus eigenem Antrieb aufgegeben.) Die inneren Wunden, die der Erste Weltkrieg in Belgien schlug, waren in der Zwischenkriegszeit kaum verharscht, als der Zweite Weltkrieg sie wieder aufriß.
Kulturell war die Leistung der beiden Niederlande im 19. und 20. Jahrhundert nicht überragend. Literarisch waren die Flamen vielleicht aktiver als ihre nördlichen Nachbarn. In der Malerei brachte zwar Belgien Ensor hervor,10) die nördlichen Niederländer aber van Gogh. Der französischen Malerei, der russischen oder nordischen Literatur hatten diese Länder, einst wahrhaft führend, nun nichts mehr gleichzusetzen. Dieser Vulkan scheint – zumindestens zeitweilig – ausgebrannt zu sein. (Ähnliches läßt sich schließlich auch von Italien sagen.) Nur einige wenige Namen kommen da einem in Erinnerung: Multatuli, Timmermans, Huizinga, Guido und Caesar Gezelle, wobei wir allerdings hier keine französisch schreibenden Flamen noch Wallonen erwähnt haben.