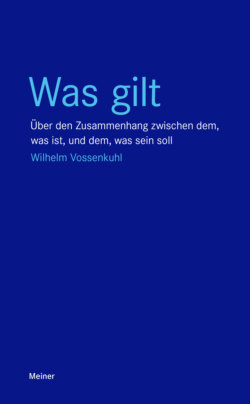Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Ob es das Gute gibt
ОглавлениеDieses magere Ergebnis, dass das, was gelten kann, nicht schlecht ist, entspricht dem, was wir Menschen aus unserer Geschichte lernen. Unser Wissen über das, was gut für uns – und die Natur – ist, hat sich immer wieder als unzuverlässig und zwiespältig erwiesen. Wir haben gelernt, mit dem zu leben, von dem wir glauben, dass es wenigstens nicht schlecht ist und nicht schadet. Damit können wir dem ontologischen Bedürfnis nach dauerhaft Gutem nur vorläufig mit dem, was hypothetisch gut ist, gerecht werden. Dies ist unbefriedigend, weil es scheint, als würden wir den Wissensmangel durch Scheinwissen ausgleichen. Dem könnten wir nur entgehen, wenn wir wirklich wüssten, was gut ist.
Der, den wir dazu befragen können, ist Platon. Seine Idee des Guten ist ein Konzept, das – wie erwähnt – keinem der von Aristoteles getrennten Bereiche der Erkenntnistheorie, der Moral und der Ästhetik zugeordnet ist.34 Mit Platon können wir uns das dauerhaft Gute als etwas vorstellen, was nicht nur in einem jener methodisch getrennten Bereiche beheimatet ist. Wir wüssten gar nicht, in welchem. Was gut ist, soll nicht nur zuverlässig erkannt werden können, sondern auch tatsächlich in Gestalt des guten Lebens und Handelns existieren. Es soll auch moralisch gut sein und es soll uns gefallen und schön sein. Deswegen ist das dauerhaft Gute im Sinne Platons jenseits von modernen begrifflichen Unterscheidungen zwischen dem Normativen und Deskriptiven, Sein und Sollen, zu verstehen.35 Dementsprechend sind auch die Zweifel an dem, was wir für gut halten, Zweifel, mit denen wir leben, keinem der getrennten Bereiche zugeordnet. Sie sind immer sowohl kognitiv als auch moralisch, politisch und auch ästhetisch. Wir werden später allerdings der Frage nach dem, was gilt, in den methodisch getrennten Bereichen nachgehen. Zunächst geht es darum, ob wir über das Gute mehr als nur Vorläufiges – das, was nicht schlecht ist – wissen können. Wenn nicht, wie wollen wir dann wissen, dass es das Gute überhaupt gibt?
Wir gehen davon aus, dass das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem von seiner Zwiespältigkeit in einer Ordnung, die für alle gilt, überwunden werden kann. Wenn die Gründe, die für diese Ordnung sprechen, lediglich nicht schlecht sind, kann sie nur vorläufig gelten. Wir müssen uns eingestehen, dass diese Vorläufigkeit den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, kennzeichnet, und damit auch das, was gilt. Es kann aber nicht kennzeichnend für alles sein, was gilt. Schließlich gelten auch die eben beschriebenen nicht-reflexiven Gewissheiten. Beide Gewissheiten gelten nicht nur vorläufig. Sie gelten auch ohne weitere Begründung. Sie stehen modellhaft für das, was wir ›unabgeleitete Geltungen‹ nennen.
Daran, dass diese beiden Gewissheiten ohne Gründe gelten, erkennen wir ihren Grenzcharakter. Sie bilden den Rahmen, innerhalb dessen wir Gründe für den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, erkennen können. Für diesen Rahmen kann es keine Gründe geben. Die beiden nicht-reflexiven Gewissheiten stellen keinen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. Sie bilden den äußeren Rahmen für die mögliche Einsicht in diesen Zusammenhang und geben ihr Halt. Gäbe es diesen Rahmen nicht, würde das, wovon wir wollen, dass es gelten sollte, beliebig und haltlos.
›Nicht-reflexiv‹ nennen wir die Gewissheiten des Todes und der eigenen Existenz, weil sie unabhängig von allem sind, was wir Menschen über uns selbst, über die anderen und über die Welt denken und wissen oder nicht wissen. Deswegen können wir sie auch nicht verändern, in Frage stellen oder begründen. ›Nicht-reflexiv‹ ist alles, was ähnlich unabhängig von uns ist, also alles, was ist und wovon wir wissen, dass es ist. Wir können nur nicht all das, was sonst noch dazu gehört, wissen. Wir wissen aber, dass die Gewissheit, dass wir denkend existieren, dazu gehört. Sie ist das Modell unseres Wissens von allem, was ist. Wir haben dieses Wissen, weil wir die Gewissheit der eigenen Existenz denkend erfassen und erkennen können, dass es sie gibt. Wir erfassen die Existenz von allem ähnlich wie die eigene. Wir sind selbst Teil dessen, was ist. Da das Selbstwissen die eigene Existenz nicht-reflexiv voraussetzt, ist es nicht widersprüchlich, dass wir uns selbst reflexiv als nicht-reflexiven Teil der Wirklichkeit, all dessen, was ist, erkennen. Das reflexive Verhältnis zu uns selbst als Teil des Nicht-Reflexiven zeigt, wie wir alles, was ist, erfassen können.
Wir wollen untersuchen, wie das, was gilt, den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt. Wir nehmen an, dass es für das, was gilt, Gründe gibt und dass nur das, was gut für uns und die Natur ist, gelten sollte. Wir mussten eingestehen, dass wir nicht wissen, was das Gute ist. Platon kann uns, wie erwähnt, mehr über das Gute sagen. Das Gute, wie er es versteht, ist das, was mehr als alles andere wirklich existiert. Er nennt es das »größte Wissen«36, kann es aber zunächst nur in Gleichnissen beschreiben und nicht definieren, was es ist.37 Er weiß aber, dass es ist, auch wenn er nicht sagen kann, was es ist. Er weiß jedoch, was es nicht ist. Es ist nämlich nicht das, was wir vom Guten zu wissen meinen. Meinungen ohne Wissen seien vom Übel, sagt Platon. Wenn wir nur Meinungen über das Gute und kein Wissen davon hätten, müssten wir auch nicht mehr darüber nachdenken. Dann würden wir uns, Platons Gedankengang folgend, mit dem Sichtbaren zufriedengeben und auf das Denkbare als Zugang zum Wissen verzichten. Dies wäre falsch, weil wir auch das, was wir nicht wissen, aber denken können, benötigen, um das, was wir wissen, beurteilen zu können. Dies klingt zunächst widersinnig, sollte aber gleich klarer werden.
Wir benötigen das, was wir denken, aber nicht wissen können, im grammatischen Sinn konjunktivisch nach dem Muster ›was wäre, wenn‹. Wir denken dann im Konjunktiv, aber dennoch vernünftig. Was wäre, wenn wir wüssten, was das Gute ist? Wenn wir das wüssten, wüssten wir nicht nur, was es wirklich gibt, wir könnten auch sagen, welche unserer Meinungen darüber richtig und welche falsch sind. Solche Überlegungen sind kontrafaktisch, weil sie sich nicht auf tatsächliches, sondern auf mögliches Wissen beziehen. An einem Beispiel wird klarer, was ›kontrafaktische Überlegungen‹ sind.
Wenn ich wüsste, welche Zahlen im nächsten Lottospiel gezogen werden, könnte ich gewinnen. Ich kann mir überlegen, ob ich am Lottospiel teilnehme, obwohl die Chance zu gewinnen sehr gering ist, wenn ich die Gewinnzahlen nicht kenne. Aber selbst dann, wenn ich die Zahlen wüsste, wäre unklar, wie hoch mein Gewinn ist, weil ja viele dieselben Zahlen getippt haben könnten und der Gewinn für mich dann nicht groß wäre. Wenn ich dennoch am Spiel teilnehme, dann deswegen, weil ich mir vorstellen und denken kann, was wäre, wenn ich doch gewinnen würde. Ich habe die reelle Wahl, weil ich einerseits weiß, dass es nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit gibt zu gewinnen. Andererseits ist ein Gewinn nicht unmöglich, und ich kann mir denken, was es bedeuten würde, wenn ich gewinnen würde.
Was haben solche kontrafaktischen Überlegungen mit dem Guten zu tun? Wenn wir wüssten, was das Gute etwa in Gestalt eines guten Lebens ist, könnten wir uns nicht nur denken, wie unser Bedürfnis nach dauerhaft Gutem in unserem Leben befriedigt werden könnte. Wir wüssten auch, was sein sollte, und dementsprechend, was in unserer Gesellschaft gelten sollte. Wie in einer Lotterie haben wir die Wahl, kontrafaktisch über das Gute nachzudenken. In einer Lotterie gewinnt immer irgendjemand, vielleicht eine Person, vielleicht mehrere.
Beim kontrafaktischen Nachdenken über das Gute ist es in zwei Hinsichten anders. Anders ist es, zum einen, weil wir im Lotto nach jedem Spiel die Zahlen kennen, die gewinnen. Ein ähnlich konkretes Wissen haben wir beim kontrafaktischen Nachdenken über das Gute nicht. Wir können uns allerdings denken, wie ein gutes Leben aussehen könnte. Unser Denken bleibt im Konjunktiv, ist aber dennoch realistisch. Nicht nur die Möglichkeit des Guten, sondern auch die Wirklichkeit des Guten ist – kontrafaktisch – denkbar, etwa in Gestalt des guten Lebens in einer liberalen Gesellschaft, in der die Freiheitsrechte garantiert sind. Weil dies denkbar ist, können wir auch wissen, was gelten sollte, damit das gute Leben möglich ist.
Es ist, zum zweiten, anders als in einer Lotterie, weil wir beim Nachdenken über das Gute alle gewinnen können. Es ist gut für uns alle, bei dem, was wir tun und worüber wie nachdenken anzunehmen, dass es das Gute in Gestalt eines guten Lebens oder in anderen Gestalten gibt, jedenfalls ist es besser als anzunehmen, dass es das Gute nicht gibt. Würden wir von vornherein die Irrealität des Guten annehmen, wäre unser ontologisches Bedürfnis nach dauerhaft Gutem töricht und wir würden notwendig enttäuscht, wenn wir es ernst nähmen. Es wäre dann gut, zumindest besser, sich keine Gedanken über das Gute zu machen, sei es in Gestalt des guten Lebens oder in anderer Gestalt.
Es kann aber nicht gut oder besser sein, sich keine Gedanken über das Gute zu machen, wenn wir das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem haben. Wir könnten dieses Bedürfnis natürlich leugnen und als Irrtum, als Hirngespinst oder gar als krankhaft abtun. Wenn wir aber eine nicht-reflexive Gegebenheit wie jenes Bedürfnis reflexiv leugnen, können wir alles, einschließlich des Urknalls, leugnen. Die Wissenschaftsgeschichte der Kosmologie kennt dafür seit Ptolemäus Beispiele. Wir müssen sie aber nicht bemühen. Es genügt den Widerspruch zu erkennen, den wir zuließen und nicht auflösen könnten. Es ist ein Widerspruch, das Nachdenken über das Gute und das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem gleichzeitig für gut und für nicht gut zu halten. Nun haben wir aber das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, also ist es ein Widerspruch, wenn wir gleichzeitig annehmen, dass es nicht gut ist, darüber nachzudenken.
Ähnlich wie bei einer Lotterie haben wir beim Nachdenken über das Gute eine Wahl. Wir können den eben beschriebenen Widerspruch erkennen, ihn auflösen und mitspielen, indem wir über das Gute nachdenken und das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem ernst nehmen. Wir können den Widerspruch auch nicht erkennen und nicht mitspielen, weil wir von vornherein glauben, dass es gut ist, nicht über das Gute nachzudenken und das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem für ein Hirngespinst zu halten. Wir könnten verlangen, dass der Widerspruch erst einmal nachgewiesen wird, bevor wir uns entscheiden mitzuspielen und über das Gute nachzudenken. Wir könnten die Möglichkeit eines Widerspruchs in dieser Sache von vornherein ablehnen, weil wir jenes Nachdenken für irrtümlich, verworren oder krankhaft halten.
Was den Widerspruch angeht, können wir nicht mehr tun, als ihn beschreiben. Seine Widersprüchlichkeit können wir nicht beweisen, weil ein Widerspruch und das ihm zugrunde liegende Prinzip nicht begründet, sondern nur anerkannt werden kann.38 Es kann auch nicht nachgewiesen werden, dass jenes Nachdenken irrtümlich, verworren und krankhaft wäre. Nehmen wir aber an, es wäre doch so, dann wäre es ja gut, nicht darüber nachzudenken, und der Widerspruch bliebe erhalten. Nicht mitzuspielen, also nicht über das Gute nachzudenken, ist daher im Unterschied zur Teilnahme an einer Lotterie keine vernünftige, jedenfalls keine widerspruchsfreie Option.
Wir dürfen annehmen, dass unser Bedürfnis nach dauerhaft Gutem und unser Nachdenken über das Gute weder irrtümlich noch krankhaft sind. Den möglichen Widerspruch erkennen wir anhand der kontrafaktischen Überlegung, was wäre, wenn es das Gute geben oder nicht geben würde. Dass wir nicht wissen, was das Gute ist, ist kein Argument dafür, dass es das Gute nicht gibt. Es wäre aus diesem Grund auch nicht gut, nicht darüber nachzudenken. Wir würden uns damit selbst widersprechen. Wir wissen nicht, was das Gute ist, können aber nicht daran zweifeln, dass es das Gute in Gestalt eines guten Lebens und in vielen anderen Gestalten gibt, gegeben hat und in Zukunft geben kann. Wir können uns daran erinnern und darauf hoffen, es wieder zu erlangen, wenn wir glauben, es verloren zu haben.
Wir sind damit keinen Schritt weiter als Platon. Wir wissen, dass es das Gute gibt, aber nicht, was es genau ist.39 Damit wissen wir aber auch, dass es das Gute geben kann und was – dies vorausgesetzt – in unserer Gesellschaft gelten sollte. Wir können den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, kontrafaktisch herstellen. Dies ist für das Nachdenken über das, was gelten sollte, unverzichtbar. Natürlich wissen wir über das Gute weniger Genaues als über die Lottozahlen nach der Ziehung.
Kontrafaktische Überlegungen zeigen, dass wir etwas ›gut‹ nennen können, was sich auch als schlecht erweisen könnte. Es ist dann nicht wirklich, sondern der Möglichkeit nach gut. Etwas ›der Möglichkeit nach gut‹ zu nennen, hat aber nur Sinn, wenn es auch wirklich gut sein könnte. Zu wissen, dass dies möglich ist, bedeutet nicht, dass wir wissen, was das Gute tatsächlich ist. Wir können aber kontrafaktisch wissen, was es bedeuten würde zu wissen, was das Gute in Gestalt des guten Lebens tatsächlich ist. Dann wüssten wir auch, was sein sollte und was gelten sollte. Wir denken und urteilen zuverlässig, wenn wir kontrafaktisch urteilen. Für die Geltung unserer Urteile sind kontrafaktische Überlegungen unverzichtbar.
Kehren wir zu dem zurück, was wir wissen. Wir wissen, dass etwas als gut gelten, was sich als schlecht erweisen kann; sonst könnten wir uns weder selbst betrügen und irren noch von anderen betrogen werden und auf Irrtümer hereinfallen. Vieles von dem, was heute unsere Umwelt zerstört, galt einmal als gut. Dass ein Urteil über etwas gilt, garantiert also nicht dessen haltbar gute Qualität. Sie garantiert weder dessen Güte noch dessen Haltbarkeit, weil wir auch an dieser Stelle nicht klar zwischen ›vorläufig‹ und ›endgültig‹ unterscheiden können. Und das bedeutet, dass wir im zeitlichen Sinn auch nicht klar zwischen ›kontingent‹ und ›absolut‹ unterscheiden können. Das, was gilt, und das, was wir als geltend annehmen, kann auf Sand gebaut sein. Diese Irritation wäre unerträglich, wenn nichts gelten würde. Dies stellt den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, scheinbar auf den Kopf, so als käme es zuallererst auf das an, was gilt, und dann erst auf das, was ist und sein soll. Die Grundmauern – was ist und was sein soll – würden, in einem Bild Wittgensteins, vom ganzen Haus getragen.40
Was notwendig, also immer gut ist, wissen wir streng genommen ebenso wenig wie Platon. Spekulativ müsste es etwas sein wie Gott, also etwas, wovon wir zeitunabhängig nicht einmal denken können, dass es schlecht sein könnte. Was könnte das – außer Gott41 – sein, fragen wir uns ratlos. Es fällt uns kein anderes Beispiel ein, denn selbst bei der Liebe ist es ungewiss, ob sie immer und in jeder ihrer Erscheinungsweisen gut ist. Welche Mutter würde nicht ihren Sohn lieben und schützen wollen, wohl wissend, dass er Übles getan, vielleicht sogar gemordet hat? Ist diese Mutterliebe blind und schlecht, weil sie alles verzeiht? Es ist schwer zu bestreiten, dass es Liebe ist, obwohl der Sohn Schlimmes getan hat. Ähnlich nicht-enttäuschbar stellen wir uns die Liebe Gottes zu den Menschen vor.
Wenn wir – ohne Spekulation – etwas als nicht-reflexiv festgelegt und unbezweifelbar annehmen wie das Gesetz des Widerspruchs, gilt dies genau deswegen notwendig für uns. Dieses Gesetz verdankt seine Geltung keiner Begründung. Es gilt in dem oben beschriebenen Rahmen der Gewissheiten, in dem wir es auffinden und anerkennen können. Dieser Rahmen ist von den beiden Gewissheiten unseres Denkens begrenzt. Das Gesetz gilt also genau genommen ebenfalls nur in diesen Grenzen, und es gilt nicht-reflexiv, unabgeleitet, weil wir es auffinden und nicht selbst reflexiv festlegen und begründen.
Das eigene Denken ist für das Erfassen des Gesetzes des Widerspruchs aber unverzichtbar. Wir tragen durch unser eigenes Denken zu den Bedingungen der Geltung des Gesetzes bei. Dies müssen wir auch, weil wir zwar wissen, dass das Gesetz gilt, aber nicht, was genau es besagt. Mit den Bedingungen, die wir selbst beitragen, legen wir fest, was das Gesetz bedeutet. Eine dieser Bedingungen ist, dass es nur zwei Wahrheitswerte, nämlich ›wahr‹ und ›falsch‹, gibt. Nur dann gilt die Behauptung, dass ein Satz nicht gleichzeitig wahr und falsch sein kann. Wenn wir aber, wie Aristoteles42, diese Bedingungen ontologisch verstehen, dann bedeutet der Widerspruch, dass etwas nicht im gleichen Sinn sein und nicht sein kann. Wir können für die Geltung des Widerspruchsprinzips aussagenlogische oder ontologische Bedingungen annehmen. Das Ziel ist dasselbe, das Falsche und das Übel des Irrtums durch Widersprüche zu vermeiden. Wir haben innerhalb der Grenzen unserer Gewissheiten einen Spielraum für Bedingungen, die wir selbst für die Geltung eines Gesetzes festlegen.
Wie wir Menschen die Unzuverlässigkeit und die mangelnde Haltbarkeit unseres Wissens durch die Vermeidung von Schlechtem und die Bewahrung vor Schaden ausgleichen können, ist oft unklar und strittig. Dies liegt zum einen daran, dass wir uns in lebenswichtigen Fragen ganz und gar nicht einig sind und darüber streiten, was gut, schlecht und nicht schlecht, falsch oder nicht falsch ist. Es liegt zum andern daran, dass der Mangel an haltbarem Wissen selbst umstritten ist, schließlich fliegen Flugzeuge, Raketen, Satelliten und eine Raumstation im All, es werden menschliches und tierisches Leben ermöglicht und gerettet, und wir können alles Mögliche hier und im Kosmos berechnen, gänzlich unabhängig davon, dass wir nicht wissen, ob all das gut für uns und die Welt, in der wir leben, ist. Deswegen glauben viele, dass es jenen Mangel – in der Welt von Wissenschaft, Technik und Mathematik – gar nicht gibt, zumindest nicht für alle geben muss und in einer fernen Zukunft vielleicht auch für niemanden mehr geben wird.
Einigen können wir uns leicht, wenn wir den Mangel an haltbarem Wissen nicht allzu ernst nehmen, wenn es etwa darum geht, die Geltung der Verfallsdaten für Lebensmittel oder Kosmetika festzulegen. Die Entscheidung, wie lange Lebensmittel und Kosmetika gut sind, überlassen wir großzügig und vertrauensvoll anderen, ohne sicher zu sein, dass sie mehr wissen als wir selbst. Den Mangel an eigenem Wissen ignorieren wir, wenn es uns nicht vordringlich erscheint, etwas für schlecht zu halten und einen möglichen Schaden zu vermeiden. Diese Haltung kann fahrlässig und nicht nur uninformiert, sondern töricht sein.
Es geht aber nicht immer darum, dass wir nicht wissen, was gut für uns ist. Oft wissen wir auch nicht, was wahr und richtig ist. Dann fällt uns auf, dass wir nicht wissen, welche Kriterien für die Wahrheit einer Behauptung erfüllt sein müssen. Dieser Mangel und das Schlechte daran oder der mögliche Schaden, der entstehen kann, werden uns spätestens dann interessieren, wenn wir selbst von der Wahrheitsfrage betroffen sind, weil uns niemand glaubt oder weil eine unwahre Behauptung für uns nachteilig und schlecht sein kann. Wenn wir schon nicht genau wissen, was eine Behauptung wahr macht, wüssten wir doch gerne, wie ihre Unwahrheit nachgewiesen werden kann. Nicht nur vor Gericht, sondern auch zu Hause kann dieses Wissen wichtig sein und Schlechtes, Sorgen und Ärger verhindern.
Wer wollte bestreiten, dass es besser ist zu wissen, ob etwas nicht schlecht, nicht falsch ist und nicht schadet, wenn wir schon nicht wissen, ob es gut oder wahr und richtig ist. Oft kann dann, wenn das Wissen ungewiss ist und die Ungewissheit Schaden anrichten würde, das geltende Recht helfen. Es hilft immer dann, wenn es möglich ist zu sagen, was nicht schlecht und nicht falsch ist. Wenn es sich herausstellt, dass das geltende Recht selbst schlecht ist oder nicht ausreicht, um Schlechtes und Schaden zu verhindern, kann es durch Besseres ersetzt, angepasst und reformiert werden. Das Recht gilt immer vorläufig. Es gilt vor Gericht aber meist auch endgültig und hilft zu verstehen, was es bedeutet, dass etwas gilt. Wir können auch in diesem Fall nicht klar zwischen ›vorläufig‹ und ›endgültig‹ unterscheiden. Denn das vorläufig geltende Recht kann endgültig darüber entscheiden, ob einer Klage stattgegeben wird oder nicht, ob jemand schuldig ist und verurteilt wird oder nicht.
Das geltende Recht und die Verfassung bilden eine Ordnung und ermöglichen, dass der Rahmen unseres gemeinsamen Lebens eine gewisse Zeit verlässlich ist. Die Rechtsordnung in einer Gesellschaft ist gut, wenn sie überprüfbar ist und den Maßstäben der Menschlichkeit entspricht, die in einer demokratischen, liberalen Verfassung enthalten sind. Nicht jede rechtliche Ordnung ist gut, wie uns die eigene Geschichte lehrt. Deswegen ist eine geltende Ordnung kein Garant dafür, dass unser Bedürfnis nach verlässlich Gutem von ihr auch dauerhaft gestillt werden könnte. Es gibt gute und schlechte, menschliche und unmenschliche Ordnungen. Ihre Stabilität und Dauer sind keine hinreichenden Maßstäbe für ihre Güte. Manche glauben, in der Natur Vorbilder für zuverlässige, sich selbst erhaltende, spontane Ordnungen erkennen zu können. Ob diese Ordnungen wirklich stabil sind und sich selbst erhalten können, ist aber ungewiss und eher zu bezweifeln. Zumindest tragen wir selbst dazu bei, jene Ordnungen zu stören, vielleicht sogar unwiederbringlich zu zerstören.
Das geltende Recht ist – unabhängig von der Ordnungs-Frage –eine unverzichtbare Hilfe, wenn es darum geht, dass unser Wissensmangel nicht schlecht und nicht falsch für unser Leben ist. Auch in einer so schwierigen Frage wie der, ob es gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, das Leben von Menschen zu erhalten oder nicht, gleicht das geltende Recht den Mangel an Wissen aus, indem es erlaubt, dass auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet werden darf, wenn das Leben eines Menschen nicht gerettet oder geschützt werden kann. Es gilt zumindest als nicht schlecht, in diesem Fall auf den Lebensschutz zu verzichten. Wenn wir aber in Fällen wie dem Apallischen Syndrom und dem Wachkoma nicht wissen, ob ein Patient noch ein Bewusstsein hat, kann es schlecht sein, auf den Lebensschutz zu verzichten.
Das geltende Recht trägt in besonderer Weise dazu bei, dass unser Bedürfnis nach dauerhaft Gutem nicht immer enttäuscht wird, wenn wir nicht wissen, was wirklich gut, richtig oder wahr ist. Häufig dienen Vereinbarungen und Festlegungen wie etwa Maße und Gewichte dazu, den Mangel an Wissen über die Verhältnisse der Mengen und Größen der Dinge des Lebens gar nicht erst wirksam werden zu lassen. Niemand würde annehmen, dass es sie nicht wirklich gibt. Und jedermann glaubt, dass diese Festlegungen gut sind und gelten sollten. Dass sie gelten, stellt den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her, ohne dass es uns auffällt. Es wäre schlecht für unser tägliches Leben, wenn es sie nicht geben würde und sie nicht gelten würden. Vieles legen wir fest, weil uns an der Geltung dieser Festlegungen allein schon deswegen gelegen ist, weil ohne sie alles Mögliche auf verwirrende Weise ständig anders sein könnte. Wir wollen, dass diese Festlegungen genauso bleibend existieren wie alles andere, was es gibt.
Dazu gehört so Wichtiges wie Versprechen, Spielregeln, Skalen, die Uhrzeit, Wechselkurse und viele Konventionen und so Unwichtiges, für viele aber Vergnügliches oder Enttäuschendes wie Wetten. Wir wüssten ohne solche Festlegungen nicht, was wann gelten würde. Ihre Geltung schützt uns vor vielen Ungewissheiten, die das tägliche Leben erschweren würden. Die Geltung hält den Zweifel und die Ungewissheit in Schach. Unwahrheit, Irrtum und Betrug werden dadurch aber nicht ausgeschlossen oder verhindert. Es kann sogar etwas gelten, was einen Betrug erst möglich macht. Dass der Zweifel in Schach gehalten wird, kann auch für den Betrug ausgenutzt werden.