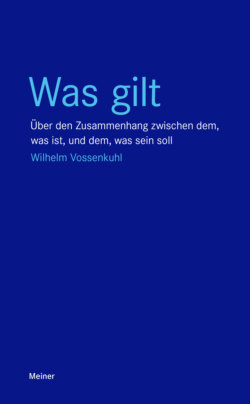Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6 Ob Geltung teilbar ist
ОглавлениеVieles, was gilt, scheint auf den ersten Blick mehr und anderes weniger, vieles nur kurzfristig, anderes länger zu gelten. Wechselkurse gelten selten lang, dagegen sollten die Menschenrechte dauerhaft gelten. Die Geltung von Verkehrsregeln scheint weniger bedeutsam zu sein als die Geltung der Menschenrechte oder ein Artikel unserer Verfassung. Geltung wäre, wenn es so ist, teilbar, je nach dem, was wie gilt. Wenn Geltung teilbar wäre, würde tatsächlich etwas im Raum dessen, was überhaupt gelten kann, mehr, anderes weniger gelten.
Dieser Gedanke enthält viel Unwägbares. Unwägbar ist, ob wir von einem solchen Raum überhaupt sprechen können. Das Wort ›Raum‹ unterstellt ein geschlossenes, begrenztes Ganzes. Dann wäre der Raum der Geltung sein solches Ganzes, und was jeweils gelten würde, wäre etwas Einzelnes. Das Einzelne hätte einen größeren oder kleineren, bedeutenderen oder weniger bedeutenden Anteil am Raum der Geltung insgesamt. Gegenüber dieser Annahme ist Vorsicht geboten, weil wir dem Wort ›Geltung‹ eine Eigenbedeutung geben würden, die das Wort nicht hat. Es gibt nichts, weder einen abstrakten noch einen konkreten Gegenstand, der mit ›Geltung‹ bezeichnet werden könnte.
Der Grundgedanke dieser Untersuchung ist, dass das, was gilt, einen Zusammenhang herstellt zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Dieser Zusammenhang ist selbst kein einheitlicher Gegenstand, der zutreffend mit ›Geltung‹ bezeichnet werden könnte. Es gibt viele sehr unterschiedliche Zusammenhänge. Es existieren z. B. Staaten, Institutionen und Personen und die Staaten und Institutionen sollen die Freiheit, das Leben und vieles mehr der Personen gewährleisten und schützen, die in ihnen leben. Dies ist nur möglich, wenn Gesetze gelten, die einen Zusammenhang zwischen den im Staat existierenden Personen und dem, was der Staat für sie tun soll, herstellen. Es gibt Märkte, die Arbeit und Einkommen ermöglichen, und Menschen, die Arbeit suchen. Menschen sollen nicht ausgebeutet werden und für ihre Arbeit einen gerechten Lohn erhalten. Um dies zu gewährleisten gelten andere Gesetze. Diese Beispiele zeigen, wie das, was ist, mit dem, was sein soll, in einen Zusammenhang gebracht wird.
Die Gesetze, die in diesen Beispielen gelten, haben einen gemeinsamen staatlichen Geltungsraum. In diesem Raum gelten auch Verkehrsregeln, eine Verfassung oder das Steuerrecht. Auch die Menschenrechte haben einen Raum, sie gelten global, also überall auf der Erde. Die Räume dieser Beispiele sind von unterschiedlicher staatlicher, geographischer oder wirtschaftlicher Art und nicht einheitlich, auch wenn sie teilweise gemeinsame Geltungsbereiche haben. Wir können also durchaus von unterschiedlich gearteten gemeinsamen Geltungsräumen sprechen. Es gibt aber nicht den Raum der Geltung. Deswegen kann es auch keine Relation zwischen den vielen Geltungsarten und –räumen und der einen Geltung geben. Die Frage der Teilbarkeit betrifft nicht die Geltung, sondern das, was jeweils gilt. Es kann nur darum gehen, ob etwas mehr oder anders gilt als etwas anderes. Ob es so ist, können wir mit zwei Vergleichen prüfen, deren erster noch einmal die eben beschriebene Unmöglichkeit bestätigt.
Den ersten Vergleich stellen wir mit den ähnlich scheinenden Fragen an, ob die Wahrheit und ob das Gute teilbar sind. Im zweiten Vergleich geht es um das, was jeweils gilt. Es ist naheliegend, dass etwas unbedingt und etwas anderes in Abhängigkeit davon nur bedingt gilt.45 Letzteres liegt nahe, weil wir – analog zur Unterscheidung zwischen unbedingt und bedingt – zwischen abgeleiteten und unabgeleiteten Geltungen unterscheiden. Die unabgeleiteten haben keine Begründung, die abgeleiteten sind dagegen begründet. Ihre Begründung kann unterschiedlicher Art sein, greift aber am Ende der Begründungsschritte immer auf etwas zurück, was nicht begründet ist. Wir werden zu diesem Gedanken zurückkehren.
Überlegen wir zunächst, ob die Wahrheit und das Gute teilbar sind, ob es ein Mehr-oder-weniger davon gibt. Wir zögern nicht zu sagen, es gibt Besseres und Schlechteres und meinen, es gibt mehr oder weniger Gutes. Wir können auch meinen, dass etwas, was schlecht war, besser geworden ist. Was eine Person getan hat, kann besser sein als das, was eine andere tat. Dieselbe Person kann auch etwas, was sie schlecht machte, irgendwann besser und gut machen. Wir unterscheiden den guten vom weniger guten und schlechten Menschen. Es gibt dabei Übergänge vom Werden und Entstehen zum Vergehen. Entsprechend gibt es ein Entstehen und Vergehen von Fähigkeiten, Handlungen und Dingen, die gut oder schlecht sind. Die Frage ist, ob es sich dabei um ein Werden, Entstehen und Vergehen des Guten handelt. Diese Frage kann mit der noch allgemeineren verbunden werden, ob das, was ist, entstehen und vergehen kann; sie betrifft das Sein von etwas.
Die eben im Zusammenhang mit dem Wort ›Geltung‹ erwähnte Vorsicht, eine Bedeutung anzunehmen, wo es keine gibt, müssen wir nun auch gegenüber den Worten ›Sein‹ und ›das Gute‹ üben. Wir lassen uns aber zunächst auf die Rede vom ›Sein‹ und vom ›Guten‹ ein, weil sie eine Tradition hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es darauf ankommt, wie und wovon wir sagen, dass etwas ist, entsteht und vergeht. Wie wir sagen, dass etwas ist, ist Thema des nächsten Kapitels.
Wovon wir sagen, dass es ist, ist Thema der Metaphysik. Aristoteles ist überzeugt, dass es ein Mehr und ein Weniger an Sein gibt und dass die Stufen der Wahrheit den Stufen des Seins entsprechen.46 Thomas von Aquin macht sich diese Gedanken zu eigen, wenn er in seinen fünf Wegen, das Dasein Gottes zu beweisen, Grade des Seienden und Guten unterscheidet und Gott das höchste Sein und das höchste Gute zuspricht.47 Es geht beiden Philosophen immer um das, wovon man sagen kann, dass es ist, dass es entsteht und vergeht. Das Sein selbst entsteht und vergeht aber nicht und hat auch keine Stufen. Es wird von dem, was ist, jeweils, wie Thomas meint, auf analoge48 Weise gesagt. Es gibt nicht die eine Bedeutung des Seins, die dann auf alles das, was ist, einfach übertragen wird.
So denkt auch Aristoteles, allerdings ohne den Analogie-Gedanken. Er ist – als Kritiker von Platons Ideen – strikt dagegen, dass etwas Allgemeines neben dem Einzelnen selbständig existiert.49 Er bestätigt die oben am Beispiel ›Geltung‹ begründete Vorsicht gegenüber der Unterstellung einer Eigenbedeutung von ›Sein‹ und ›Wahrheit‹. Es gibt für ihn so viele Weisen, vom Sein zu sprechen, wie es Wesenheiten gibt, also Bestimmungen, die nur einer Wesenheit, z. B. einem Lebewesen, allein zukommen. Ein Pferd ist eben kein Esel, entsprechend unterscheidet sich das Pferd-Sein vom Esel-Sein. Über deren jeweiliges Sein lässt sich, wie Aristoteles glaubt, nichts über deren Besonderheit hinausgehendes Allgemeines sagen.50
Da Aristoteles die Bedeutungen des Guten mit denen des Seienden verbindet51, können wir davon ausgehen, dass er auch für sie kein gemeinsames Allgemeines annimmt. Die Teilbarkeit des Guten und des Seins, nach der wir fragen, setzt aus der Perspektive von Aristoteles kein gemeinsames Allgemeines, kein übergeordnetes Wesen voraus. Der Grund ist, dass nichts Allgemeines nach seinem Urteil eine Wesenheit ist und dass keine Wesenheit aus Wesenheiten besteht.52 Es ist eine Geteiltheit, eine Vielfalt der Bedeutungen, die jeweils bestimmten Wesenheiten auf unterschiedliche Weise zukommen. Das Mehr oder Weniger an Sein, von dem Aristoteles spricht, kommt den Prinzipien und nicht den einzelnen Wesen zu. Es gibt allgemeinere und weniger allgemeine Prinzipien. Das allgemeinste Prinzip in seiner Metaphysik ist der Satz des Widerspruchs.
Aristoteles belehrt uns über die fehlende Allgemeinheit der Bedeutungen von ›Sein‹. Seiner Lehre von den ›Wesenheiten‹ müssen wir uns aber nicht anschließen, um von besseren und schlechteren Handlungen und von Personen, die besser oder schlechter sind, sprechen zu können. Wovon wir dabei ein Mehr oder Weniger an Gutem annehmen, ist kontingent. Es sind Bestimmungen, die sich ändern können; sie beschreiben keine unveränderlichen Wesenheiten. Deswegen benötigen wir für die Unterscheidung zwischen mehr oder weniger Gutem keine metaphysische Ordnung. Eine metaphysische Ordnung zeigt sich außerdem nicht in der Art und Weise, wie wir über die Existenz und das Werden und Vergehen von Dingen oder Handlungen sprechen und wie wir sie beschreiben. Die Beschreibung ist von der metaphysischen Ordnung unabhängig. Weil wir uns in dieser Untersuchung auf die Art und Weise, wie wir über die Existenz der Dinge sprechen, konzentrieren, müssen wir die Bedeutung und die Geltung dieser Ordnung nicht beurteilen.
Kehren wir zurück zu der Frage, ob das Gute teilbar ist. Es kommt darauf an, wonach wir fragen. Wir können fragen, für wen oder was etwas Gutes jeweils besser ist. Es geht dabei um das, wovon wir sagen, es sei besser oder schlechter für jemanden oder für ein Ziel. Wenn wir sagen, die eine Handlung sei besser als die andere, sagen wir nicht, das Gute der einen Handlung sei besser als das Gute der anderen. Das wäre widersinnig. Schließlich ist das Gute der prädikative Bezugspunkt und nicht der Gegenstand des Urteils. Eine Handlung ist besser als eine andere relativ zum Guten, um das es dabei gehen kann, aber eine Handlung ist kein besseres Gutes als eine andere. Eine Person ist gut relativ zu dem, was sie getan hat und hätte tun können. Ähnlich beurteilen wir eine Handlung. Das Gute ist in allen diesen Urteilen eine Art singulare tantum, von dem es kein Mehr oder Weniger und kein Vieles gibt.
Anders sprechen wir von dem verwandten Ausdruck, den ›Gütern‹53, von denen die einen mehr wert sind als die anderen, von denen viele teilbar sind wie das Geld, von denen einige auch unteilbar sind, wie transplantierbare Organe. Es gibt verzichtbare und unverzichtbare Güter, deren Qualität sich nach ihrem Anteil an einem guten Leben bemisst. Ihre Verzichtbarkeit oder Unverzichtbarkeit stellt sich erst heraus, wenn wir eines dieser Güter, wie die Gesundheit, verlieren und wir alles dafür geben würden, um sie wieder zu bekommen.54
Bei der Wahrheit verhält es sich ähnlich wie beim Guten. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, dass eine Behauptung wahrer als eine andere ist. Wir können aber sagen, dass eine Behauptung besser bestätigt oder bekannter oder fruchtbarer, wichtiger und folgenreicher ist als eine andere. Damit wollen wir aber nicht sagen, dass diese Behauptung wahrer ist als eine weniger wichtige. Entweder sind beide wahr oder nicht. Bestätigung, Gewicht, Fruchtbarkeit und Wirksamkeit sind Qualitäten dessen, was behauptet wurde, nicht Qualitäten der Wahrheit. Die Wahrheit ist so wenig teilbar wie das Gute.
Ähnlich verhält es sich mit der Geltung. Wir können zwar sagen, dass die Geltung der Naturgesetze Vorrang vor der Geltung einzelner wissenschaftlicher Erkenntnisse hat, weil diese Erkenntnisse von der Geltung der Naturgesetze abhängig sind und mit ihnen übereinstimmen müssen. Diese Abhängigkeit betrifft die Gehalte der Naturgesetze und der Erkenntnisse, deren Allgemeinheit und Reichweite, aber nicht deren Geltung. Entweder sie gelten oder sie gelten nicht. Wir können auch sagen, dass die Geltung der Verfassung einen höheren Rang hat als die Geltung des Strafrechts, weil das Strafrecht mit der Verfassung konform sein muss und nicht umgekehrt. Eine Strafe darf z. B. die Menschenwürde nicht verletzen. Auch in diesem Fall gibt es eine inhaltliche Asymmetrie, die einer Abhängigkeit der Inhalte des einen vom anderen entspricht. Es gelten aber beide oder sie gelten nicht.
›Geltung‹ hat weder eine Eigenbedeutung noch ist sie teilbar. Es gibt nichts, was – wenn es gilt – mehr gilt als etwas anderes. Es gibt aber Abhängigkeiten zwischen dem, was gilt, relativ zu dem, was ist, und dem, was sein soll. Diesen Abhängigkeiten entsprechend kann das, was gilt, eine größere Bedeutung, ein größeres Gewicht und eine größere Reichweite haben als etwas anderes. Um diese Unterschiede zu erkennen, müssen wir uns überlegen, was es gibt und was sein soll. Die Unterscheidungen zwischen bedingter und unbedingter oder zwischen abgeleiteter und unabgeleiteter Geltung markieren diese Unterschiede und machen sie verständlicher.55 Es gibt z. B. Verletzungen der Menschenrechte, und um diese Verletzungen zu ahnden, soll es Gesetze geben. Die Menschenrechte gelten unbedingt, unabgeleitet, die Gesetze, die Verletzungen dieser Rechte ahnden sollen, gelten bedingt, abgeleitet von der Geltung der Menschenrechte. Die rechtlichen Sanktionen gelten nicht weniger als die Menschenrechte, aber in Abhängigkeit von ihnen.
Ein geringeres Gewicht und eine geringere Reichweite als die Menschenrechte haben z. B. das deutsche oder britische Verkehrsrecht. Es gibt öffentliche und private Verkehrsmittel und ihre Nutzung kann Menschen gefährden. Das Verkehrsrecht soll die Teilnahme am Straßenverkehr und die Nutzung der Verkehrsmittel regeln, ihren Missbrauch ahnden und Gefährdungen möglichst verhindern. Die entsprechenden Regelungen weichen im einen und anderen Fall voneinander ab und gelten territorial, also eingeschränkt auf die jeweiligen nationalen Verkehrssysteme. Der Schutz des Lebens ist der prinzipielle Anspruch, der beiden Regelungen zugrunde liegt.
Wir haben mit Vorbehalt vom ›Raum‹ der Geltung und dessen Teilbarkeit gesprochen. Es gibt auch die Zeit und die Zeiträume, in denen etwas gilt. Vieles, was gilt, hat einen zeitlichen Index, anderes nicht. Wir neigen dazu, die Geltung der Menschenrechte ohne zeitliche Einschränkung zu verstehen, wohl wissend, dass sie erst nach und nach durch Gesetze in Geltung kamen und dies noch nicht überall. Es geht dabei um den Zusammenhang zwischen Genesis und Geltung, der uns später beschäftigen wird. Der zeitliche Index stammt von der Genesis dessen, was gilt. Wir werden sehen, dass Geltung selbst keinen zeitlichen Index hat und auch in zeitlicher Hinsicht nicht teilbar ist. Angelehnt an Gottlob Freges Verständnis von ›Gedanken‹, die keinen zeitlichen Veränderungen unterworfen sind, können wir von der ›Unzeitlichkeit‹ der Geltung sprechen.56