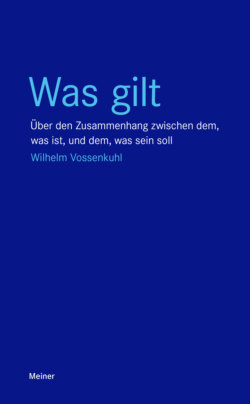Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.11 Ob Prinzipien offene Bedeutungen haben
ОглавлениеWenn es keine Kriterien der Identität der Bedeutung von Begriffen gibt, fehlen solche Kriterien auch für Prinzipien. Sie existieren in doppelter Hinsicht, nicht-reflexiv und reflexiv, ohne dass die Differenz zwischen beidem durch ein Kriterium der Identität überbrückt werden könnte. Wir haben einen Nachweis der Identität von Begriffen gesucht, weil wir meistens nicht wie im Fall des Widerspruchsprinzips das Nicht-Reflexive symbolisch repräsentieren und formal, im Sinn eines Vorbegriffs, identifizieren können. Damit überbrücken wir die Differenz nicht, weil wir das Nicht-Reflexive immer nur reflexiv in einer bestimmten Version des Prinzips verstehen und beschreiben können. Der ontologische oder der aussagenlogische oder der moralische Gebrauch des Prinzips entscheiden darüber, in welcher Bedeutung wir das Prinzip verstehen. Wir können es nicht gleichzeitig in allen drei Bedeutungen verstehen, und es gibt nicht nur einen einzigen Gebrauch; deswegen gibt es auch nicht die eine grundlegende Bedeutung des Prinzips. Da die Lücke zwischen dem Nicht-Reflexiven und dem Reflexiven bestehen bleibt, ist die Bedeutung des Prinzips offen für das eine oder andere Verständnis.
Diese Offenheit bleibt im Fall des Widerspruchsprinzips abstrakt. Sie interessiert uns nur, wenn wir unsicher sind und uns fragen, was dieses Prinzip genau bedeutet. Wenn es um das Gute geht, hat die Offenheit der Bedeutung die praktische Folge, dass wir mit dem, was nicht schlecht ist, leben müssen oder uns mit den anderen über das, was sie und wir für gut halten, streiten. Wenn es um Prinzipien wie die Menschenwürde geht, wollen wir die Offenheit nicht akzeptieren und suchen nach einer möglichst genauen Bedeutung. Wir misstrauen dem Gebrauch eines solchen Prinzips, wenn es keine bestimmte Bedeutung hat, die ähnlich wie der Träger eines Eigennamens klar identifizierbar ist. Die Bezeichnungen von abstrakten Gegenständen wie Prinzipien sind aber keine Eigennamen. Sie beziehen sich nicht auf etwas Raumzeitliches und identifizieren keinen bestimmten Bedeutungsträger. Daher haben diese Bezeichnungen keine festgelegte Bedeutung; es sind lediglich Vorbegriffe, semantische Indikatoren von etwas.
Dies hat weitreichende Folgen für das, was gilt und gelten kann. Da es für Prinzipien und andere Begriffe keine Kriterien der Identität ihrer Bedeutungen gibt, bleibt uns nur die Gebrauchsbedeutung zu ihrer Identifikation. Dann hat jedes dieser Prinzipien genau die Bedeutung, in der es jeweils gebraucht wird. Dann gilt auch jedes Prinzip nur in einer dieser Bedeutungen. Wir sind davon ausgegangen, dass das, was gilt, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt. Der Zusammenhang, den die Gebrauchsbedeutung eines Prinzips herstellt, ist der zwischen der nicht-reflexiven Existenz des Prinzips, das nur seiner Bezeichnung nach und als Vorbegriff bekannt ist, und der reflexiven Bedeutung, in der es in der Praxis tatsächlich gebraucht wird. Es ist der Zusammenhang zwischen dem Dass und dem Was des Prinzips.
Eine Ursache der abstrakt formulierten Offenheit der Bedeutung ist der Unterschied zwischen Genese und Geltung. Diese Differenz zeigt sich semantisch als Offenheit oder Unbestimmtheit. Es ist kaum zu bestreiten, dass die Geltung von Prinzipien eine Genese hat. Wir nehmen irrtümlich an, dass jede Genese irgendwann ein Ende hat, müssen uns aber mit dem Gedanken vertraut machen, dass dies nicht so ist und der Unterschied zwischen Genese und Geltung in jeder Gebrauchsbedeutung erhalten bleibt. Die Genese geht in einer Geltung nicht vollständig auf, so als wäre sie auf eine bestimmte Geltung ausgerichtet. In der Gebrauchsbedeutung eines Prinzips findet zwar eine Fusion von Genese und Geltung statt. Sie ist aber immer nur vorläufig. Der aktuelle Gebrauch eines Prinzips hat in der Praxis die Bedeutung, die gilt.
Die Bedeutung eines Prinzips wie die Menschenwürde wird in der Rechtspraxis des Verfassungsgerichts festgelegt. In der Rechtspraxis gilt die Gebrauchsbedeutung dieses Prinzips. Seine Bedeutung hat jenseits dieser Praxis keinen identisch bleibenden Bedeutungskern. Es fällt uns schwer, dies zu akzeptieren, weil es so scheint, als ob die Gebrauchsbedeutung ein Prinzip wie die Menschenwürde beliebig verändert. Dies ist nicht so, weil es für die Gebrauchsbedeutung, die gilt, Gründe geben muss. Es kommt darauf an, welche Gründe gelten sollen. Diejenigen, welche die Gebrauchsbedeutung eines Prinzips festlegen, müssen sich darauf einigen, welche Gründe gelten sollen. Da sie sich dabei auf keinen feststehenden Bedeutungskern beziehen können, kommt es darauf an, von welcher Bedeutung des Prinzips sie wollen, dass sie gilt. Auch dafür muss es Gründe geben. Der Wille derer, die festlegen, welche Gründe für welche Bedeutung eines Prinzips gelten, wird uns noch beschäftigen. Wir haben noch zu klären, wie die eben erwähnte Offenheit der Bedeutung bei Prinzipien zu verstehen ist und wie sie aufgehoben werden kann.
Die Offenheit der Bedeutung können wir von zwei Seiten aus beurteilen, vom Dass oder vom Was des Existierenden her. Wir konnten die Lücke bereits bei der Existenz des Guten erkennen. Das ›Gute‹ ist ähnlich wie das ›Widerspruchsprinzip‹ oder die ›Menschenwürde‹ die Bezeichnung eines abstrakten Gegenstands. Von diesem Gegenstand wissen wir nur, dass er existiert, aber nicht genau, was er ist oder bedeutet. Dies ist die eine Seite der Offenheit. Die andere Seite haben wir kennen gelernt, als wir – mit Kripke –die Existenz von fiktionalen Personen annahmen. Über solche Personen erfahren wir etwas aus den literarischen Texten, in denen es sie gibt. Deswegen können wir Hamlet oder Sherlock Holmes beschreiben und ihnen eine Identität geben. Mit diesen identifizierenden Beschreibungen sprechen wir über die prätendierte Existenz dieser Personen. Wir schließen vom Was dieser Personenbeschreibungen auf das Dass der Existenz dieser Personen, also von Bekanntem auf Unbekanntes, wenn man so will. Damit heben wir die Differenz zwischen dem Dass und dem Was der Existenz auf, und die Offenheit verschwindet. Wir müssen uns hier nicht weiter fragen, ob sich Literaturwissenschaftler in den Beschreibungen fiktionaler Personen oder in der Frage ihrer Existenz einig sein müssen.
Im Fall abstrakter Gegenstände können wir die Offenheit der Bedeutung nicht wie bei Hamlet oder Sherlock Holmes aufheben. Wir können nicht vom Was auf das Dass schließen, weil wir das Was nicht genau kennen, sondern nur einen Vorbegriff davon haben. Um die Offenheit aufzuheben, müssten wir umgekehrt vom Dass auf das Was der Existenz dieser Gegenstände schließen. Dies wäre ebenfalls ein Schluss von Bekanntem auf Unbekanntes. Da das Was der Existenz aber nicht im Dass eingeschlossen ist, können wir diesen Weg nicht gehen. Die Annahme der prätendierten Existenz fiktionaler Personen, die Kripke anstellt, wird in den Personenbeschreibungen und deren erzählbaren Geschichten vorausgesetzt. Bei abstrakten Gegenständen können wir diese Voraussetzung nicht machen.
Die Offenheit der Bedeutung, die wir von der Beschreibung fiktionaler Personen her kennen, ist aber im Hinblick auf die Existenzannahme derjenigen der Gebrauchsbedeutung eines Prinzips analog. Die Offenheit der Bedeutung wird durch die Gebrauchsbedeutung vorläufig geschlossen. Wir können vom Was dieser Bedeutung auf das Dass der Existenz des Prinzips schließen. Ähnlich wie wir in literarischen Texten deren Personen kennen, begegnen wir den Prinzipien in wissenschaftlichen Texten. Prinzipien, die wie die Menschenwürde eine praktische Bedeutung für das Leben der Menschen haben, kennen wir aus Gesetzestexten und Kommentaren zu diesen Texten und zur Rechtspraxis. Sie geben Auskunft über die Gebrauchsbedeutung solcher Prinzipien. Niemand würde an ihrer Existenz zweifeln, obwohl wir nur deren Gebrauchsbedeutung kennen. Die Offenheit der Bedeutung fällt nicht auf, weil sie von der Gebrauchsbedeutung vorläufig geschlossen wird. Sie bleibt aber im Hintergrund bestehen und zeigt sich wieder, wenn es darum geht, ob ein Prinzip eine Grundbedeutung oder einen Bedeutungskern hat und ob es dafür ein Identitätskriterium gibt.
Es geht um den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Unsere These ist, dass das, was gilt, diesen Zusammenhang herstellt und dass es dafür Gründe geben muss. Wir haben bereits gesehen, dass wir den Zusammenhang von dem her erkennen, was gilt, und nicht von dem her, was es vorher gibt. Wir verkehren reflexiv das Vorher und Nachher. Wenn das, was gilt, die Gebrauchsbedeutung eines Prinzips ist und darin die Genese an einem bestimmten Punkt zur Geltung wird, können wir das, was ist und was sein soll, rekonstruieren. Wir rekonstruieren dabei die Offenheit der Bedeutung, bevor sie geschlossen wurde, also die Genese eines Prinzips, bevor es galt. Bevor diese Lücke geschlossen wurde, existieren die Bezeichnungen von Prinzipien, die Vorbegriffe und Vorgeschichten ihrer Geltung.
Wenn es um Prinzipien wie die Menschenrechte geht, können wir ihre Genese in der Religions- und Ideengeschichte und in den Epochen der Politischen Geschichte rekonstruieren.102 Wir können erkennen, wie sehr und wie lange diese Rechte verletzt wurden und wie sich der Wille durchsetzte, sie in der Deklaration der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg verbindlich zu machen. Die Historiographie beschreibt die Epochen des Unrechts in der Gegenwart aus der Perspektive dessen, was heute gilt. Aus dieser Perspektive erkennen wir die historischen Tatsachen als ›Geschichte der Menschenrechte‹. Die Menschenrechte stehen für das, was sein soll. Ihre Geltung verbindet ihre Genese mit ihrer heutigen Bedeutung. Die Offenheit der Bedeutung wird durch die heute geltende Bedeutung vorläufig geschlossen. Im Lichte gegenwärtiger Entwicklungen können die offenen Bedeutungen der Prinzipien und der vorläufige Charakter ihrer Gebrauchsbedeutungen erkennbar werden. Dann geht es darum, die Gründe zu prüfen, die ausschlaggebend für ihre Geltung waren. Diese Gründe waren in einer bestimmten Zeit gut und akzeptabel, haben im Licht der Gegenwart aber vielleicht einen Teil ihrer Kraft verloren. Dann geht es darum, Gründe für ihre gegenwärtige Geltung zu finden und sie durchzusetzen.
Prinzipien und Normen sind als Beispiele für den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, gut geeignet. In der Praxis einer Gesellschaft gibt es aber vieles, was gilt, ohne ein Prinzip und nur im übertragenen Sinn eine Norm zu sein. Vieles davon dient dem Bedürfnis nach bleibend Gutem bei mangelndem Wissen über das, was gut ist. Wir können diesen Mangel mit unserer Kenntnis dessen, was nicht schlecht ist, ausgleichen. Dies kann dann auch vorläufig gelten. Dazu gehören Maße und Gewichte oder Konventionen wie das Rechts- oder Linksfahren. Ein Modell alles dessen, was gilt, ist das Recht. Dessen Geltung können wir am Beispiel von Normen verstehen.
Die Geltung vieler Gesetze schützt uns vor Schlechtem, das aus mangelndem Wissen oder aus schlechtem Wünschen und Wollen entstehen kann. In dieser Hinsicht gleichen sich die Geltung des Rechts und der Moral. Auch die Geltung moralischer Standards kann uns vor Schlechtem schützen.103 In den meisten der moralischen Fälle entsteht das Schlechte aber nicht aus mangelndem Wissen, sondern aus schlechten Absichten gepaart mit hinreichend gutem Wissen über die schlechten Folgen des Handelns. Die Geltung rechtlicher Standards ist aber, wie wir noch sehen, von anderer Art als die Geltung moralischer Standards, auch wenn Recht und Moral miteinander verbunden sind.
Der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, ist in allem, was gilt, erkennbar. Eine offene Bedeutung können wir aber nur entdecken, wenn wir zwischen Genese und Geltung unterscheiden können und es eine Gebrauchsbedeutung dessen, was gilt, gibt. Bei Maßen und Gewichten ist diese Unterscheidung möglich, aber unerheblich. Anders ist es bei Wetten. Wenn der Verlierer die Geltung einer Wette bestreitet, kann er in deren Genese nach Gründen suchen oder er hat ›Wette‹ anders als der Buchmacher verstanden.
Die eben erörterte Offenheit der Bedeutung bei abstrakten Gegenständen müsste uns nicht weiter kümmern, wenn sie nichts mit lebenswichtigen Ansprüchen zu tun hätte. Wenn wir wissen wollen, was das Gute, die Menschenwürde, die Gerechtigkeit und andere Prinzipien bedeuten, geht es um solche Ansprüche. Wenn wir die Bedeutung dieser Prinzipien nicht genau kennen, wissen wir auch nicht genau, welche Ansprüche mit ihnen verbunden sind. Die Unklarheit der Ansprüche kann dazu führen, dass wir sie nicht ernst nehmen oder ihre Existenz bezweifeln. Dann glauben wir auch nicht, dass die Ansprüche gelten.
Überlegungen zum Guten standen am Anfang, weil das Bedürfnis nach dem Guten ein ontologischen Bedürfnis ist; es ist Teil unserer Natur. Für Zweifel an der Existenz dieses Bedürfnisses benötigen wir keine offenen Bedeutungen. Es genügt der Blick auf den biologischen und physischen Verfall des Lebens und die Zerstörung der natürlichen Umwelt und der Veränderungen der Lebenswelt.104 Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem erscheint im Zeitalter der sich immer stärker radikalisierenden Moderne naiv und irreal. Wenn wir nicht auch jetzt wissen könnten, dass es das Gute gibt, wäre dem nichts hinzuzufügen. Gleichwohl wissen wir nicht, was das Gute ist. Auch Platon kann uns dies in den meisten seiner Schriften nicht sagen, obwohl er – und sein Lehrer Sokrates – über kaum etwas anderes nachdenken.105 Erst in den Nomoi beschreibt er das Gute nicht mehr gleichnishaft, sondern konkret wie eine menschliche Naturanlage als »Kraft des gemeinsamen Werdens«.106
Das Bedürfnis zu wissen, was bleibend gut ist, hängt übrigens nicht von individuellen Einstellungen und Neigungen ab. Konservative und Revolutionäre, Agnostiker, Zweifler und Gläubige, Bewahrer und Reformer haben dieses Bedürfnis. Die einen wollen das einmal Gewonnene retten, weil sie es für gut befinden, die anderen glauben, dass das Bisherige dauerhaft beseitigt, zumindest aber so verändert werden muss, dass es endlich gut wird. Etwas bleibend Gutes suchen auch der Reisende in der Ferne und der Nesthocker in der Nähe, ohne es vielleicht jemals dort, wo sie suchen, zu finden.107 Eine Phänomenologie unserer Lebenswelt würde uns auf ernüchternde Weise darüber belehren, dass es über den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, trotz geltender Gesetze keine Einigkeit gibt. Wir mögen uns zwar einig darüber sein, dass sie gelten, aber nicht über das, was gelten sollte. Ähnlich uneinig sind wir in der Frage, was existiert, was es überhaupt gibt und nicht gibt und ob wir sinnvoll von der ›Existenz von Prinzipien‹ sprechen können. Wie wir sahen, ist schon das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem zwiespältig. Es ist auch launisch und wechselhaft, weil seine Erfüllung von den Umständen, in denen wir leben, und dem, was wir aus diesen Umständen machen, abhängt.
Eine Phänomenologie unserer Lebenswelt würde auch zeigen, dass wir des einmal gewonnenen Guten leicht überdrüssig werden. Wir wollen dann etwas Neues und Anderes, von dem wir aber immer noch erwarten, dass es dauerhaft gut sein wird. Wir erwarten – utopisch – eine bessere Gegenwart in einer Zukunft, die wir gar nicht haben. Diese Erwartung ist nicht der einzige Grund für die hemmungslose Ausbeutung des Planeten Erde. Die Sucht nach dem Besseren setzt den Überdruss am bisherigen Guten voraus. So widersinnig es erscheinen mag, es gibt trotz dieser gegensätzlichen Einstellungen und Launen einen gemeinsamen Nenner für die Zufriedenen und die Unzufriedenen, für die Gefährder, Zerstörer und für die Bewahrer der Umwelt, nämlich die Hoffnung, dass wir Menschen irgendwann in guten, gerechten und menschenwürdigen Verhältnissen leben können. Ob mit dem ›wir‹108 alle Menschen gemeint sind, bleibt nicht nur offen, sondern ist zweifelhaft.
Wir nehmen an, dass sich die Hoffnung auf ein gutes, menschenwürdiges Leben nur erfüllen kann, wenn wir über die biologischen, natürlichen Bedingungen unseres gemeinsamen Lebens hinaus gute und gerechte Lebensbedingungen schaffen. Wie können sie aber gut und gerecht sein, wenn sie nicht für alle Menschen und überall auf der Welt gelten, und ist dies überhaupt möglich? Die Forderung nach einer allgemeinen Geltung solcher Lebensbedingungen, so utopisch sie sein mag, ist unverzichtbar, wenn wir das Bedürfnis nach Gewissheit und Sicherheit, nach dauerhaft guten und verlässlichen Lebensbedingungen nicht auch für uns selbst preisgeben wollen.
Eine Phänomenologie unserer Lebenswelt würde auch zeigen, dass das Bedürfnis nach einem guten, menschenwürdigen Leben in dem Maße zunimmt, in dem wir fürchten, dass sich unser Leben in gefahrvoller Weise verändert und Ungewissheit und Unsicherheit zunehmen. Wir wollen uns auf das, was gilt, auch bei eingeschränktem Wissen verlassen können. Die anfänglichen Zweifel hindern uns daran nicht, weil die Unzuverlässigkeit und der Mangel an Wissen das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem nicht verhindern und nicht unmöglich machen. Es ist uns aber auch klar, dass wir uns von unserem Bedürfnis nach Gewissheit leicht trügen lassen können, weil wir unabhängig von der Gewissheit des Wissens ein Gefühl der Gewissheit haben. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass dieses Gefühl der Gewissheit häufig umgekehrt proportional zu dem ist, was wir tatsächlich wissen. Je weniger wir wissen, desto sicherer – oder auch unsicherer – fühlen wir uns, bis wir dann von dem überrascht werden, was wir hätten wissen können oder sollen.
Jeder Einzelne hat auf seine Weise ein Bedürfnis nach dauerhaft Gutem und Verlässlichem, sei es nach Liebe, nach einem guten Leben mit anderen, nach Gerechtigkeit, Freiheit, Erfüllung, Glück, Gesundheit, Arbeit, Erfolg und Anerkennung durch die Anderen, nach sauberem Wasser, gesunder Nahrung und guter Luft. Wie stark diese Bedürfnisse sind und wie sehr sie miteinander zusammenhängen, fällt uns oft erst dann auf, wenn sie enttäuscht werden oder unerfüllbar geworden sind. Niemand wird bezweifeln, dass das Bedürfnis nach einem guten, gesicherten Leben von Bedingungen abhängt, die ihrerseits gelten und dauerhaft und verlässlich sein müssen. Anders kann ein gutes Leben nicht gelingen, geschweige denn gesichert werden. Diese Bedingungen sind ihren Bezeichnungen nach bekannt. Wir haben Vorbegriffe davon und ahnen, was sie bedeuten.
Die eben angebotenen skizzenhaften Überlegungen zu dem, was eine Phänomenologie unserer Lebenswelt zeigen könnte, sind Vermutungen, die wir hier nicht bestätigen können. Wir müssen sie auch nicht bestätigen, weil sie auch dann, wenn sie bestritten würden, eine Vorstellung davon vermitteln können, dass der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, nicht nur einer sein kann. Es sind ebenso viele Zusammenhänge, wie es Bereiche unserer Lebenswelt gibt in Politik, Recht, Moral, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur und Religion.
In jedem dieser Bereiche werden Zusammenhänge zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, hergestellt. Oft geht es darum, mit dem, was gilt, Schlechtes zu verhindern und Schaden abzuwenden, um ein gutes Leben zu ermöglichen. Nichts liegt deswegen näher, als von der Moral, dem Recht, der Politik, den Naturwissenschaften, der Wirtschaft und den Religionen zu erwarten, dass sie zur dauerhaften Sicherung der Bedingungen eines guten Lebens beitragen. Die rechtsstaatlich organisierte Demokratie stellt ebenso wie unsere Verfassung einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. Nichts anderes tun rechtliche und moralische Standards wie die Freiheitsrechte und die Standards, die im Gesundheitswesen, in den Wissenschaften und in der Wirtschaft, in Handwerk und Industrie, im Schutz der Umwelt und in den Bereichen der Technologie gelten. Wenn wir darüber nachdenken, was diese Standards bedeuten, fällt uns die Offenheit der Bedeutung zwischen ihrer Existenz und dem, was sie bedeuten, auf.
Die meisten Kapitel dieser Untersuchung stellen eine Frage, die wir entweder bejahen oder verneinen. Die Gründe dafür sind nicht unstrittig. Der Gebrauch von Begriffen wie ›Geltung‹ und ›Genese‹ weicht z. B. von der neukantianischen Tradition dieser Begriffe ab.109 Begriffe wie die ›Nicht-Reflexivität‹ finden wir nicht wörtlich, aber in analoger Bedeutung bei früheren Autoren. Die meisten geltungstheoretischen Ansätze vor allem in der Rechtsphilosophie kommen nicht nur ohne ontologische Annahmen aus, sondern bestreiten sie. Dies hat Folgen für Begriffe wie ›Tatsachen‹, ›Werte‹ und ›Normen‹. Es war viel von ›Wissen‹ und ›mangelndem Wissen‹ die Rede. Mit dem, was wir wissen, stellen wir einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. Von einer Offenheit der Bedeutung bei abstrakten Gegenständen ist in der geltungstheoretischen Literatur nicht die Rede, und der Wille spielt in dieser Literatur eine untergeordnete oder keine Rolle.
Wir konzentrieren uns nun auf die Frage, ob eine Geltungstheorie ontologische Annahmen benötigt. Kants Geltungstheorie will sowohl in seiner Erkenntnistheorie als auch in seiner Ethik und Rechtsphilosophie ohne solche Annahmen auskommen. Dasselbe trifft auf diejenigen zu, die sich in der Ethik auf ihn beziehen. Hans Kelsen und mit ihm viele Rechtstheoretiker bestreiten die Abhängigkeit geltungstheoretischer Ansprüche von ontologischen Annahmen und vertreten einen Dualismus von Sein und Sollen. Der Prüfung dieser Ansätze dienen die folgenden Teile der Untersuchung. Im letzten Teil geht es darum, wie die offene Bedeutung von Prinzipien wie der Menschenwürde so geschlossen werden kann, dass sie in einer bestimmten Bedeutung gelten. Es geht dann auch um die Bedeutung, die der Wille für das, was gilt, hat.