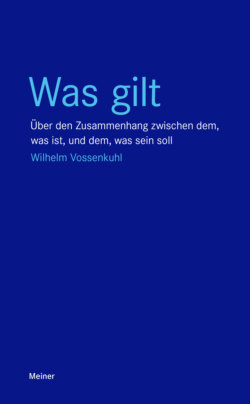Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Ob es ideale Maßstäbe der Geltung gibt
ОглавлениеEs ging um die Frage, wie wir, ohne zu wissen, was gut ist, wissen können, was gut für alle ist. Wir haben gesehen, dass wir zwar nicht wissen, was das Gute ist, aber kontrafaktisch verstehen können, dass es das Gute gibt und dass es in Gestalt eines guten Lebens denkbar und erfahrbar ist. Bliebe es bei diesem Raum von Denkbarem und Möglichem, könnten wir von dem, was gilt, nur Negatives, nämlich nur die Vermeidung von Schlechtem und Falschem erwarten. Das wäre unbefriedigend, weil uns dies zwar hilft, Ungewissheiten in Schach zu halten. Die reflexive Gewissheit macht uns selbstbewusst im Umgang mit Begriffen. Deswegen glauben wir, den Raum des Denkbaren mit positivem Wissen restlos ausfüllen zu können. Wir können aber weder bestätigen noch widerlegen, dass dieser Glaube begründet ist.
Wir haben behauptet, dass die beiden Gewissheiten – die des Todes und der eigenen Existenz – den Rahmen bilden, innerhalb dessen wir überhaupt etwas wissen können, und dass es für diesen Rahmen keine Gründe gibt. Wir haben auch behauptet, dass es für das, was gilt, Gründe geben muss. Sie stellen den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. Es ist selbstverständlich, dass diese Gründe gut und wahr sein sollten, weil es sonst keine zuverlässigen Gründe wären. Deswegen wollen wir wissen, ob es nicht doch eine zuverlässige begriffliche Grundlage für das, was gut und wahr ist, gibt. Mit diesem Wissen könnten wir das, was gilt, solide begründen und rechtfertigen. Dies würde der Auffassung vieler entsprechen, dass es bei der Geltung um einen Rechtfertigungszusammenhang geht, der direkt oder indirekt einen Bezug zur Wahrheit hat.43 Wenn wir zuverlässige Grundlagen der Rechtfertigung hätten, müssten wir uns nicht mit der Vermeidung von Schlechtem und Falschem zufriedengeben. Es wäre auch kein Wille nötig, damit etwas gilt. Die zwingende Kraft rechtfertigender Begriffe würde dafür ausreichen. Das Haus dessen, was gilt, würde, um das Bild Wittgensteins wieder aufzunehmen, von seinen Grundmauern getragen und nicht die Grundmauern vom ganzen Haus.
Ein zusätzliches Motiv für diesen Versuch ist die Unsicherheit, ob Schlechtes zu vermeiden wirklich immer gut ist. Eine schlechte Arbeit kann besser sein als keine. Natürlich kommt es darauf an, was es für eine Arbeit ist, denn nicht jede schlechte Arbeit ist menschenwürdig. Auf der sicheren Seite wären wir, wenn nur das, was wirklich gut ist, und das, wovon wir genau wissen, dass es wahr ist, auch gelten würde. Dann wüssten wir immer, was als ›gut‹ und was als ›wahr‹ gelten kann. Unter diesen wünschenswert erscheinenden idealen Bedingungen wäre es überflüssig, davon zu sprechen, dass etwas ›als gut‹ oder ›als wahr‹ gilt. Es würde genügen zu sagen, dass wir wissen, dass es wirklich gut und wahr ist. Wir würden damit gleichzeitig sagen, dass es gilt, und müssten nicht erst nach Gründen suchen, ob und warum es gilt. Das Gute und die Wahrheit wären die eigentlichen, letzten und zuverlässigen Gründe der Geltung. Es gäbe keine zwiespältigen Auffassungen über das, was gut ist. Wir würden über ideale Maßstäbe der Geltung verfügen.
Hinter der Intuition, dass das, was gut und wahr ist und genau deswegen auch gilt, weil es so ist, steht die naheliegende Vermutung, dass das Gute und die Wahrheit tatsächlich die idealen Maßstäbe der Geltung von Urteilen sind. Das würde bedeuten, dass diese Maßstäbe unabgeleitet gelten würden und ihrerseits keiner Geltung und Begründung bedürften. Sie könnten unabgeleitet die Urteile über das, was gilt, begründen. Das Gute und die Wahrheit wären die Grundlagen der Urteile und hätten damit Vorrang vor deren Geltung. Nehmen wir Urteile der Art ›X ist gut‹ und ›Y ist wahr‹. Dann würde das Gute begründen, warum ›X‹ als gut, und die Wahrheit würde begründen, warum ›Y‹ als wahr gelten kann. Dazu müssten wir aber wissen, was das Gute von ›X‹ und was die Wahrheit von ›Y‹ ist, sonst könnten wir das Gute und die Wahrheit nicht als Maßstäbe für die Begründung von Urteilen heranziehen. Dies scheint plausibel zu sein, ist es aber nicht.
Wenn wir das Handeln einer Person als gut und das, was sie sagt, als wahr beurteilen, ist die Geltung der Urteile von Kriterien abhängig. Es geht deswegen zunächst um die Frage, welche Kriterien wir benötigen und ob diese Kriterien gelten. Eine Handlung beurteilen wir vielleicht als gut, weil sie ein Gebot erfüllt oder jemandem nützt. Dann wären das Gebot oder der Nutzen die Kriterien der Beurteilung. Ob jenes Gebot wirklich gilt oder der Nutzen wirklich ein Kriterium sein kann, wären dann die nächsten Fragen. Wenn wir eine Aussage als wahr beurteilen, nehmen wir dafür vielleicht die Bestätigung durch Zeugen oder die eigene Wahrnehmung oder eine Theorie in Anspruch. Dann wäre die nächste Frage, ob dies geeignete Kriterien für die Wahrheit der Aussage sind. Wir kommen in beiden Fällen nicht umhin, die Geltung von Kriterien zu prüfen. Diese Prüfung wird kaum unstrittig sein, weil die Wahl von Kriterien ihrerseits Gründe voraussetzt. Der Streit darüber, welche Kriterien gelten, kann kein Ende haben. Ob uns etwas zwingt, bestimmte Kriterien als unbezweifelbar letzte anzunehmen, können wir im Zusammenhang mit Freges Geltungstheorie besser beantworten als hier.
Wir werden dann auch prüfen, was die Geltung mit der Wahrheit zu tun hat, nicht zuletzt deswegen, weil viele – gerade im Anschluss an Frege – diesen Zusammenhang für grundlegend halten. Es ist aber schon jetzt klar, dass die eben erwähnte Intuition, dass das Gute und die Wahrheit ideale Maßstäbe der Geltung sind, unergiebig ist. Für die Geltung des Rechts können wir weder das eine noch das andere als Ideal voraussetzen. Kein Gesetz können wir auf sinnvolle Weise als ›wahr‹ bezeichnen. Es kann nur wahr sein, dass es gilt.44 Die Geltung des Gesetzes macht diese Wahrheit erst möglich. Gut kann ein Gesetz nur für bestimmte Zwecke sein. Was ›gut‹ über diesen Zweckzusammenhang hinaus für ein Gesetz bedeuten könnte, wissen wir nicht genau. Gesetze halten wir für gut zur Förderung und Sicherung eines gerechten, freiheitlichen und friedlichen Lebens in einer Gesellschaft, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und des allgemeinen Wohls. Auch das sind Zweckzusammenhänge, die das Urteil, dass die Gesetze gut sind, erst ermöglichen. Die Geltung hat – bei Gesetzen – Vorrang vor dem Guten der jeweiligen Zwecke. Dies sind zusätzliche Gründe dafür, der Intuition, dass die Wahrheit und das Gute die idealen Maßstäbe der Geltung sind, nicht zu folgen.
Die intuitive Vermutung, dass die Wahrheit und das Gute die Maßstäbe der Geltung sind, ist in gewisser Weise irreführend. Wer dies noch nicht glauben mag, möge versuchsweise das Gegenteil annehmen, dass also die intuitive Vermutung doch richtig ist. Dann müsste er oder sie auch annehmen, dass all das, was wahr ist, nur gilt, weil es wahr ist, und dass alle Tatsachen genau deswegen als solche gelten, weil sie Tatsachen sind. Ebenso würden er oder sie intuitiv annehmen müssen, dass das Gute gilt, weil es gut ist. Was wäre damit erreicht?
Auf das Wörtchen ›weil‹ folgt gewöhnlich ein Grund für das, was unmittelbar vorher gesagt wurde, aber nicht in den eben erwähnten Sätzen. Wir können das Wörtchen auch weglassen und erkennen dann, dass alle jene Annahmen bloße Tautologien sind. Tautologien erklären nichts. Sie sagen etwas Wahres, aber was sie sagen, entzieht sich einer Prüfung. Dass Tautologien immer unwiderlegbar wahr sind, hilft uns nicht weiter. Es wäre enttäuschend, wenn wir über das, was gilt, nicht mehr sagen könnten als Tautologisches, einschließlich der Tautologie, dass etwas gilt, weil es gilt. Wir werden später sehen, dass diese Tautologie durchaus das letzte Wort haben kann, nämlich genau dann, wenn es wirklich keine erklärenden Gründe mehr gibt oder geben kann für das, was gilt. Dann ist es eben so.
Es bleibt dabei, wir wissen nicht, was wahr und was gut ist, und richten stattdessen das Wissens-Bedürfnis auf die reflexive Klärung dessen, was gilt. Wir können Wittgensteins Einsicht auf seiner Suche nach Gewissheit folgen, dass die Grundmauern der Geltung, das, was ist, und das, was sein soll, vom ganzen Haus der Geltung getragen werden.