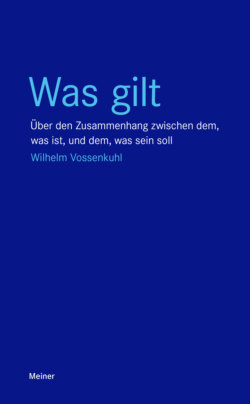Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.7 Ob das, was gilt, existiert
ОглавлениеDa wir das Gute und die Wahrheit nicht als begriffliche Maßstäbe für das, was gilt, heranziehen können, wissen wir über den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, nur, dass es das Gute und deswegen auch gute Gründe für den Zusammenhang gibt. Einen Maßstab gebrauchen wir für dieses Wissen aber, ohne dass wir ihn bisher geprüft haben. Es ist der Maßstab der Existenz. Wenn wir behaupten, dass es das Gute gibt, behaupten wir, das etwas existiert, nämlich das Gute. Auch wenn wir nicht genau wissen, was es ist, wissen wir doch, dass es existiert. Wir behaupten seine Existenz. Deswegen müssen wir klären, was wir da behaupten. Wir behaupten, dass die Existenz von etwas als Tatsache gelten kann.
Schon in der wiederholt gestellten Frage, wie wir, ohne zu wissen, was gut ist, wissen können, was gut für alle ist, verwenden wir das Wörtchen ›ist‹. Das prädikativ gebrauchte Wörtchen ›ist‹ zeigt an, dass möglicherweise auch das existiert, was als ›gut‹ bezeichnet werden kann. Ähnliches können wir über das, was wahr ist, sagen. Über das, was es an Gutem und Wahrem wirklich gibt, können diese vermeintlich idealen Maßstäbe dann doch indirekt eine Bedeutung in unseren Urteilen haben. Wir werden sehen, dass dies zwar zutrifft, aber nicht erklärt, was wir jeweils unter der Geltung von etwas verstehen. Dies liegt nicht am Guten und Wahren, sondern an dem, wovon wir überhaupt sagen können, dass es existiert.
Seit Kants Einwänden gegen den ontologischen Gottesbeweis gibt es den Vorbehalt, dass das Wörtchen ›ist‹ kein Prädikat von einem Ding sein kann.57 Es bezeichne lediglich die Position eines Dings, füge dem Ding aber, wie Kant meint, nichts hinzu, was nicht schon im Begriff des Dings enthalten sei. Versuchen wir, Kant zu folgen, aber dennoch die Bedeutung des Wörtchens ›ist‹ in den Begriff des Guten als begrifflich – vielleicht – unwichtigen, grammatisch aber unverzichtbaren Bestandteil zu integrieren. Kant hat nicht behauptet, dass das Wörtchen bedeutungslos ist. Für ihn hat es die grammatische Funktion der Kopula. Er hat sich im eben erwähnten Zusammenhang nicht dazu geäußert, ob er die Kopula als Teil des Prädikats versteht oder nicht. Da er ›Prädikat‹ wie ›Begriff‹ gebraucht, rechnet er die Kopula wohl nicht dazu. An anderer Stelle der Kritik der reinen Vernunft spricht er vom »Verhältniswörtchen ›ist‹«58 und verwendet das Wörtchen relational und damit prädikativ. Er ist offenbar überzeugt, dass es zum Sprachgebrauch gehört.
Ein Prädikat, so wie wir es verstehen, ist ohne die Kopula aber ebenso unvollständig wie ein Begriff. Vom Begriff der Röte sprechen wir, wenn es für das Prädikat ›ist rot‹ Einsetzungen, also Tulpen, Lippen, Fahrräder etc. nach dem Muster ›es existiert etwas, und das ist rot‹ gibt.59 Deswegen steht der Integration der Kopula in das Prädikat bzw. in den Begriff aus unserer Sicht nichts im Wege. Dann fügt das Wörtchen im Prädikat ›ist gut‹ auch dem Guten nichts hinzu, was nicht schon darin enthalten ist, dass es nämlich existiert. Das Gute kann ebenso wenig wie Gott durch die Existenz-Behauptung prädikativ gemehrt werden.60
Wir scheinen mit dieser Überlegung Kants Argument zu verbiegen, weil er die Existenz Gottes gerade nicht als Teil der ihm zustehenden Prädikate verstanden haben will. Wenn wir uns aber ansehen, was ›bloße Position‹ in Kants Argument bedeutet, sehen wir, dass wir sein Argument keineswegs verbiegen. Wenn die Existenz eines Dings dessen ›bloße Position‹ ist, dann gehört sie zu dem Ding, wenigstens in seiner aktuellen Gestalt.61 Dann ist die Position des Dings neben allem, was darüber gesagt werden kann, auch mit dem Prädikat ›das Ding ist‹ beschrieben. Wenn der Begriff eines Dings – wie Kant meint – alle mit ihm verbundenen Prädikate bereits enthält, dann kann dieses Prädikat nicht ausgeschlossen sein. Die Frage ist aber, was alles an Prädikaten zum Begriff eines Dings gehört und was nicht.
Im Hintergrund der Frage, was zum Begriff eines Dings gehört, steht Kants modale Überzeugung, dass das Wirkliche nicht mehr enthält als das Mögliche, das Denkbare, und dass alles Denkbare bereits im Begriff eines Dings enthalten ist.62 Was immer wir uns an möglichen prädikativen Bestimmungen eines Begriffs denken können, enthält er schon, wie Kant meint. Warum dann nicht auch seine Existenz? Warum sollen wir sie nicht mit dem Begriff eines Dings auch denken und aussagen können?
Wenn wir das Denkbare als das, was vorstellbar ist, verstehen, können wir die eben gestellte Frage ohne Zweifel bejahen. Es ist immerhin vorstellbar, dass das, was ›gut‹ bedeutet, auch existiert. Andererseits ist es nicht vorstellbar, dass etwas – einschließlich mathematischer Beweise und Werken der Kunst – als ›gut‹ beurteilt wird, was nicht existiert. Allerdings gibt es vieles, was nicht vorstellbar, aber möglicherweise denkbar ist. Wir können uns etwa, wie Wittgenstein zeigt, nicht vorstellen, dass etwas gleichzeitig grün und rot ist.63 Wäre es aber nicht wenigstens denkbar? Ist mit dem, was wir uns nicht vorstellen können, auch eine Grenze des Denkbaren erreicht?
Es ist keineswegs sicher, dass die Grenze des Vorstellbaren auch die Grenze des Denkbaren ist. Wir können uns vielleicht mehr denken, als wir uns vorstellen können. Mathematiker und Künstler haben – so dürfen wir annehmen – eine Vorstellungskraft, die nicht jedermann zu Gebote steht. Wenn das so ist, können sie sich mehr vorstellen, als wir uns denken können. Wir werden uns aber darauf einigen können, dass wir ›rundes Viereck‹, ›krumme Gerade‹, ›trockenes Wasser‹ und dergleichen weder denken noch vorstellen, aber dennoch sagen können. Wir dürfen die Verbindung zwischen Denken und Vorstellen aber nicht unbestimmt lassen, wie sich gleich zeigt.
Wir bewegen uns mit dem Gedanken, dass die Denkbarkeit des Guten seine Existenz einschließt, auf dünnem Eis. Wie dünn es ist, wird deutlich, wenn wir überlegen, ob es das Einhorn gibt. Ist es nicht denkbar, dass – analog zur Möglichkeit und Denkbarkeit des Guten – zur Möglichkeit des Einhorns außer dem einen Horn auf der Stirn und seiner Gestalt als schönes weißes Pferd, das sich nicht einfangen lässt, auch seine Existenz gehört? Wir würden uns gerne – wegen der drohenden Abwegigkeit – rasch darauf verständigen wollen, dass – in Kants Sprache – zum Begriff des Einhorns, also zu den eben genannten Prädikaten, die Existenz nicht gehört. Wir wollen einfach nicht glauben, dass die Existenz eines solchen Fabelwesens denkbar ist. Denkbar im Sinn von vorstellbar ist das Einhorn jedoch, wie die eben gebrauchten Prädikate zeigen. Wir wollen uns aber nicht einfach darauf einlassen, dass die Existenz des Einhorns, weil vorstellbar, auch denkbar ist.
Das Einhorn ist wie jedes Fabelwesen mythischer Natur oder dichterisch frei beschrieben, das Gute in einer seiner vielen Gestalten aber nicht, so wollen wir nach den kontrafaktischen Überlegungen annehmen. Wir finden das, was wir als ›gut‹ beurteilen, und erfinden es nicht. Es ist nicht ausgedacht oder konstruiert, sondern real, es existiert als gutes Leben oder als gutes Verhältnis zu anderen Menschen oder als gute Lösung eines Problems. Die Frage ist aber, ob auch ein mathematischer Beweis und ein Kunstwerk als etwas Gutes existiert. Wir finden sie zwar, aber sind sie auch von Mathematikern und Künstlern gefunden oder nicht doch eher von ihnen erfunden? Gleich kommen wir darauf zurück.
So einfach, wie es scheint, ist die Sache offenbar nicht. Wer mit dem Gedanken spielt, dass es Fabelwesen wie das Einhorn gibt, mag zugestehen, dass es dafür Gründe geben muss. Ein Grund könnte sein, dass das Einhorn in der Natur beobachtet und angetroffen werden kann. Die Beobachtbarkeit des Einhorns wäre ein Kriterium dafür, dass das Einhorn nicht frei erfunden ist, sondern tatsächlich physisch existiert. Es mag schwer zu glauben sein, dass ein Einhorn jemals beobachtet werden kann, aber gänzlich auszuschließen ist es nicht. Vielleicht gibt es Einhörner in einer möglichen anderen Welt als der unseren. Der Unterschied zwischen dem nicht-reflexiven ›finden‹ und dem reflexiven ›erfinden‹ ist nicht so klar, wie wir uns einbilden. Dies zeigt das, was Mathematiker beim Beweisen und Künstler beim Schaffen ihrer Werke tun.
Zunächst wollen wir den Gedanken, dass das, was wir als ›gut‹ beurteilen, auch existiert, noch weiterverfolgen. Nehmen wir den Begriff des ›guten Lebens‹. In dieser und in allen anderen Verbindungen von ›gut‹ haben wir es nicht mit Begriffen von Einzeldingen, sondern mit abstrakten Gegenständen zu tun. Wenn jemand, nennen wir ihn Oskar, sagt, er habe ein gutes Leben geführt, meint er damit das Leben, das er tatsächlich führte, ohne dies notwendig auf einen bestimmten zeitlichen Abschnitt seines Lebens einschränken zu wollen. Wir können kaum unterstellen, dass Oskar damit sagen wollte, dass es sein gutes Leben nicht wirklich gegeben habe. Die Existenz ist in der Behauptung des guten Lebens enthalten. Für Oskar gibt es sein gutes Leben. Es ist wahr, wenn er sagt, dass es – für ihn – ein gutes Leben gibt.
Das ›gute Leben‹ ist – als abstrakter Gegenstand – nicht nur kein Einzelding, es ist auch im Unterschied zu Kants Beispiel kein Begriff eines Dings, der alle seine denkbaren Prädikate bereits enthält. Wir wissen nämlich nicht, was Oskar an Prädikaten für die Beschreibung seines guten Lebens gebrauchen würde. Wir wissen aber, dass es sein gutes Leben tatsächlich gibt oder gab. In dem Guten seines Lebens ist das Prädikat seiner Existenz enthalten. Wir können sogar sagen, dass ›Existenz‹ – nicht nur ›gedachte Existenz‹ – ein Merkmal des Guten im Leben Oskars und jeder anderen Person ist, die sagt, dass sie ein gutes Leben führt oder führte. Die Existenz-Behauptung ist daher einer der Maßstäbe dafür, dass die Behauptung Oskars, dass er ein gutes Leben führte, gilt und wahr ist. Bedeutet dies, dass die in der Aussage, dass etwas gut ist, enthaltene Existenz ein Maßstab ihrer Geltung ist? Wenn die Existenz in etwas konkret Beschreibbarem wie dem guten Leben besteht, lässt sich dies kaum leugnen. Da wir aber eben die Existenz von Einhörnern nicht gänzlich ausschließen konnten, ist der Maßstab der Existenz vielleicht zu wenig konkret, um abwegige Annahmen auszuschließen.
Saul Kripke verstärkt diesen Eindruck zunächst. Er denkt wie kaum jemand sonst darüber nach, was existiert oder nicht existiert. Er will dies anhand von Beispielen wie ›Moses existierte‹ oder ›Sherlock Holmes existiert‹ und ›Hamlet existiert‹ klären.64 Er wendet sich zwar nicht direkt oder ausführlich gegen die von Frege und Russell – im Anschluss an Kant – vertretene Auffassung, dass Existenz ein Prädikat zweiter Stufe sei und sich deswegen nicht – wie ein Prädikat erster Stufe – auf Einzeldinge oder Personen beziehen lasse. Dennoch hält er es gegen deren Annahmen für vollkommen gerechtfertigt, Einzeldingen Existenz zuzuschreiben.65
Saul Kripke setzt sich mit der Frage auseinander, ob die eben erwähnten Namen einen Bezug (Referenz) zu real existierenden Personen haben oder leer sind.66 Er ist von ihrer realen Existenz überzeugt und argumentiert, dass die fiktionalen Namen – nicht ›Moses‹, eine Person dieses Namens habe es, wie er glaubt, gegeben – im Rahmen der Geschichte, des Romans oder des Dramas, in denen sie gebraucht werden, einen konkreten Bezug zu Personen haben, über die eine Menge Dinge (Äußerungen, Vorlieben, Kleidung, Gebärden) bekannt sind. Kripke spricht vom Prinzip der Prätention (pretence), das es erlaubt zu sagen, dass etwas als existierend gelten kann.67 Wir können über Personen so sprechen, als ob sie existieren würden, denn es gibt sie in literarischen Texten. Die Existenz dieser Personen wird fiktional prätendiert, als ob sie früher und jetzt existierten.
Fiktionale, dichterisch auftretende Personen wie Hamlet oder Sherlock Holmes existieren demnach in den mit ihrem Namen verbundenen Geschichten, wie Kripke meint.68 ›Hamlet‹ bezeichne zwar eine fiktionale Person, sei aber kein leerer Name. Ähnliches treffe auf ›Sherlock Holmes‹ zu. Es treffe sogar auf abstrakte Gegenstände wie ›Nation‹ zu, sofern ihnen »konkrete Aktivitäten« zugeschrieben werden können.69 Dann existieren auch abstrakte Gegenstände wie ›Begriffe‹ und ›Prinzipien‹. Kripke erweitert den Rahmen, in dem etwas als existierend identifizierbar ist. Er meint, je nachdem wie etwa die Namen natürlicher Arten (›Löwe‹, ›Eichhörnchen‹) gebraucht werden, hätten sie dieselben Eigenschaften wir Eigennamen.70 Fiktionale Personen vergleicht er mit abstrakten Gegenständen und schreibt auch Letzteren eine Existenz zu, wenn mit ihnen konkrete Aktivitäten und Wirkungen verbunden seien. Er will nicht behaupten, dass diese abstrakten Gegenstände eine empirisch feststellbare physische Existenz hätten. Sie hätten aber –wie im Fall von ›Nation‹ – eine bestimmte Kraft, die sich auf das Verhältnis zwischen Menschen auswirke.71 In dieser Weise existieren, wie Kripke meint, auch abstrakte Gegenstände.
Der Existenz von Fabelwesen wie Einhörnern und Drachen gegenüber ist Kripke jedoch zurückhaltend. Wir müssten mehr über ihre »interne Struktur«, also über ihre Biologie, wissen, um ihre Existenz in irgendeiner möglichen Welt behaupten zu können, meint er.72 Die bloße Beobachtung eines Tiers, das so ähnlich aussieht wie ein Einhorn, würde ihm nicht genügen. Es wäre, wie er sagt, ein »Narren-Einhorn«, also das, was wir vor kurzem nicht gänzlich ausschließen wollten und uns jetzt auf die Füße fällt.
Schauen wir einen Moment zurück auf das, was wir im Anschluss an Kant und Kripke zur Existenz dessen, was wir als ›gut‹ beurteilen können, gewonnen haben. Kants Argument vom Sein als bloßer Position eines Dings hindert uns nicht daran, vom Guten in einer bestimmten Gestalt sagen zu können, dass es existiert. Wenn die Existenz ein Merkmal des Guten ist, fügt es ihm im begrifflichen Sinn nichts hinzu, was es nicht schon enthält. Die Wirklichkeit und die Möglichkeit des Guten stimmen in unseren Urteilen über das, was wir ›gut‹ nennen, überein. Kant regt uns unbeabsichtigt zu dieser Überzeugung an.
Mit Kripke können wir vom Guten, obwohl es ein abstrakter Gegenstand und kein Einzelding ist, behaupten, dass es existiert, wenn mit diesem Konzept ›konkrete Aktivitäten‹ verbunden sind. Es sind offensichtlich argumentative Aktivitäten damit verbunden, nicht zuletzt in Platons Dialogen, in denen das Gute eine dialektische Präsenz bei der Suche nach der Wahrheit hat. Selbst wenn das Gute ähnlich wie Hamlet ein fiktionaler Gegenstand wäre, könnten wir ihm zumindest innerhalb der platonischen Dialoge, in vergleichbaren Texten und auch in dieser Untersuchung eine Existenz zuschreiben.
Damit büßen wir aber – so scheint es – die für die Existenz so wichtige Unterscheidung zwischen dem nicht-reflexiven Finden und dem reflexiven Erfinden ein, was wir eben schon im Hinblick auf mathematische Beweise und Kunstwerke vermuteten. Wenn die Prätention der Existenz einer fiktionalen Person – à la Kripke –im Rahmen einer erzählbaren Geschichte ihrer Aktivitäten für die Behauptung, dass sie existiert, reicht, ermöglicht die Erfindung der Person durch den Dichter, dass wir sie als Leser in seinen Texten finden.73 Ähnliches würde doch wohl auch für die Beweise von Mathematikern und für Kunstwerke zutreffen. Wir finden sie, aber die Mathematiker und Künstler sind ihre Schöpfer und Erfinder und Beweise und Kunstwerke wären reflexive Leistungen und würden als solche vielleicht – so absurd dies erscheinen mag – nicht existieren. Wenn es so wäre, wäre das, was die einen erfinden, das, was die anderen finden. Dies hätte aber, abgesehen von der erwähnten Abwegigkeit, unangenehme, unerwünschte Folgen. Wir müssen uns daher überlegen, ob der schöpferische Prozess wirklich ein reflexiver oder nicht doch ein nicht-reflexiver ist.
Wir würden Mathematik, Literatur und Kunst kaum ernst nehmen können, wenn wir ihre Leistungen als nicht weiter durchschaubare Erfindungen verstehen würden. ›Erfinden‹ in diesem Sinn würde alles Mögliche und Unmögliche, Sinnvolle und weniger Sinnvolle, Geniale und Abstruse einschließen. Physiker können hier mit dem Gedanken behilflich sein, dass die Naturkonstanten, mit denen sie rechnen, nicht theoretisch erfunden, sondern durch Messungen im Rahmen ihrer Theorie, also nicht-reflexiv, gefunden wurden. Wenn wir die Existenz von etwas zuverlässig behaupten wollen, müssen wir ausschließen können, dass das, was die einen auffinden, von anderen auf unseriöse Weise erfunden wurde. Sie könnten uns andere damit täuschen, belügen und in die Irre führen. Wir könnten nicht beurteilen, ob es sich um Täuschungen, Zauberei und Scharlatanerie handelt oder nicht.
Nun ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es schöpferische Leistungen und Erfindungen gibt, die mit Recht genau so genannt werden. Damit lässt sich Geld verdienen, und Patentämter beurteilen, ob etwas wirklich erfunden im Sinne von neu, einzigartig und nicht schon irgendwie vorhanden ist.74 Die Frage ist, was abgesehen von der Erfindung von Patentierbarem ›erfinden‹ im Unterschied zu ›finden‹ bedeutet. Finden muss nicht passiv im Sinn von ›zufällig‹ und ›ohne eigenes Zutun auffinden‹ sein, wie man vielleicht meinen würde, sondern kann das Ergebnis eines aktiven Suchens, etwa nach dem verlegten Hausschlüssel, sein. Man kann auch etwas nicht Gesuchtes finden, was sich dann als Glücksfall herausstellt, einen Freund oder eine spätere Partnerin.75
Kant erklärt, was künstlerisches ›Finden‹ bedeutet. Das künstlerische Genie, schreibt er, gebe »der Kunst die Regel«.76 Das klingt theoretischer, als es gemeint ist. Das Genie habe die natürliche Begabung, das »Talent«, etwas Exemplarisches, Besonderes, Originales zustande zu bringen, nämlich dem, was es sich vorstellt, einen Ausdruck zu geben.77 Wie es diesen exemplarischen Ausdruck findet, wisse es selbst nicht, so Kant. Es ist deswegen nicht sinnvoll zu fragen, was es sich bei seiner Kunst gedacht hat. Das Kunstschaffen ist offenbar kein reflexives, begrifflich transparentes Tun. Dabei könne es, wie Kant ergänzt, auch »originalen Unsinn« geben, aber »exemplarisch«, mustergültig und nicht nachahmend müsse es sein. So beschreibt er auf überzeugende Weise die schöpferische Seite des künstlerischen Ausdruck-Findens.78
Wenn wir nun als Betrachter ein Kunstwerk anschauen und beurteilen, finden wir auch etwas. Dieses Finden ist ebenfalls nicht passiv, weil wir uns, wenn wir Kant folgen, selbst eine Vorstellung von dem Werk machen müssen, um es ästhetisch beurteilen zu können. Im ästhetischen Urteil werden wir als Betrachter mit dem Urteil des Künstlers übereinstimmen, wenn wir – was wir hier nicht im Einzelnen tun – die von Kant vorgeschlagenen vier »Momente«79 des Geschmacksurteils genau beachten. ›Finden‹ bedeutet dann ›ästhetisch Urteilen‹. ›Erfinden‹ und ›Finden‹ sind in Kants Auffassung des künstlerischen Genies und des ästhetischen Urteilens dasselbe, außerdem sind beide Aktivitäten nicht-reflexiver Natur. Künstler finden die Gestalt, die sie ihrem Werk geben. Sie und wir finden ein ästhetisches Urteil darüber. Beides ist unbeliebig, vor allem dann, wenn wir das Finden angelehnt an Kants Ästhetik verstehen.
Es gibt aber auch das reflexive Erfinden, und zwar in mehrfacher Bedeutung. Es gibt das Erfinden von Ausreden, Täuschungen und Lügen. Diese Art von ›Erfindung‹ gaukelt die Existenz von etwas vor, was es nicht gab oder gibt, mit schmeichelnder, lauterer oder unlauterer Absicht. Dann gibt es angelehnt an bereits vorhandenes Wissen das reflexive, begrifflich transparente Erfinden von Erklärungen für etwas, was wir bisher nicht verstanden haben. Wir würden seriöse Erklärungen im Rahmen und auf dem Hintergrund von Theorien aber kaum als ›Erfindungen‹ bezeichnen, sondern eher dem ›Finden‹ zurechnen. Insofern gibt es auch ein reflexives Finden innerhalb von Theorien oder erklärenden Zusammenhängen. Wer mehr weiß und versteht, findet auch mehr.
Hamlet und Sherlock Holmes sind fiktionale Personen, die in lauterer Absicht in dem Sinn, den wir mit Kants Hilfe beschrieben haben, nicht-reflexiv erfunden wurden. Shakespeare und Conan Doyle wollen uns mit ihren Figuren nichts vorgaukeln, uns nicht in die Irre führen, sondern unterhalten oder über menschliche Schicksale aufklären. Mathematische Beweise oder wissenschaftliche Erklärungen wollen uns gewöhnlich nicht unterhalten, sondern Lösungen anbieten und aufklären. Nicht immer können wir die Lösungen beurteilen und wissen deswegen nicht, wie sie gefunden wurden und ob sie nicht vielleicht fiktiv sind. Sie sind, sofern sie an Früheres und Bekanntes angelehnt sind, reflexiv erfunden, und wenn sie etwas Neues bieten, sind sie gleichzeitig nicht-reflexiv gefunden worden. Sie existieren jedenfalls. Wir können das, was existiert, nicht allein dem Nicht-Reflexiven zuschreiben und dem Reflexiven verweigern.