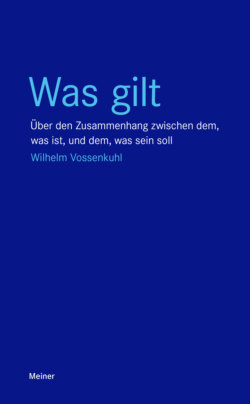Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Ob es ein ontologisches Bedürfnis gibt
ОглавлениеDie Gründe, die wir Menschen für das, was gilt, erkennen, sind nicht immer so zuverlässig wie bei Naturgesetzen, Versprechen und Verkehrsregeln. Wir verbinden das, wovon wir glauben, dass es ist, mit dem, was wir für gut halten und deswegen sein soll. Wir können über beides irren. Das, was wir für gut halten, ist nicht immer gut, wie wir häufig erfahren. Nicht einmal der Friede oder die Liebe sind immer gut, geschweige denn dauerhaft. Den Unterschied zwischen dem, was gut ist, und dem, wovon wir glauben, dass es gut ist, sollten wir kennen, bevor etwas gelten soll. Wir kennen den Unterschied aber nicht genau, auch wenn wir uns sicher sind, dass wir uns nicht täuschen. Deswegen können wir mit dem Unterschied auch nicht argumentieren und das Wissen nicht gegen den Glauben ausspielen. Mehr als glauben, dass etwas existiert und gut ist, können wir nicht, wohl wissend, dass wir uns täuschen können.
Menschen haben ein Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, selbst wenn sie nicht wirklich wissen, was es ist.16 Beides wird ihnen bewusst, wenn es ihnen nicht gut und anderen besser geht. Was für die einen gut ist, kann anderen fehlen. Deswegen muss das, was für die einen gut ist, nicht für alle gut sein. Was gut und gerecht für die einen ist, kann für andere ungerecht und ein Grund für Neid, Missgunst und Hader sein. Das eigene Bedürfnis nach dauerhaft und verlässlich Gutem ist daher zwiespältig und kein Maßstab für das, was für alle gut ist. Manche haben dieses zwiespältige Bedürfnis gerade dann, wenn sie sich das, was für sie selbst gut ist, auch selbst erworben haben. Dann glauben sie, dass ihr Bedürfnis, dass das, was für sie gut ist, dauerhaft so bleibt, auch gerecht ist, obwohl es anderen schlecht geht.
Es läge nahe, das Bedürfnis, dass das, was gut ist, so bleibt, ›egoistisch‹ zu nennen, weil es zwiespältig ist. Das wäre vorschnell und unbedacht. Denn dieses Bedürfnis ist keine Einstellung, die gegen bessere Einsicht zu Lasten der anderen gewählt wird. Das Bedürfnis ist natürlich und hat einen nicht-reflexiven Charakter.17 ›Nicht-reflexiv‹ bedeutet, dass es zwar gedacht wird, aber nicht durch das eigene Denken entsteht und auch nicht Ergebnis des Nachdenkens über sich selbst, über andere und die Welt ist. Es ist einfach da, es ist vielfältig, und jede Person hat es. Wir können dieses Bedürfnis auch korrigieren. Dies ist bei einem anderen natürlichen Bedürfnis, demjenigen, Schmerz zu vermeiden und Lust zu empfinden, nicht so. Dieses Bedürfnis kann von vornherein nicht dauerhaft befriedigt werden; es ist auch nicht zwiespältig, weil die Lust des einen nicht der Schmerz des anderen sein muss. Das Bedürfnis nach Lust darf mit dem Bedürfnis nach bleibend Gutem nicht verwechselt werden.
Der Zwiespalt des Bedürfnisses nach bleibend Gutem ist im Verhalten von Individuen und Gruppen zueinander und in den Konflikten und Spannungen zwischen ihnen erkennbar. Menschen können aber auf einen Teil dessen, was sie für gut halten, zugunsten anderer verzichten, wenn sie erkennen, dass es anderen fehlt. Als natürliche Einstellung ist das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem weder egoistisch noch ein Bedürfnis nach Lust. Auch kranke und behinderte Menschen haben das Bedürfnis, dass das, was für sie gut ist, dauerhaft so bleibt, auch wenn es ihnen schlechter als anderen geht.
Es geht um den Zusammenhang zwischen dem, was ist, mit dem, was sein soll, durch das, was gilt. Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, das ontologische Bedürfnis, stellt zwar bei jedem einzelnen Menschen jenen Zusammenhang her, ist aber zwiespältig und kann nicht für alle gelten. Deswegen kann das individuelle ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem das, was für alle gelten kann, weder begründen noch dauerhaft sichern. Dafür müssen äußere Bedingungen für alle gelten, und diese Bedingungen müssen so dauerhaft und verlässlich wie eine Verfassung sein, die einer Gesellschaft ihre Ordnung gibt. Ohne solche äußeren Bedingungen, die dem Leben einer ganzen Gesellschaft Stabilität geben, können Menschen nicht gut leben, unabhängig davon, was sie für gut halten. Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem wäre ohne solche Bedingungen für alle enttäuschend und von vornherein eine Illusion.
Die Stabilität äußerer Lebensbedingungen ist aber kein Garant für die Qualität dieser Bedingungen. Was gerecht und gut für die einen und ungerecht und schlecht für die anderen ist, kann durch eine äußere Ordnung dauerhaft so sein. Wenn es dabei bleibt, ist die Ordnung schlecht und die Menschen leben nicht mehr in einer, sondern in mehreren, unverbundenen Wirklichkeiten. Eine schlechte Ordnung ist für viele Menschen, die in ihr leben müssen, keine Ordnung, sondern Unordnung und Unrecht und Ursache ihrer Leiden. Kann eine schlechte Ordnung dennoch gelten? Sie kann offenbar in Kraft sein, wie die Geschichte zeigt, sollte aber nicht gelten. Der Zwiespalt des Bedürfnisses nach dauerhaft Gutem kann sich einerseits in dem, was gilt, fortsetzen. Andererseits kann nur das, was gilt, die ungute Wirksamkeit des zwiespältigen Bedürfnisses nach dauerhaft Gutem kontrollieren und einschränken. Wenn die geltende Ordnung selbst gut ist, kann das Bedürfnis aller nach bleibend Gutem befriedigt werden, so hoffen wir.
Wäre das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem nicht zwiespältig, würden wir alle nach demselben Guten streben. Daraus könnte unmittelbar eine gute Ordnung für alle erwachsen, eine natürliche gute Ordnung sozusagen. Da es aber einen Unterschied zwischen dem Bedürfnis nach dauerhaft Gutem und dem, was für alle gelten kann, gibt, kommt es auf das an, was tatsächlich gilt. Denn nur das, was gilt, kann jenen Unterschied korrigieren und den Zwiespalt der Bedürfnisse entschärfen. Es kommt auf das an, was gilt, damit die existierenden zwiespältigen Bedürfnisse nach Gutem in eine Ordnung integriert werden können, die für alle gut ist. So kann der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, durch das, was gilt, hergestellt werden.
Um dies zu verstehen, könnten wir die geltenden Ordnungen betrachten, die unser gegenwärtiges Leben bestimmen. Es sind Ordnungen der Politik, des Rechts und der Moral, die wir als liberale Ordnungen schätzen und für unverzichtbar halten. Wir schätzen sie, weil es Ordnungen sind, welche die Freiheit des Einzelnen und das Leben aller sichern können. Die Liberalität dieser Ordnungen ist ein Gut, das dauerhaft sein soll. Es ist ein ontologisches Bedürfnis aller Menschen in einer Gesellschaft wie der unseren. Ohne die Dauerhaftigkeit dieses Guts kann das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, das wir als Einzelne und als Mitglieder einer Gesellschaft haben, nicht befriedigt werden. Deswegen wollen wir wissen, wie die Geltung einer liberalen Ordnung dauerhaft gesichert werden kann.
Die liberalen Ordnungen sagen uns aber ähnlich wenig über das, was ›Geltung‹ bedeutet, wie uns der Geschmack eines guten Gerichts sagt, warum es uns schmeckt. Wir müssen in beiden Fällen Maßstäbe kennen, um urteilen zu können. Das Rezept, nach dem gekocht wurde, enthält Maßstäbe des Geschmacks, die allerdings nicht für jeden gelten. Die geltenden Ordnungen enthalten die Maßstäbe ihrer Liberalität, die unabhängig vom individuellen Geschmack für alle gelten sollten. Es sind vor allem Freiheits- und Menschenrechte, der Rechtsstaat, soziale Gerechtigkeit und die demokratische Ordnung, Arbeit und Einkommen, die eine liberale Ordnung ausmachen und ein gutes Leben ermöglichen.
Um die Geltung dieser Bedingungen zu verstehen, genügt es nicht, sie aufzuzählen und zu beschreiben. Wir müssen prüfen, ob der Zusammenhang zwischen dem, was ist – dass diese Maßstäbe gelten –, und dem, was sein soll – was sie bedeuten –, durch die geltende Ordnung auf ähnliche Weise hergestellt wird wie bei einem Versprechen. Eine Ordnung enthält tatsächlich, wenn wir uns die genannten Maßstäbe anschauen, nicht nur ein, sondern viele Versprechen, auf deren Erfüllung die Menschen einen Anspruch haben. Das große Versprechen jeder guten Ordnung ist, dass das ontologische Bedürfnis aller Menschen einer Gesellschaft erfüllt wird. Nur eine Ordnung, die dieses Bedürfnis erfüllen kann, sollte gelten. Wir nehmen an, dass eine liberale Ordnung diesem Bedürfnis gerecht werden kann, weil sie das, was ist, mit dem, was sein soll, auf bestmögliche Weise verbindet. Die Prinzipien dieser Ordnung existieren. Sie sagen auch, was sein soll, wenigstens dem Namen nach. Daran, dass sie gelten, zweifeln wir nicht. Was genau sie bedeuten, können wir nicht sagen. Dies kann uns zu der irrigen Annahme verleiten, dass sie gar nicht existieren. Das Muster dieses Irrtums ist, dass das, was wir nicht sagen können, auch nicht existiert.
Was wissen wir wirklich? Anders als bei einem Versprechen gibt es bei einer liberalen staatlichen Ordnung keinen Sprecher, der sie in Geltung setzt, indem er sagt, was er genau versprochen hat. Deswegen können wir die Geltung ihrer Prinzipien auch nicht – wie in nicht-liberalen, autoritären Ordnungen – auf den Willen einer oder mehrerer Personen zurückführen. Wir verstehen deswegen noch nicht, was ›Geltung‹ für eine liberale Ordnung bedeutet, weil wir nicht wissen, worauf wir sie zurückführen können. Wir verstehen auch noch nicht, was es bedeutet, dass die Prinzipien einer solchen staatlichen Ordnung existieren, und wir wissen nicht, was sie genau sagen. Dies alles versuchen wir aufzuklären. Nur wenn uns dies gelingt, können wir verstehen, wie das, was gilt, den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellen kann.
Wir gehen davon aus, dass das, was gut für das Leben aller ist, zuverlässig gelten sollte. Die Zuverlässigkeit setzt die genannten Maßstäbe und deren Versprechen voraus. Einen dieser Maßstäbe, die Menschenwürde, werden wir später genauer betrachten. Gemessen an dem ontologischen Bedürfnis jedes Einzelnen nach dauerhaft Gutem sind die Maßstäbe einer liberalen Ordnung und deren Geltung aber noch weit weg. Wir sollten erst verstehen, was uns näher als alles andere ist. Es ist das, was wir als zwiespältiges Bedürfnis nach dauerhaft Gutem bezeichneten. Es ist etwas Nicht-Reflexives, etwas, was wir nicht wählen und uns nicht ausdenken, sondern auffinden. Deswegen fragen wir, welche Bedeutung dieses Bedürfnis trotz seiner Zwiespältigkeit im Leben jedes Einzelnen hat. Wir werden sehen, dass sich ein bereits erwähnter Zwiespalt erneut auftut. Es ist der Zwiespalt zwischen Nichtwissen und Wissen, der uns schon beim Guten begegnet.
Ludwig Wittgenstein versucht, uns mit dem grundlosen Glauben vertraut zu machen. Er schreibt in einem der letzten Texte, an denen er gearbeitet hat: »Die Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens einzusehen.«18 Es geht ihm nicht um den religiösen Glauben, sondern um den, der von den Naturwissenschaften durch Experimente in Laboratorien gestützt und Teil unseres Wissens und Weltbilds wird. Er prüft die Rolle naturwissenschaftlicher Experimente bei der Bildung des Wissens und kommt zum Schluss: »Was ich weiß, das glaube ich«19, und für diesen Glauben gibt es keine Rechtfertigung. Wenn wir glauben, was wir wissen, haben wir keinen anderen Grund zu glauben als den Glauben selbst. Das ist gemeint, wenn wir ihn als ›grundlos‹ bezeichnen.