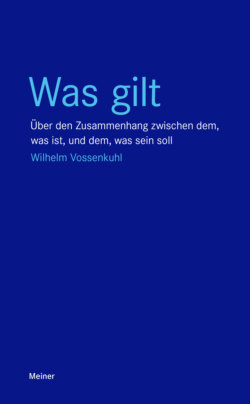Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.10 Ob es Kriterien der Identität von Bedeutungen gibt
ОглавлениеEs kommt darauf an, wofür es überhaupt Kriterien der Identität geben kann. Selbst gemachte Kriterien der Identität sind Definitionen.83 Wenn es sich dabei um Begriffe handelt, sind die Kriterien reflexiver Natur und sagen nichts über das, was es gibt.84 Wenn es sich um reale Gegenstände wie natürliche Arten handelt, sind die Kriterien zwar nicht rein reflexiver Natur, garantieren aber auch nicht, ob die Kriterien für die Identität hinreichend sind.85 Im einen Fall sind die Kriterien, wenn man so will, geschenkt, im anderen leisten sie nicht ganz das, was wir erwarten. Uns interessiert die Identität von Gegenständen besonderer Art, nämlich von Prinzipien, die wir gerade nicht definieren können, deren Identität wir aber als gedachte Bezugspunkte annehmen, auf die wir uns reflexiv beziehen können.
Ein Prinzip wie das des Widerspruchs ist ein abstrakter Gegenstand. Solche Gegenstände haben eine Bezeichnung, die wir ähnlich wie einen Eigennamen gebrauchen, ohne zu wissen, ob wir dies dürfen. Eigennamen stehen nämlich nicht für abstrakte Gegenstände, sondern für Personen oder Einzeldinge. Sie sind die singulären Namensträger und werden mit den Namen tatsächlich identifiziert. Diesen Vorteil der Identifizierbarkeit durch Namen haben abstrakte Gegenstände nicht. Wir können den abstrakten Gegenstand ›Widerspruchsprinzip‹ deswegen nicht so wie die Eigennamen ›Moses‹ oder ›Hamlet‹ verstehen. ›Moses‹ steht für den Mann, der die Israeliten aus Ägypten führte, und ›Hamlet‹ für den melancholischen Dänen-Prinzen im gleichnamigen Drama von Shakespeare. Ein wenig anders ist es bei Einzeldingen, ähnlich wie bei den erwähnten natürlichen Arten. Der Name ›Gabel‹ steht nicht für eine bestimmte, sondern allgemein für ein mehrzinkiges86 Besteck, mit dem wir essen können. Der Name ›Esel‹ steht nicht für einen bestimmten Esel, sondern für alle. Auch Namen wie diese identifizieren etwas, was existiert. Wir wissen, was damit gemeint ist und dass eine Gabel kein Messer oder Löffel und dass ein Esel kein Pferd oder Muli ist, aber auch im übertragenen Sinn für andere Lebewesen gebraucht werden kann.
Die erwähnten Namen identifizieren ihre Träger, wenn sie existieren. Dann sind die Namen Kriterien der Identität ihrer Träger. Wenn Eigennamen wie z. B. Karl Valentins Radfahrer ›Wrdlbrmpfd‹ in einem satirischen Text vorkommen, identifizieren sie eine erfundene Figur in einem solchen Text. Wir neigen dazu, den besagten Namen als leeren Namen ohne Träger zu verstehen. Die Existenz von abstrakten Gegenständen haben wir am Beispiel des Widerspruchsprinzips bereits angenommen. Wir können auch die Existenz von anderen Prinzipien annehmen, vor allem dann, wenn sie sich ähnlich wie Kripkes Beispiel ›Nation‹ auf die Verhältnisse zwischen Menschen auswirken. Viele politischen und rechtlichen Prinzipien haben diese Wirkung. Ein Prinzip wie die Menschenwürde hat eine bestimmte Kraft, die sich auf die Verhältnisse zwischen Menschen auswirkt, nicht zuletzt in der Rechtspraxis. Wir können deswegen sagen, dass das Prinzip der Menschenwürde existiert. Unklar ist aber, welche Bedeutung der abstrakte Gegenstand ›Menschenwürde‹ hat und wie wir sie identifizieren können. Die Bezeichnung ist kein Eigenname und identifiziert keinen einzelnen Träger.87 Für die Existenz eines solchen Gegenstandes genügt es, dass wir auf seine Wirkungen verweisen können. Die Identität seiner Bedeutung können wir mit diesem Hinweis aber nicht feststellen, weil die Bezeichnung keinen Träger hat.
Wenn die Identität der Bedeutung eines abstrakten Gegenstands wie ›Menschenwürde‹ von einem Träger abhängig wäre, dieser Träger aber wie im Fall von ›Wrdlbrmpfd‹ nicht existiert, müssten wir annehmen, dass die Bezeichnung ›Menschenwürde‹ ein leerer Name ist, der für nichts steht. ›Menschenwürde‹ hätte dann keine Bedeutung. Wie kann aber etwas existieren, was keine Bedeutung hat, müssten wir uns fragen. Wenn etwas unter einer Bezeichnung existiert, kann immerhin davon Gebrauch gemacht werden, auch wenn die Bezeichnung keinen Träger identifiziert. Auch ohne einen Bedeutungs-Träger müsste es zumindest eine Gebrauchsbedeutung geben.
Das deutsche Verfassungsgericht und viele, die sich an das Gericht klagend wenden, machen offensichtlich Gebrauch von dem Prinzip der Menschenwürde. ›Menschenwürde‹ ist demnach die Bezeichnung für etwas real Existierendes, für dessen Bedeutung es kein Kriterium der Identität gibt. Stattdessen legt der Gebrauch des Prinzips fest, was es bedeutet. Dann kann sich die Bedeutung dem Gebrauch entsprechend verändern. Ähnlich wie Wittgenstein den Satz ›X existiert‹ als »Satz über unsern Sprachgebrauch«, also über den Gebrauch des Wortes ›X‹ versteht88, können wir sagen, ›Menschenwürde existiert‹ ist ein Satz über den Gebrauch des Wortes ›Menschenwürde‹. Natürlich kann sich dieser Gebrauch verändern. Die Frage ist aber, was sich dabei wie verändert.
Die Bezeichnung des Prinzips bleibt im Gebrauch offensichtlich dieselbe. Wir können die Bezeichnung ›Menschenwürde‹ problemlos in verschiedenen Zusammenhängen auf identische Weise gebrauchen. Wir können z. B. sagen: Wenn Va (das Verfassungsgericht 1991) die Menschenwürde als Prinzip gebrauchte und die Menschenwürde das Prinzip war, das auch Vb (das Verfassungsgericht 2006) gebrauchte, dann gebraucht das Gericht beide Male dasselbe Prinzip. Die Frage bleibt aber, was dabei dasselbe war und ist. Die Identität der Bezeichnung ist zwar wichtig, aber nicht entscheidend, weil wir wissen wollen, welche Bedeutung das Prinzip 1991 und 2006 hatte und ob und wie sie sich in der Rechtspraxis des Gerichts verändert hat. Die Identität des Wortes beim Gebrauch der Bezeichnung sagt darüber nichts.
Alternativ dazu können wir überlegen, ob die Identität der Bedeutung von abstrakten Gegenständen wie Prinzipien nicht unabhängig von ihrem Gebrauch ist. Die Annahme dieser Alternative folgt dem Glauben, dass die Identität der Bedeutung von Begriffen mit Kriterien der Synonymie nachgewiesen werden kann. Wenn dies möglich wäre, müsste sich, um in unserem Beispiel zu bleiben, der Gebrauch des Prinzips der Menschenwürde durch das Verfassungsgericht an solchen Kriterien orientieren. Dann wäre der Gebrauch des Prinzips von der Synonymie des Begriffs ›Menschenwürde‹ abhängig und dessen Bedeutung wäre nicht, wie eben angenommen, von seinem Gebrauch abhängig.
Bedeutungslos kann der Gebrauch des Prinzips für das, was es bedeutet, aber nicht sein. Schließlich verwenden wir ›Menschenwürde‹ in dem Satz ›Personen zu instrumentalisieren verletzt ihre Menschenwürde‹ anders als in dem Satz ›Menschenwürde ist ein Standard der Humanität‹ oder in dem Satz ›Menschenwürde ist ein Prinzip der Verfassung‹. Im ersten Fall verwenden wir ›Menschenwürde‹ wie ein reales Prädikat, das wir Menschen zuschreiben, in den beiden anderen Fällen sagen wir etwas über diesen Begriff. Es ist dabei offen, worauf sich die Bezeichnung ›Menschenwürde‹ bezieht. Auch der Versuch, die Bedeutung der Bezeichnung an die natürliche Art ›Mensch‹ zu binden, scheitert, weil die biophysischen Merkmale der natürlichen Art ›Mensch‹ nicht die Bedeutung der Würde festlegen können.
Dies wird klar, wenn wir in den eben erwähnten Beispielsätzen ›Menschenwürde‹ durch ›Mensch‹ ersetzen. Der Mensch ist weder ein Standard der Humanität noch ein Prinzip der Verfassung. Wir kennen offenbar keine Kriterien, die es uns erlauben, die Bezeichnung ›Menschenwürde‹ eindeutig zu gebrauchen, ihm also Vorkommnisse zuzuordnen, die auf ähnliche Weise unter diesen Begriff fallen wie bei den Begriffen natürlicher Arten wie ›Gold‹ und ›Mensch‹. Es ist auch nicht so wie bei Begriffen, die wie ›Glatzköpfigkeit‹ vage sind, aber zwischen Glatze und vollbehaartem Kopf mehr oder weniger eindeutige Grenzen haben. ›Menschenwürde‹ ist nicht vage, weil das, was die Bezeichnung verfassungsrechtlich und ethisch bedeutet, kein Mehr-oder-weniger zulässt.
Die Optionen einer Feststellung der Identität von Bedeutungen sind mit diesen Überlegungen aber noch nicht erschöpft. Es gibt das Kriterium der Identität des Ununterscheidbaren, das auf Leibniz zurückgeht. Wir haben eben schon informell davon Gebrauch gemacht, als es um Synonymie ging. Wir können Leibniz’ Kriterium vereinfacht in einer semantischen Version anwenden. Wenn ein Ausdruck ›x‹ dasselbe wie ein Ausdruck ›y‹ bedeutet, wenn also die Bedeutungen (Extensionen) von ›x‹ und ›y‹ identisch sind, lassen sich beide Ausdrücke in einem Satz ersetzen, ohne dass dessen Wahrheitswert sich verändert. Nun können wir versuchen, dieses Kriterium auf die erwähnten Beispielsätze anzuwenden. Im ersten Satz können wir den Ausdruck ›Menschenwürde‹ nicht durch ›Prinzip der Verfassung‹ oder ›Standard der Humanität‹ ersetzen. Der Satz hätte dann keinen Sinn. Im zweiten und dritten Satz sind die Charakterisierungen dagegen austauschbar. Können wir auf diese Weise die identische Bedeutung der Ausdrücke nachweisen?
Der Nachweis misslingt. Denn es gibt andere Prinzipien der Verfassung wie die sog. Wesensgehaltssperre89, die keine Standards der Humanität sind. Würden wir das Wort ›Wesensgehaltssperre‹ anstelle von ›Menschenwürde‹ einsetzen, hätten die Sätze keinen Sinn. Außerdem ist die Menschenwürde nicht der einzige Standard der Humanität. Wir können daher die Ausdrücke nicht einfach austauschen, ohne dass sich der Wahrheitswert der Sätze, in denen sie verwendet werden, verändert. Deswegen können wir auf diese Weise die Identität ihrer Bedeutung nicht nachweisen. Außerdem ist das Verbot der Instrumentalisierung nicht die einzige Bedeutung von ›Menschenwürde‹.
Das Kriterium der Identität des Ununterscheidbaren können wir nicht anwenden. Dazu müsste erst einmal klar sein, was ›Men-schenwürde‹ bedeutet, d. h. was die Extension dieses Begriffs ist, was alles unter ihn fällt. Ohne diese Klarheit können wir nicht entscheiden, ob dieser Begriff durch einen anderen ohne Veränderung des Wahrheitswerts ersetzt werden könnte. Wenn es Veränderungen und Erweiterungen der Bedeutung von ›Menschenwürde‹ gibt, kann es aber keine definitive, immer gleichbleibende Extension geben. Der Gebrauch des Prinzips, der zu Veränderungen führt, wäre ausgeschlossen.
Wir kennen andere Begriffe oder Bezeichnungen, deren Bedeutungen weder definierbar noch selbstverständlich sind. ›Men-schenwürde‹ zählt ebenso dazu wie ›Freiheit‹ oder ›Gleichheit‹. Die Bedeutung dieser Begriffe liegt nicht auf der Hand und kann beim Hören oder Lesen nicht unmittelbar erfasst werden. Das bedeutet, sie sind nicht durch sich selbst oder intuitiv zu verstehen. Sie benötigen immer eine Interpretation, um verstanden zu werden.90
Was das intuitive Verstehen bedeutet, beschäftigt bereits Aristoteles. Er schlägt vor91, nur die Begriffe als selbstverständlich zu betrachten, die etwas bezeichnen, dessen Gegenteil es nicht gibt. Damit erkennen wir rasch, dass Begriffe wie ›Menschenwürde‹, ›Freiheit‹, ›Gleichheit‹ nicht selbstverständlich sind. Von all diesen Begriffen lässt sich das Gegenteil denken. Wir gehen davon aus, dass die Bezeichnung oder der Begriff ›Menschenwürde‹ für etwas steht, was es gibt.92 Wir wissen nur nicht genau, was es ist.
Eine Variante von Leibniz’ Kriterium für die Identität von Bedeutungen schlägt Rudolf Carnap vor. Er glaubt, dass die Identität der Bedeutung von Begriffen dann gegeben ist, wenn diese »intensional isomorph« seien, wenn wir uns bei Begriffen dasselbe denken. Die Ausdrücke ›7‹ und ›2 + 5‹ sind z. B. intensional isomorph, weil wir uns dasselbe dabei denken, wenn wir mit diesen Ausdrücken rechnen.93 Wenn in dem Satz ›Stephan hat 7 Hühner‹ die Zahl ›7‹ durch ›2 + 5‹ ersetzt wird, ändert sich der Wahrheitswert des Satzes nicht. Zwei ansonsten identische Sätze, in denen ›7‹ durch ›2 + 5‹ ersetzt wird, haben dieselbe Bedeutung, sie sind äquivalent.
Dieses anspruchslose Beispiel leuchtet ein, weil die Eigenschaften der beiden arithmetischen Ausdrücke analytisch klar sind. ›7‹ können wir in ›2 + 5‹ und eine Menge anderer Ausdrücke zerlegen. Carnap verwendet über ein Beispiel dieser Art hinaus auch das Beispiel ›menschlich‹ und bezieht diese Eigenschaft auf Individuen, auf welche die Eigenschaft zutrifft.94 Können wir davon ausgehen, dass wir in den Sätzen ›Hans hat sich menschlich ver-halten‹ und ›Ein Verhalten wie das von Hans ist menschlich‹ beim Wort ›menschlich‹ an dasselbe denken? Wohl eher nicht, weil im einen Fall etwas Lobenswertes, im zweiten etwas Kritikwürdiges gemeint sein kann. Carnap erklärt nicht, was für ›menschlich‹ in-tensional isomorph eingesetzt werden könnte. Es lässt sich auch nichts finden, weil wir ›menschlich‹ nicht so zerlegen können wie ›7‹. ›Menschlich‹ ist nicht analytisch zerlegbar und deswegen können wir uns in verschiedenen Zusammenhängen, in denen das Wort gebraucht wird, auch nicht dasselbe denken. Willard Van Orman Quine setzt sich ausführlich mit Carnaps Auffassung der Synonymie von Bedeutungen auseinander und zeigt, u. a. am Beispiel von ›Junggeselle‹ und unverheirateter Mann‹, dass Carnaps Synonymie-Kriterium nicht haltbar ist.95
Auch Wittgenstein glaubt zunächst ähnlich wie nach ihm Carnap an eine Synonymie von Bedeutungen. Im Tractatus meint er, dass es identische »Wahrheitsgründe« für Sätze gebe, die auseinander folgen (5.11–5.122). Diese Überzeugung hängt mit seiner dort vertretenen Auffassung zusammen, dass es Elementarsätze gibt, die nicht nur wahr, sondern auch die logischen Bausteine96 aller wahren Sätze sind. Später sieht er ein, dass Elementarsätze, wenn es sie überhaupt gibt, nicht den logischen Erfordernissen genügen, die er für sie fordert.97
Befreit von den logischen Ansprüchen an synonyme Bedeutungen kann sich Wittgenstein den Bedingungen zuwenden, die den Gebrauch der Sprache charakterisieren. Er erkennt, dass die Bedeutung von Wörtern durch ihren Gebrauch in der Sprache bestimmt ist.98 Das gilt natürlich auch für Wörter, die wir als Prinzipien verstehen. Sowohl Wittgenstein als auch Quine begründen ihre Zweifel an der Möglichkeit synonymer Bedeutungen primär anhand der scheiternden Anwendung der analytischen Standards der Synonymie.99 Die Auffassung Wittgensteins, dass die Bedeutung von Wörtern durch ihren Gebrauch bestimmt ist, macht verständlich, wie sich diese Bedeutungen durch den konkreten Gebrauch verändern. Wir können diese Veränderung als eine ›Relativierung durch Konkretisierung‹ verstehen. ›Relativ‹ bezieht sich auf die Zusammenhänge, in denen Begriffe wie ›Menschenwürde‹ gebraucht werden, also auch auf Zusammenhänge in der Rechtspraxis oder in der Ethik.
Wenn wir Wittgensteins Überzeugung, dass Begriffe ihre Bedeutung immer in einem Zusammenhang haben, in dem sie gebraucht werden, folgen, stehen wir aber vor einem neuen Problem. Denn es liegt nicht auf der Hand, was dies bedeutet. Wenn die Praxis des Sprachgebrauchs die Bedeutungen der Wörter und Sätze bestimmt, haben wir nichts Festes, keine festgelegten Strukturen etwa in Gestalt einer Grammatik oder eines Regelsystems in der Hand, weil sich die Praxis selbst nicht durch Definitionen festlegen lässt.100 Aus diesem Grund können wir uns nicht mit einem wohldefinierten Bedeutungssystem, das eine Theorie der Gebrauchsbedeutung versprechen würde, gegen naheliegende Einwände wehren. Es gibt keine Theorie der Praxis des Regelfolgens, obwohl es viele Versuche gibt, eine solche Theorie zu entwickeln.101 Weil es keine Theorie dieser Art gibt, kann die Gebrauchsbedeutung von Prinzipien die Identität ihrer Bedeutungen theoretisch nicht sichern.