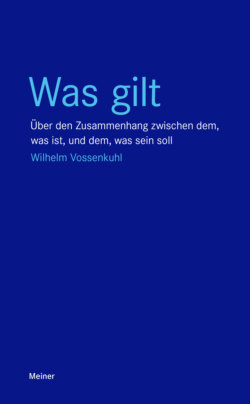Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. WAS GILT?
ОглавлениеIn der Philosophie liegt die Schwierigkeit darin, nicht mehr zu sagen, als wir wissen.
(Ludwig Wittgenstein)
Es geht in dieser Untersuchung um das, was gilt. Der Grundgedanke ist, dass das, was gilt, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt. Dieser Zusammenhang ist aber nicht offensichtlich. Behauptungen scheinen doch einfach deswegen zu gelten, weil das, was behauptet wird, der Fall ist. Es scheint aber nur so, als würde das, was ist, allein für die Geltung von Behauptungen ausreichen. Tatsächlich gelten sie aber nur, wenn sie wahr sind. Aussagen sollten wahr sein, damit sie als Behauptungen gelten können. Behauptungen stellen also doch einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Anders scheint es sich zu verhalten, wenn es nur um das geht, was ist, ohne dass darüber etwas behauptet wird. Könnten wir nicht wenigstens dann sagen, dass das, was ist, gilt, ohne in einem Zusammenhang mit dem, was sein soll, zu stehen? Denken wir an die vielen Entdeckungen über die Natur und ihre Gesetze. Was entdeckt wurde, zeigt doch, dass es schon vorher so war. Naturgesetze gelten ja nicht erst, nachdem sie gefunden wurden. Ohne Zweifel. Sie können aber erst dann als Naturgesetze gelten, wenn sie überprüfbar, bestätigt und wahr sind. Sie stellen deswegen so wie andere Behauptungen einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Wiederum anders scheint es sich zu verhalten, wenn nur etwas behauptet wird, was sein soll, ohne dass es einen Bezug zu dem gibt, was tatsächlich der Fall ist. Dann gibt es keine wahren und überprüfbaren Gründe für das, was ›Gesetz‹ genannt und durchgesetzt wird, außer der willkürlichen Macht und Gewalt. Deren reale, alles überwältigende Existenz verhindert die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Unmenschliche, rassistische und diskriminierende Gesetze sind dafür Beispiele. Sie sollten nicht als gültig anerkannt werden, auch wenn sie dem Wortsinn nach ›gesetzt‹ sind.
Es fällt uns nicht leicht, den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, für das, was gilt, zu erkennen. Ein Grund dafür ist, dass wir das, was ist, gewöhnlich auf wahrnehmbare materielle Dinge in Raum und Zeit beziehen. Was auf wahrnehmbare Weise raumzeitlich existiert, hat keinen unmittelbar erkennbaren Bezug zu dem, was sein soll. Sobald wir aber über das, was ist, nachdenken und etwas jenseits der Grenzen unserer Sinne erkennen wollen, können wir den Zusammenhang herstellen. Wir bemühen uns dann, dass unser Erkennen mit wissenschaftlichen Mitteln dem, was ist, angemessen ist. Es soll dem, was ist, angemessen sein, damit es als Wissen gelten kann. Ob dies so ist, hängt von den Hilfsmitteln und Begriffen ab, die wir dabei gebrauchen. Sie existieren zwar nicht so wie die Dinge in Raum und Zeit. Sie existieren aber im Denken und Erkennen und damit ebenfalls in Raum und Zeit.
Es scheint dann so, als ob wir über zweierlei Arten von ›Existenz‹ sprechen, über die Existenz der Dinge und über die Existenz des Denkens. Das wäre unglücklich, weil dann das eine mehr, das andere weniger existent wäre. Tatsächlich könnten wir die beiden Arten der Existenz, wenn es sie gäbe, nicht klar unterscheiden, weil wir nur mit Begriffen beschreiben können, was im raumzeitlichen Sinn der Fall ist. Die Begriffe und Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir das, was ist, beschreiben, existieren sowohl in unseren Beschreibungen als auch in dem, was wir ›äußere Wirklichkeit‹ nennen. Sie normieren das, was wir über die Wirklichkeit denken, und sie gelten dabei. Sie gehören dann nicht nur zu dem, was wir beim Denken und Beschreiben tun, sondern auch zu dem, was ist. Naturgesetze gelten, weil sie wissenschaftlich erklärt werden können. Wir sollten sie beachten, wenn wir die Natur verstehen und beschreiben. Mit Naturgesetzen können wir das Wissen von der Natur begründen. Dieses Wissen stellt, wenn es wahr und begründet ist, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her.
Leichter zu verstehen ist der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, bei jedem Versprechen. Wenn jemand etwas verspricht, existiert dieses Versprechen. Damit gilt die Verpflichtung, es einzuhalten. Ohne die Einsicht in die Verbindlichkeit des Versprechens, ohne den Willen, es zu erfüllen, und ohne das Wissen, wie dies am besten getan wird, kann es aber nicht erfüllt werden. Das Versprechen begründet mit diesem Wissen und Wollen seine eigene Geltung.
Offensichtlich ist der Zusammenhang auch bei Verkehrsregeln oder bei Gesetzen für den Umweltschutz. Der Straßenverkehr gefährdet Menschen, sie sollen aber sicher daran teilnehmen können. Deswegen gelten Verkehrsregeln. Die Zerstörung des Lebensraums der Arten, die Vergiftung der Böden und der Erdatmosphäre gefährden das Leben insgesamt. Dies sollte verhindert werden. Deswegen gelten Gesetze, die genau dies verhindern sollen. Auch das Widerspruchsprinzip stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Etwas ist oder ist nicht, es soll aber nicht beides gleichzeitig vom selben in der gleichen Hinsicht behauptet werden. Die Aussagen über das, was ist, sollen sich nicht widersprechen. Wahres Wissen ist nur möglich, wenn dieses Gesetz beachtet wird.
Der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, ist im Denken der Antike und des Mittelalters durch das Gute gesichert. Die Moderne bezweifelt diesen Zusammenhang und bringt ihn mit dem, was gilt, nicht mehr in Verbindung. Was zusammengehören könnte, ›Sein‹, ›Sollen‹ und ›Geltung‹, oder was mit diesen Worten gemeint ist, zerfällt in der Moderne. Auf einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, scheint es für das, was gilt, nicht mehr anzukommen. Es scheint sogar so, als ob eine rationale Begründung dessen, was gilt, überhaupt erst möglich wird, wenn jene Bereiche streng voneinander unterschieden werden. Eine Folge davon ist der Glaube an den Dualismus von Sein und Sollen, eine weitere Folge ist die Trennung zwischen theoretischer und praktischer Geltung und die noch weiter gehende Trennung der Geltungen von Recht und Moral.
Ein Grund für die strenge Unterscheidung der Bereiche ist das häufig unglückliche, immer wieder enttäuschte Wissen von dem, was den Zusammenhang ursprünglich sichern sollte, vom Guten. Wir kommen aber nicht umhin über das, was gut ist, und das, was wir darüber wissen können, nachzudenken. Wir tun dies wohl wissend, dass wir selbst nicht genau sagen können, was es ist. Es gäbe aber keinen Grund darüber nachzudenken, wenn wir nicht wissen könnten, dass es das Gute wirklich gibt. Dafür benötigen wir aber Argumente. Bei Versprechen, Verkehrsregeln, dem Umweltschutz und dem Widerspruchsprinzip unterstellen wir, dass es gut ist, dass sie gelten, ohne dass wir an die Existenz des Guten denken oder an ihr zweifeln.
Die Identifikation dessen, ›was sein soll‹, mit dem Guten, liegt auf der Hand, darf aber nicht auf das moralisch Gute eingeschränkt werden. Wir denken mit Hilfe von Begriffen und Gesetzmäßigkeiten und halten uns bei dem, was wir tun, an Normen oder auch nicht. Sie gelten und normieren das, was wir erkennen und tun. Es ist gut, dass sie gelten und wir uns an ihnen orientieren. Es ist gut, weil sie den Zusammenhang unseres Denkens und Handelns mit dem herstellen, was ist. Deswegen existieren sie, obwohl sie keine materiellen, sondern abstrakte Gegenstände sind. Sie existieren durch das, was wir denken und tun, in dem Raum, in dem etwas überhaupt gut sein kann. Das moralisch Gute ist darin enthalten, bestimmt diesen Raum aber nicht insgesamt.
Ein weiterer Grund für die erwähnten scharfen Unterscheidungen ist, dass das, was in Raum und Zeit existiert, seit langem ein Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften ist. Ohne an deren Wissen immer teilhaben zu können oder an deren Kompetenzen zu zweifeln, müssen wir aber die Frage, was es gibt, in unserem Leben ständig selbst beantworten. Wir kommen nicht umhin, dies zu tun, auch wenn wir uns häufig irren. Von manchem glauben wir, dass es existiert, obwohl dies nicht der Fall ist. Irrtümer dieser Art können leicht aufgeklärt werden. Weniger leicht aufgeklärt werden kann der Irrtum, dass das, wovon wir nichts wissen, auch nicht existiert. Es kommt also darauf an, wovon wir mit guten Gründen sagen können, dass es existiert.
Noch ein Grund für die Unterscheidungen ist, dass die Frage, was gilt, seit einiger Zeit den Rechtswissenschaften überlassen wird. Dort stellt sich die Frage in gewisser Weise von selbst, aber gewöhnlich unter dem dualistischen Vorbehalt, dass das gesetzliche ›Sollen‹ vom ›Sein‹ getrennt und unabhängig ist. Dabei ist der Zusammenhang dessen, was gilt, mit dem, was ist, und was sein soll, im Recht und in der Praxis der Rechtsprechung offensichtlich. Die Rechtsordnung stellt genau diesen Zusammenhang her. Dunkel und begrifflich undurchsichtig scheint für diesen Zusammenhang die Bedeutung des Willens zu sein. Diese Bedeutung müssen wir aber für das, was gilt, verstehen, wenn informierte Argumente und rationale Begründungen allein die Geltung nicht begründen können. Es spricht einiges gegen den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, obwohl er in allem, was gilt, erkennbar ist. Der Zusammenhang zeigt sich besonders klar und unabweisbar in der menschlichen Praxis. Die Praxis unseres Sprechens und Handeln zeigt, wie wir urteilen und was wir denken, wie wir miteinander umgehen und woran wir uns dabei orientieren. Sie zeigt, was wir für gut und für schlecht halten, wonach wir streben und was wir für verbindlich und gültig halten.
Die Frage, was ›Geltung‹ bedeutet, wird in der Ethik Kants durchaus mit dem menschlichen Willen in Verbindung gebracht, nicht dagegen in seiner Erkenntnistheorie. Kants erkenntnistheoretische Auffassung von ›Geltung‹ hat aber viele Vertreter der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie geprägt. Erkennbar ist dieser Einfluss an zwei Unterscheidungen, derjenigen zwischen ›Geltung‹ und ›Genese‹ und derjenigen zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Beide Unterscheidungen werden im Denken, das Kant verpflichtet ist, nicht in Frage gestellt.15
Wir wollen den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, verstehen, weil er bei allem, was gilt, eine ähnliche Bedeutung hat wie bei einem Versprechen. Außerdem haben wir ein Bedürfnis nach Gutem, und dieses Bedürfnis ist mit der Frage nach dem, was ist, verbunden. Es ist, wenn man so will, ein ontologisches Bedürfnis, das Bedürfnis, dass das, was gut ist, nicht nur existiert, sondern dauerhaft existiert. Was gut ist, soll beständig sein, sei es in Form von Gesetzen oder in Form von Erkenntnissen. Je unbeständiger es ist, desto größer ist das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem. Wir wünschen uns das Gute als etwas Dauerhaftes, obwohl wir nicht genau wissen, was es ist. Das mangelnde Wissen kann uns verleiten, daran zu zweifeln, dass es das Gute gibt. Wir wissen aber häufig, was nicht schlecht ist, und davon wüssten wir nichts, wenn wir wirklich am Guten zweifeln müssten.
In Literatur und Kunst, Geschichtsschreibung, Museen und im eigenen Leben gibt es viele Beispiele für das, was gut, nicht schlecht – und schlecht – ist. Wir wissen, dass Anerkennung, Liebe, Glück, eine verlässliche Partnerschaft, Gesundheit, Arbeit, Eigentum, Sicherheit, eine faire Rechtsordnung, gerechte soziale Verhältnisse, Friede und der Schutz der natürlichen Umwelt zu einem guten Leben gehören. Was und wie viel von alledem das Gute ausmacht, wissen wir aber nicht. Das Gute kann uns als teilbar, aber auch als unteilbar, als etwas Absolutes und als etwas Relatives erscheinen. Für alle diese Merkmale gibt es Beispiele, obwohl sie sich eigentlich wechselseitig ausschließen müssten. Gerade weil wir so viele Beispiele kennen, wissen wir, dass das Gute möglich ist. Jeder hat selbst schon Gutes erfahren und hofft auf mehr. Fragen nach dem, was ist, was sein soll und was gut ist, sind seit jeher Wissensfragen. Mit den Antworten auf diese Fragen können wir begründen, was gilt und gelten sollte. Daran orientieren wir uns. Wir wollen als Erstes wissen, wie wir das, was wir ›ontologisches Bedürfnis‹ nennen, verstehen können.