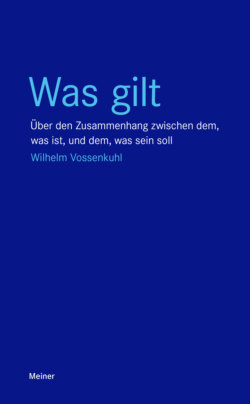Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.9 Ob die Existenz von etwas mehrere Bedeutungen haben kann
ОглавлениеOffenbar existiert beides, sowohl das, was gilt, als auch das, was wir jeweils darunter verstehen. Wir können das, was wir jeweils darunter verstehen, als ›Genese‹ bezeichnen, weil es sich entwickeln und verändern kann. Diese doppelte Existenz von Geltung und Genese scheint kaum haltbar zu sein, weil wir doch – prinzipiell – davon ausgehen, dass es nur eine Wirklichkeit gibt, auch wenn wir sie begrifflich nicht als ganze erfassen können. Wir neigen dazu zu meinen, dass in der einen Wirklichkeit etwas – irgendein ›X‹ – nur in einer Hinsicht existieren kann, weil es eben nur eine Wirklichkeit gibt. Dies ist ein Vorurteil. Wir wissen doch, dass die Venus als Abendstern und als Morgenstern existiert. Der Planet hat zwei Erscheinungsweisen. Sie waren bekannt, bevor das Planetensystem und die Identität der Venus bekannt waren. Diese Erscheinungsweisen sind auch nicht zu bestreiten, nachdem wir sie in die eine Wirklichkeit des Planetensystems und seiner Bewegungen integrieren können.
Wir verstoßen also nicht gegen den Gedanken der einen Wirklichkeit, wenn wir ›Existenz‹ sowohl auf die Tatsache, dass es ›X‹ gibt, als auch auf das, was ›X‹ bedeutet, beziehen. Wenn mit ›X‹ z. B. das Widerspruchsprinzip gemeint ist, wissen wir, dass es dieses Prinzip gibt, und wir wissen, dass es verschiedene Bedeutungen hat. Damit existiert dieses ›X‹ zumindest in drei Versionen, als Bezeichnung des abstrakten Gegenstandes ›Widerspruchsprinzip‹ und in den ontologischen, aussagenlogischen und moralischen Bedeutungen. Das ›X‹ existiert also in mehreren Bedeutungen. Allerdings wissen wir damit Unterschiedliches. Das eine, dass es ›X‹ unter der Bezeichnung ›Widerspruchsprinzip‹ gibt, wissen wir, weil wir mit der Bezeichnung einen Vorbegriff verbinden. Wir wissen auch, was das Prinzip ontologisch und aussagenlogisch bedeutet, dass wir nämlich von etwas nicht in derselben Hinsicht sagen können, dass es ist und dass es nicht ist, und dass wir nicht gleichzeitig von ein und derselben Aussage behaupten können, dass sie wahr und nicht wahr ist. Wir wissen, was das Prinzip moralisch bedeutet, dass wir mit uns selbst einig sein und uns nicht selbst widersprechen sollten. Unter derselben Bezeichnung kennen wir also drei unterschiedliche Bedeutungen und einen Vorbegriff. Denkbar ist, dass es noch weitere Versionen des Prinzips gibt, wenn es mehr als zwei Wahrheitswerte gibt. Wir können, wie es scheint, die Bedeutungen dessen, was unter einer Bezeichnung existiert, beliebig vermehren.
Eine ähnliche Vermehrung der Bedeutungen eines Wortes kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Wir verstehen, was mit ›Bank‹ gemeint ist, nämlich eine Sitzgelegenheit oder ein Geldinstitut oder anderes in Verbindung mit Wörtern wie ›Sand‹ oder ›Spiel‹ oder ›Trainer‹. Diese semantische Vielfalt der Bedeutungen eines Wortes macht uns aber nicht glauben, dass das Wort ›Bank‹ Träger des Kerns der vielen Bedeutungen ist. Wir nehmen an, dass es sich lediglich um analoge Verwendungen des Wortes ohne einen tieferen Bedeutungskern handelt. Schließlich beziehen sich die Prädikate ›ist ein Sitzmöbel‹ und ›ist ein Geldinstitut‹ nicht auf einen identischen Gegenstand. Wenn es aber um ein Prinzip wie das des Widerspruchs geht, nehmen wir an, dass sich die unterschiedlichen Bedeutungen auf ein und dasselbe Prinzip beziehen, also nicht analog, sondern univok.
Wir nehmen an, dass die Existenz des Widerspruchsprinzips nicht-reflexiver Natur ist. Wir finden sie, erfassen sie aber reflexiv, und die Ergebnisse haben nicht dieselbe Bedeutung. Semantisch, ihren sprachlichen Bedeutungen nach, sind die ontologischen, aussagenlogischen und moralischen Versionen des Widerspruchsprinzips nicht univok, sondern analog. Wir können aber sagen, dass sie logisch gesehen univok sind, weil wir allen Versionen – als Vorbegriff – ein und dieselbe symbolische Form geben können, nämlich diese: ¬ (a˄¬a) oder eine mit anderen, aber ansonsten gleich geordneten Symbolen.82 Um dies sprachlich zu verstehen, müssten wir ›a‹ durch ontologische oder aussagenlogische oder moralische Bedeutungen ersetzen. Damit wüssten wir aber nicht mehr als das, was die analogen Versionen bedeuten. Immerhin kann ein symbolischer Ausdruck als Vorbegriff für die Bedeutungen des Prinzips stehen.
Die Differenz zwischen der nicht-reflexiven Existenz des Prinzips und der Existenz der unterschiedlichen Bedeutungen, unter denen wir das Prinzip kennen, können wir reflexiv nicht überbrücken. Wir müssen sie auch nicht überbrücken, weil wir die symbolische Form des Widerspruchsprinzips verstehen. Sie steht für die Existenz dieses Prinzips und damit in gewisser Weise für sich. Wir gebrauchen das Wort ›Existenz‹ einmal für etwas Nicht-Reflexives, was wir auffinden und nur symbolisch darstellen können, und für mehrere reflexiv verstandene Bedeutungen, die wir sprachlich auf analoge Weise mit dem Prinzip verbinden. Dabei unterstellen wir, dass eine einzige symbolisch repräsentierbare Form den analogen Versionen zugrunde liegt, ohne dass wir dies selbst nachweisen könnten.
Die Existenz von etwas kann offenbar mehrere Bedeutungen haben, ohne dass die Einheit der Wirklichkeit in Frage gestellt ist. Wenn wir dies akzeptieren, haben wir aber das eben angesprochene Problem, wie sich verschiedene Versionen eines Prinzips tatsächlich auf dieses eine Prinzip beziehen. Wir haben unserem Beispiel, dem Widerspruchsprinzip, eine symbolische Form gegeben. Diese Form steht als Vorbegriff für die Identität des Prinzips, das von der Verschiedenheit seiner reflexiven Versionen unberührt bleibt. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass wir allen Prinzipien eine symbolische Form geben können, die für deren jeweilige Identität steht. Deswegen fragen wir uns, ob es andere, nicht-symbolische Möglichkeiten gibt, die Identität von etwas zu behaupten. Wir müssen uns auch fragen, ob wir überhaupt auf sinnvolle Weise von der Identität von etwas sprechen können, ganz unabhängig davon, ob es sich dabei um Prinzipien, Begriffe oder andere Gegenstände handelt.