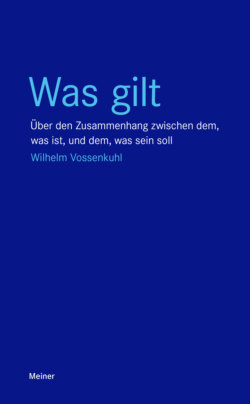Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.8 Ob wir das Mögliche vom Wirklichen her verstehen
ОглавлениеDie bisherigen Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, haben gezeigt, dass es für diesen Zusammenhang keine idealen Maßstäbe gibt. Jedenfalls können die Wahrheit und das Gute nicht als ideale Maßstäbe dienen. Deswegen können sie auch nicht die Gründe für das, was gilt, sein. Es gibt aber einen Maßstab für den Zusammenhang, nämlich die Existenz. Wenn wir behaupten, dass etwas gilt, behaupten wir damit auch, dass es praktisch existiert. Wir behaupten damit, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Wenn der Zusammenhang so wie bei Lügen, Betrug und falschen Versprechen nur scheinbar, aber nicht wirklich existiert, kann er nicht wirklich gelten. Es gibt aber auch den Schein der Geltung wie bei gefälschten Urkunden. Dann ist der Zusammenhang fingiert. Er gilt auch nicht bei Versprechen, die übertrieben sind und nicht eingehalten werden können. Alles das, was den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, bildet, muss existieren und existieren können. Er darf nicht fingiert oder unmöglich sein und er darf nicht nur scheinbar existieren. Was den Zusammenhang bilden kann, wissen wir damit aber noch nicht. Wir wüssten es auch nicht, wenn wir wüssten, was es alles gibt und geben kann. Wir wüssten es vielleicht, wenn wir wüssten, was alles ist und was alles sein soll. Da wir dies nicht wissen, können wir betrogen werden und uns selbst und andere täuschen.
Um zu wissen, was ist und was sein soll, benötigen wir Auswahlkriterien. Es gibt solche Kriterien. Es gibt sie aber erst, wenn etwas gilt oder zumindest klar ist, was gelten sollte, und nicht davor und nicht unabhängig davon. Wir können uns dies am Beispiel von Versprechen klar machen. Wir müssen wissen, was ein ›Versprechen‹ ist und was versprochen wurde, dann haben wir ein Kriterium für die Verbindung zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Das Versprechen normiert diese Verbindung. Wir wissen dann, wie verbindlich das Versprechen ist und was der Fall sein sollte, wenn es erfüllt ist.
Wir können z. B. nur etwas versprechen, was nicht schon erfüllt ist und was möglich80 ist, also das, was wir überhaupt versprechen und dann auch erfüllen können. Eine verheiratete Person kann ihrem Partner oder ihrer Partnerin Treue, aber nicht die Ehe versprechen; sie sind ja schon verheiratet. Versprechen sind prinzipiell verbindlich; sie sollen gehalten werden. Sie werden aber nicht schon gehalten, indem sie geäußert werden. Sie existieren aber mit der Äußerung. Die Existenz des Versprechens als Norm schließt das, was sein soll, noch nicht ein. Dafür muss es eigene Bedingungen geben. Wer etwas verspricht, muss das Versprochene erfüllen wollen und können, aber nicht jede Erfüllung ist angemessen.
Kriterien für das, was aus allem, was ist, und aus allem, was sein soll, so zusammengefügt werden kann, dass es gilt, kennen wir für die Norm des Versprechens. Jedes Versprechen hat mindestens einen Sprecher. Dies ist bei Prinzipien nicht der Fall. Dennoch stellen auch sie mit ihrer Geltung einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. In beiden Fällen enthält das, was gilt, die Auswahlkriterien für das, was sein soll. Das Widerspruchsprinzip wählt z. B. in seiner aussagenlogischen Fassung aus allen Aussagen, die gemacht werden, diejenigen aus, die sich nicht widersprechen. Nur Sätze, die sich nicht widersprechen, sollen geäußert werden, und diese Forderung soll gelten.
Damit ein Prinzip oder eine Norm zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, einen Zusammenhang herstellen kann, muss sie als existierend und als geltend anerkannt sein.81 Es muss aber auch das existieren, was konkret unter die Bedeutung des Prinzips oder der Norm fällt und fallen kann. Beides muss existieren. Die Frage ist, was es zuerst gibt, das, was die Auswahl trifft, oder das, woraus sie getroffen werden kann. Wenn mit dem, was gilt, eine Ordnung hergestellt wird, nehmen wir selbstverständlich an, dass es vor der Ordnung die Unordnung gibt. Wir täuschen uns. Die Unordnung enthält nämlich nicht das Kriterium der Ordnung, sondern nur den Bedarf danach, wenn überhaupt. Eine ungeordnete Menge an Sätzen enthält vielleicht Widersprüche, aber noch keinen Begriff davon. Der Begriff bildet sich, wenn die Unordnung als solche bemerkt und es klar wird, dass es eine Ordnung geben sollte, die Ordnung der widerspruchsfreien Menge von Sätzen. Bevor sie gilt, hat sie eine Genese.
Wir können das Wort ›Genese‹ gedankenlos gebrauchen, dabei vermischen wir Ordnung und Unordnung und suggerieren, dass die Unordnung in der Ordnung ihr Ziel hat. Das hat sie aber nicht, sonst würde – wie das tatsächlich manche biologistisch Denkenden annehmen – aus der Unordnung die Ordnung von selbst, autopoetisch, entstehen. Ob dies biologisch so ist, sei dahingestellt. Aus der Menge an widersprüchlichen und nicht widersprüchlichen Sätzen entsteht von selbst aber keine Menge an widerspruchsfreien Sätzen. Es muss erst ein Prinzip für die Auswahl geben. Daher gibt es zweierlei zuerst, die ungeordnete Menge an Sätzen und das Widerspruchsprinzip. Beides gibt es nicht-reflexiv. Wir finden das eine und das andere und denken dann erst darüber nach. Die Reflexion des Zusammenhangs zwischen beidem ist dann erst das, was wir ›Genese‹ nennen können. Keine Vorgeschichte ist für sich gesehen schon zielgerichtet auf eine bestimmte Geschichte bezogen. Sie kann Vorgeschichte vieler möglicher Geschichten sein. Die Existenz der Genese ist in der Existenz der Geltung nicht enthalten. Auch das Umgekehrte gilt. Eine Genese hat keine kausale Kraft, die unausweichlich zu etwas führt, was gilt. Es würden sonst längst Gesetze zum Schutz der Natur gelten, weil die Genese ihrer Zerstörung offensichtlich ist.
Wenn wir über den Zusammenhang zwischen dem, was es gibt, und dem, was sein soll, nachdenken, gehen wir von dem aus, was gilt und gelten kann. Für die Reflexion muss etwas existieren oder existieren können, was prinzipiell gilt oder gelten kann. Dann können wir wissen, welche Kriterien es für den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, gibt. Wir wissen dann z. B., dass wir nur etwas versprechen können, was es nicht schon gibt. Woher wir das wissen, woher wir also wissen, was ein Prinzip oder eine Norm bedeutet, können wir nicht sagen. Es gibt kein Woher, also keine Begründung für das, was sie bedeuten und auch keine Erklärung dafür.
Dies zeigt das Beispiel des Widerspruchsprinzips. Das Prinzip selbst ist nicht ableitbar, es gilt unabgeleitet, hat eine nicht-reflexive Bedeutung, die wir allerdings reflexiv erfassen können. Deswegen kennen wir unterschiedliche Auffassungen des Widerspruchsprinzips, die jeweils nur in ihrem eigenen Zusammenhang gelten. Das Prinzip existiert also nicht-reflexiv, bevor wir reflexiv wissen, was es bedeutet. Es kommt darauf an, wie wir es reflexiv erfassen, als ontologisches oder als aussagenlogisches oder als moralisches Prinzip, und das eine kann das andere nicht ersetzen oder erklären und deuten. Wir finden ein Prinzip, kennen die Bezeichnung dafür und haben einen Vorbegriff seiner Bedeutung. Erst dann können wir reflexiv erfassen, was es bedeutet oder bedeuten kann.
Ähnlich verstehen wir eine Norm wie das ›Versprechen‹. Wir kennen die Bezeichnung, haben einen Vorbegriff von dem, was sie bedeutet, und können dann aus dem Zusammenhang, in dem etwas versprochen wird, die Bedeutung der Norm verstehen. Wir wissen dann, in welchem Sinn ein Versprechen gilt, wissen aber noch nicht, ob das, was versprochen wurde, überhaupt ein Versprechen ist. Wir können dies nicht allein dem entnehmen, was gesagt wurde. Deswegen gibt es den Unterschied zwischen der sog. lokutionären Bedeutung einer sprachlichen Äußerung, ihrem grammatikalisch geordneten Wortlaut und ihrer illokutionären Bedeutung, das, was mit dem Gesagten gemeint ist. Der Indikativsatz ›Ich zeig’ Dir, wie’s geht‹ kann als Versprechen oder als Drohung gemeint sein.
Prinzipien und Normen können Kriterien des möglichen Zusammenhangs zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, sein. Die nicht-reflexive Bedeutung der Prinzipien erfassen wir reflexiv. Damit machen wir auf reflexive Weise das Nachher, das Wirkliche zum Vorher, zum Möglichen und kehren die zeitliche Folge des Vorher und Nachher um. Das, was prinzipiell gilt, wählt aus dem, was es vorher schon gibt, das aus, was anders als bisher sein soll. Damit eine Auswahl möglich ist, muss es das schon geben, was durch das Prinzip verändert werden soll. Es muss nicht nur alles das geben, was ist, sondern auch das, was sein kann und sein soll. Erst dann kann ein Prinzip das eine mit dem anderen verbinden. Wir wissen aber erst, welche Verbindungen durch Prinzipien möglich sind, wenn wir sie kennen, zumindest einen Vorbegriff von ihnen haben. Die möglichen Verbindungen verstehen wir, wenn wir uns denken können, was sie wirklich bedeuten. Das Mögliche verstehen wir in diesem Sinn aus dem, was wir uns als Wirkliches vorstellen, nicht umgekehrt. Erst wenn wir wissen, wozu uns ein Versprechen wirklich verpflichtet, wissen wir, ob es möglich ist, ob wir es geben können.
Wir können Prinzipen nicht an sich, in ihren nicht-reflexiven Bedeutungen, sondern nur aus den jeweiligen Zusammenhängen ihrer Geltung verstehen. Wir können nicht anders als die zeitliche Folge des Vorher und Nachher reflexiv zu verkehren. Dabei erwarten wir das Umgekehrte, dass wir erst ein Prinzip selbst, so wie es an sich ist, und dann erst seine konkrete Bedeutung verstehen. Wir verstehen ein Prinzip aber erst im Zusammenhang seiner möglichen praktischen Geltung, nicht vorher. Auf dem Hintergrund seiner möglichen Geltung können wir dann darüber streiten, ob es gilt oder nicht. Die Bezeichnungen und Vorbegriffe von Prinzipien reichen dafür noch nicht. Wenn es Streit über ihre Geltung gibt, glauben die einen, dass sie gelten, die anderen glauben es nicht. Es kann aber nicht beides gleichzeitig der Fall sein.
Reflexiv können wir das Vorher und Nachher erst umkehren, wenn wir wissen, was es vor der Geltung eines Prinzips gibt oder gab. Denn nur dann verstehen wir, was mit seiner Geltung verändert werden kann und verändert werden soll. Menschliches Leiden durch Unrecht und Gewalt kann mit der Geltung von Prinzipien wie der Menschenwürde, dem Lebensschutz und der Gleichheit verhindert werden. Dann wird das, was sein soll, nämlich ein Leben ohne Angst, Unrecht und Gewalt durch das, was gilt, möglich. Das Nachher konkretisiert das Vorher. Die reflexive Umkehrung des Nachher zum Vorher, dass wir das, was ist, und das, was sein soll, aus dem verstehen, was gilt und nicht umgekehrt, trifft z. B. auch auf die Geltung naturwissenschaftlicher Gesetze zu. Auch sie stellen einen Zusammenhang her, nämlich zwischen dem, was messbar ist, und dem, was den Naturgesetzen entsprechend der Fall sein soll. Die Gesetze ordnen das Gemessene. Naturgesetze normieren die erklärbare Wirklichkeit, solange sie gelten und nicht widerlegt sind.
Ähnlich können wir die Geltung einer staatlichen Verfassung verstehen. Sie stellt einen Zusammenhang her zwischen den realen Lebensbedingungen einer Gesellschaft und dem, was eine Verfassung aus ihr machen soll, einen rechtlich geordneten Staat. Die Geltung einer Verfassung verstehen wir, wenn wir die Rechtsverhältnisse eines Staates, dessen Rechtspraxis kennen. Auch dies erscheint zunächst wie eine Verkehrung des Vorher und Nachher. Wir können die Prinzipien einer geschriebenen Verfassung, also das, was vor der Rechtspraxis gilt, lesen und interpretieren. Sie existieren tatsächlich in sichtbarer und lesbarer Form vor der jeweiligen Rechtspraxis. Was sie bedeuten, wissen wir erst durch die Rechtspraxis. Zunächst haben wir nur einen abstrakten Vorbegriff ihrer Bedeutung.
Die reflexive Umkehrung des Nachher zum Vorher, dass wir die möglichen Zusammenhänge zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, aus dem verstehen, was wirklich gelten kann und gilt, kann uns den Blick auf die Zusammenhänge, die jenseits davon möglich sind, versperren. Wir stoßen damit an eine Grenze, die wir nicht bemerken, solange das, was gilt, die Erwartungen auf befriedigende Weise erfüllt. Die Geltung des Widerspruchsprinzips versperrt uns keinen Blick auf mögliche andere Zusammenhänge. Wenn wir aber annehmen, dass es nicht nur die zwei Wahrheitswerte ›wahr‹ und ›falsch‹, sondern auch ›unbestimmt‹ als Dritten gibt, werden wir das Prinzip in seiner aussagenlogischen Fassung anders formulieren. Die Geltung des Gleichheitsprinzips würde uns den Blick dafür versperren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, wenn es nur für die Gleichheit von Mann und Frau und nicht für alle Geschlechter gelten würde.
Wir können reflexiv einem geltenden Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, nicht entnehmen, welche anderen Zusammenhänge möglich wären. Es wäre zirkulär, dies zu tun; wir würden uns im Kreis drehen. Das Resultat wäre fiktiv. Wir könnten das, was wirklich gilt, nicht von dem, was nur zu gelten scheint, unterscheiden. Zwischen dem reflexiven Erfassen eines Prinzips und seiner nicht-reflexiven Existenz muss es einen Unterschied geben. Dieser Unterschied ist mit der Unterscheidung zwischen ›Geltung‹ und ›Genese‹ nur dann gemeint, wenn wir – wie eben erläutert – die Genese nicht teleologisch oder kausal auf die Geltung beziehen. Was als Prinzip gilt, existiert, und seine Vorgeschichte existiert auch. Es existiert beides, das, was mit ›Geltung‹, und das, was mit ›Genese‹ gemeint ist, und sie existieren unabhängig voneinander, werden von uns aber reflexiv wie Vorher und Nachher aufeinander bezogen.