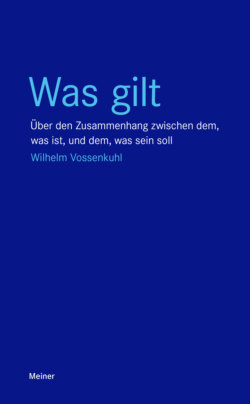Читать книгу Was gilt - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COGITO
Оглавлениеomnia mutantur, nihil interit
(Ovid, Metamorphosen)
Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie«, schreibt Hegel in der Vorrede seiner Rechtsphilosophie.1 So ist es, denke ich. Genau dies ist die Aufgabe der Philosophie. Und Hegel ergänzt, »denn das was ist, ist die Vernunft«. Das kann aber wohl kaum sein, es sei denn, dass das, was ist, etwas ganz anderes ist als das, was uns als Wirklichkeit erscheint. Der unbeherrschte Wandel aller natürlichen und sozialen Lebensbedingungen scheint doch das zu sein, was wirklich ist. Ein äußeres Kennzeichen dieses Wandels ist die Flut von Informationen, die es uns erschwert, Wahres von Falschem und Wissen von Irrtum zu unterscheiden. Es wäre widersinnig anzunehmen, dass diese Wirklichkeit mit allen ihren Erscheinungen »ihren Bildungsprozeß vollendet« hat, wie Hegel sagt.2
Das, was ist, kann nicht nur Wandel und Veränderung sein. Sonst könnten wir nicht zwischen ›ist‹ und ›ist nicht‹ unterscheiden, und das, was ist, nicht von dem, was nicht ist, trennen. Was ist, muss Bestand haben, damit wir es denken und wissen können. Damit es Bestand hat, muss etwas gelten, was die Unterscheidung zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist, möglich macht. Das geltende Maß für diese Unterscheidung ist die Widerspruchsfreiheit. Sie ist nur eine Form für das, was als tatsächlich existierend gelten kann, weil sie nicht sagt, was es alles gibt. Würde sie nicht gelten, könnten wir nicht zwischen ›ist‹ und ›ist nicht‹ unterscheiden. Ohne diese Unterscheidung könnten wir auch nichts über die Wirklichkeit wissen. Also muss dieses Maß gelten, damit wir wissen können, was es gibt. Es ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dieses Wissens. Mindestens die Widerspruchsfreiheit muss gelten, damit wir wissen können, was es gibt.
Nun gibt es aber viel Widersprüchliches, was jenes Mindestmaß nicht erfüllt, wie Irrtümer, Unwahres und Lügen. All das sollte nicht sein. Wenn wir begreifen wollen, was wirklich ist, aber nicht sein sollte, muss mehr als die Widerspruchsfreiheit gelten. Es muss möglich sein, Wahres von Unwahrem und Falschem zu unterscheiden. Was wahr ist, ist selbst ein Maß für die Unterscheidung des Wahren von Falschem. Es ist aber kein Maß für die Unterscheidung dessen, was ist, von dem, was nicht sein sollte. Für diese Unterscheidung benötigen wir ein weiteres Maß, das Gute. Nur was gut ist, sollte sein. Das Schlechte und Widersprüchliche existiert aber dennoch. Dagegen können wir uns mit dem, was gilt, wehren.
Es gibt Unterschiede zwischen der Geltung der eben erwähnten Maße. Sie zeigen sich, wenn wir überlegen, woran wir zweifeln können. Es hat keinen Sinn, am Maß der Widerspruchsfreiheit und an dem der Wahrheit zu zweifeln, weil wir beide Maße benötigen, um zweifeln zu können. Wir benötigen beide Maße auch, damit wir einen Zweifel aufheben können. Anders verhält es sich mit dem Maß des Guten. An diesem Maß können wir leicht zweifeln. Wir können daran zweifeln, dass es dieses Maß gibt, und wir können uns fragen, ob wir es benötigen, um zu begreifen, was wirklich ist. Wer glaubt, dass Wissen wertfrei sein sollte, wird diese Frage verneinen. Unklar bleibt dann aber, wie wir beurteilen können, was ist, aber nicht sein sollte. Wir müssten uns dieses Urteils enthalten.
Wenn wir die Wirklichkeit begreifen wollen, müssen wir verstehen, was gut und was schlecht ist, und dies hängt von dem ab, was gilt. Nur so können wir unterscheiden, und für diese Unterscheidung muss das, was gut ist, im Wandel Bestand haben. Dieser Gedanke scheint aus der Zeit zu fallen, weil er selbst beständig sein soll und sich nicht wandeln darf. Andererseits muss er sich in der Zeit behaupten und kann nicht davor gefeit sein, sich zu wandeln. Dieser Gegensatz zwischen dem, was Bestand hat, und dem, was sich wandelt, wäre ein unhaltbarer Widerspruch, wenn nichts gelten würde, was den Gegensatz aufhebt.
Das, was gilt, zu untersuchen, bedeutet nicht, darüber zu belehren, was alles gelten sollte. Zu wissen, was nicht gelten sollte, bedeutet nicht zu wissen, was gelten sollte. Eine philosophische Belehrung, »wie die Welt sein soll«, käme immer zu spät, wie Hegel in der erwähnten Vorrede schreibt. Er hat Recht. Es kann schon deswegen nicht um eine Belehrung darüber gehen, wie die Welt sein sollte, weil das, was gilt, ja schon in irgendeiner Form existiert, wenn überhaupt etwas gilt. Außerdem ist das, was gilt, kein Resultat der Philosophie. Es ist etwas, was in der mannigfachen menschlichen Praxis zustande kommt, in der sozialen, politischen und ökonomischen Praxis, in der Praxis der Rechtsprechung, in der religiösen und kulturellen Praxis und nicht zuletzt in der Praxis der Wissenschaften. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was ›Praxis‹ bedeutet. Was gilt, ist Resultat einer Praxis und nicht einer Theorie. Dies ist freilich selbst eine theoretische Aussage. Unser theoretisches Verhältnis zur Praxis ist selbst ein Problem, das zu klären ist. Die Praxis des Sprachgebrauchs zeigt, wie das Problem geklärt werden kann.
Was in einer Praxis gilt, enthält viele begründete und nicht begründete Ansprüche. Ein Anspruch, der begründet sein kann, ist, dass das, was gilt, auch tatsächlich gelten soll. Wenn aber das, was gilt, existiert und gleichzeitig gelten soll, fallen Sein und Sollen zusammen. Sie fallen nicht zusammen, wenn das, was ist, nicht gelten soll, wie das Unrecht, das Unglück und die Unmenschlichkeit. Dann sind Sein und Sollen getrennt. Die beiden Begriffe ›Sein‹ und ›Sollen‹ haben eine philosophische Geschichte. Sie spricht seit langem dagegen, dass diese Begriffe überhaupt zusammenfallen können. Wenn sich unsere Lebenswelt tatsächlich fortwährend wandelt, bedeutet dies ja nicht, dass sie sich wandeln soll. Wenn aber etwas gilt, existiert dies nicht nur, sondern es soll auch befolgt werden. Auch die Naturgesetze, die es ermöglichen, das, was ist, zu beschreiben, gelten und verbinden Sein und Sollen. Wenn wir sie nicht als verbindlich ansehen, können wir die Natur nicht zuverlässig beschreiben und nicht wissen, was ist. Mit der bloßen Behauptung, es gebe einen Dualismus von Sein und Sollen, dürfen wir uns im Hinblick auf das, was gilt, nicht abfinden.
Das umstrittene Maß für das, was gelten soll, ist – wie eben erwähnt – das Gute. Was gilt, sollte gut, zumindest aber nicht schlecht sein. Wir Menschen wollen dem, was gilt, vertrauen können. Auch das Gute hat eine philosophische Geschichte. Viele tun sich schwer mit der Frage, was das Gute ist und was ›ist gut‹ bedeutet, weil diese Prädikate nicht definierbar sind. Das Gute erscheint uns heute wie ein Konto aus der Vergangenheit, von dem wir nichts mehr abheben können, weil wir den Zugangscode verloren haben. Dieses Konto ist aber nicht leer. Wir können es genauso aktivieren wie Platon, der noch im Staat für das Gute nur Gleichnisse anbietet, in seinem späten Werk Nomoi aber sagt, dass das Gute die »Kraft des gemeinsamen Werdens«3 ist. Er deutet diese Kraft wie eine menschliche Naturanlage. Es geht darum, die Bedeutung dieser Kraft für das, was ist, zu verstehen. Es geht auch darum zu zeigen, dass es das Gute gibt und dass wir ein Bedürfnis danach haben. Das Gute gibt es nicht als etwas Vollendetes, sondern als Werdendes. Nach dem Werden des Guten in der Praxis unserer Lebenswelt haben wir ein Bedürfnis.
Wenn von ›Geltung‹ die Rede ist, denken wir meist an Gesetze oder Regeln. Wir erwarten, dass das, was gilt, begründet ist. Der Anspruch auf Begründung ist zumindest seit der Epoche der Aufklärung eng mit dem Anspruch auf Rationalität verbunden, weil er sich gegen autoritäres Denken und Handeln richtet. Wir wollen einer Überzeugung nur dann folgen, wenn sie gut begründet ist. Wir halten eine Überzeugung für irrational, für die es keine Begründung gibt. Die rationale Begründung ist ein Anspruch an uns selbst als mündige Bürger in einer offenen Gesellschaft zur Abwehr autoritären Denkens und Handelns.
Begründungen sind nur dann erfolgreich, wenn sie sich auf Prinzipien berufen können. Ein Beispiel für ein einleuchtendes Prinzip ist die erwähnte Widerspruchsfreiheit. Würden wir diesem Prinzip nicht folgen, wären weder wahre Aussagen noch rationale Begründungen möglich. Wir könnten uns dann auf nichts verlassen und könnten irrationalen und autoritären Verhältnissen nichts entgegensetzen. Ein anderes Prinzip, auf das wir uns in einer liberalen Gesellschaft berufen, ist die Menschenwürde. Ohne dieses Prinzip wüssten wir nicht, wie die Unmenschlichkeit und das Unrecht geächtet werden könnten, die unsere jüngere Geschichte zwölf lange Jahre beherrschten.
Für die beiden eben genannten Prinzipien gibt es keine rationalen Begründungen. Die Hinweise darauf, was mit ihrer Geltung vermieden werden kann, sind keine Begründungen, sondern Motive, die Prinzipien anzuerkennen. Die Prinzipien gelten ohne Begründung und das bedeutet, sie gelten unabgeleitet. Wir halten dennoch am Anspruch auf rationale Begründung mit Hilfe dieser und anderer Prinzipien fest. Offenbar müssen wir unterscheiden zwischen den Ansprüchen, die begründbar, und denen, die nicht begründbar sind. Es geht darum zu zeigen, wie wir beiden Ansprüchen gerecht werden können. Die Beispiele in dieser Untersuchung sind die eben genannten, die Widerspruchsfreiheit und die Menschenwürde.
Die Philosophie ist keine Naturwissenschaft4, kann aber dennoch das, was ist, begreifen, weil das Denken ihre Praxis ist. Der Satz des Parmenides, Denken und Sein sei dasselbe5, wurde in der jüngeren Philosophiegeschichte angezweifelt, weil Denken auf Sprache angewiesen ist. Die Sprache erlaubt uns sowohl zu sagen, was ist, als auch, was nicht ist, unabhängig davon, ob dies tatsächlich so ist oder nicht. Die Sprache ersetzt aber nicht das Denken, mit dem wir diesen Unterschied beurteilen und erkennen. Wir erfassen erst etwas mit unserem Denken, drücken es in einer Sprache aus und beurteilen dann, ob es ist und was es ist. Unser Denken ist auf das angewiesen, was wir erfassen können. Die Philosophie kann nur dann die Aufgabe haben, zu begreifen, was ist, wenn der Satz des Parmenides in einer bestimmten Weise zutrifft.
Der Satz des Parmenides präsentiert noch keinen Gegenstand. Wenn er zutrifft, können wir annehmen, dass das Denken die Fähigkeit ist, zu begreifen, was wirklich ist, was ist und was nicht ist. Die Einsicht, im Denken den Ansprüchen von Wissenschaften beim Begreifen dessen, was ist, gerecht zu werden, müssen wir selbst denkend gewinnen. Sonst können wir das, was wir denken, nicht verantworten. Wir benötigen zweifellos die Naturwissenschaften, wenn es darum geht, die Wirklichkeit zuverlässig zu beschreiben. Die Naturwissenschaften können das, was ist, aber nur beschreiben, wenn die Naturgesetze gelten. Das, was ist, ist aber dann nicht naturwissenschaftlich beschreibbar, wenn es um Prinzipien wie die Widerspruchsfreiheit oder die Menschenwürde und deren Bedeutung für unser Leben und Denken geht. Die Philosophie ist eine Prinzipienwissenschaft und damit auch eine Geltungswissenschaft.
In den Rechtswissenschaften geht es um das geltende Recht. Diese Wissenschaften können erklären, was ›Geltung des Rechts‹ in allen Arten von Gesetzen bedeutet. Ob es in diesen Wissenschaften auch um den Zusammenhang zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, geht, hängt davon ab, wie sie den Zusammenhang zwischen Sein und Sollen verstehen. Geltungsfragen begegnen uns nicht nur im Recht, sondern in allen Bereichen des Denkens und Handelns. Es geht in diesen Fragen um das, was in allem Wandel Bestand hat. Wenn wir wissen, was Bestand hat, wissen wir, was ist und was nicht ist. Deswegen müssen wir verstehen, was gilt. Was gilt, hilft uns zu verstehen, was ist und was nicht ist, und zwischen beidem zu unterscheiden. Wenn nichts gelten würde, könnten wir zwischen beidem nicht unterscheiden. Wer behauptet, dass nichts gilt, widerspricht sich selbst, weil dies auch für seine eigene Behauptung gelten würde. Die Philosophie muss begreifen, was gilt, um begreifen zu können, was ist.