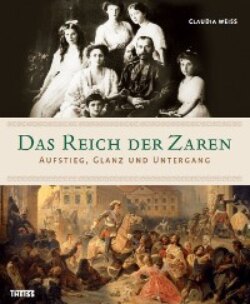Читать книгу Das Reich der Zaren - Claudia Weiss - Страница 15
DIE RUSSISCH-ORTHODOXE KIRCHE
ОглавлениеSeit Ivan IV. ist die orthodoxe Kirche das ideologische Fundament der Zarenherrschaft. Heute sind Staat und Kirche wieder näher zusammengerückt. Die Ostermessen in der Christus-Kathedrale in Moskau, die 1931 zerstört und 1997 wieder aufgebaut wurde, werden im Staatsfernsehen übertragen.
Die Orthodoxie, auf russisch pravoslavie, Rechtgläubigkeit, und die Russisch-Orthodoxe Kirche haben ihre Wurzeln in der oströmischen Kirche. Ihr war die Russisch-Orthodoxe Kirche bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453 nahezu vollständig unterstellt. Ihre Metropoliten, vergleichbar mit Erzbischöfen in der Römisch-Katholischen Kirche, waren an die Weisungen des Patriarchen von Konstantinopel gebunden. Zu einem ersten deutlichen Bruch kam es allerdings bereits 1439 auf dem Konzil von Florenz, auf dem sich eine Annäherung von Rom und Byzanz abzeichnete, die Moskau als Verrat an der Rechtgläubigkeit ansah. Diese Differenzen zwischen Moskau und Byzanz führten zur Autokephalie, der kirchlichen Unabhängigkeit der Russisch-Orthodoxen Kirche, die durch den Untergang von Byzanz besiegelt wurde. Damit bildete sich auch die Idee von Moskau als dem Dritten Rom heraus. In ihrer vollen ideengeschichtlichen Tragweite setzte sie sich allerdings erst im 19. Jahrhundert durch. Doch bereits im späten 15. Jahrhundert legitimierte diese Idee Moskaus neue Führungsrolle in der orthodoxen Welt. In den Augen der »rechtgläubigen« Christen hatten sich West- wie Ostrom auf den Weg der Sünde begeben und es war somit an Moskau, das christliche Erbe anzutreten. Mit der Krönung Ivans IV. zum ersten Zaren Russlands verschmolzen kirchliche Traditionen mit neu eingeführten weltlichen Gegebenheiten und verbanden die Russisch-Orthodoxe Kirche und den russischen Staat fester miteinander. 1589 wurde als Abschluss dieses Konsolidierungsprozesses ein eigener russisch-orthodoxer Patriarch ernannt. Auf lange Sicht profitierte der Staat stärker von dieser Verbindung. Kirche und Staat verschmolzen zu einem Ganzen, in dem der Zar die Oberhand hatte und die Orthodoxie ihm das ideologische Fundament seiner Herrschaft lieferte. Schon Ivan IV. ließ einen seiner Widersacher, Fürst Kurbskij, wissen: »Wer sich der Regierungsgewalt widersetzt, widersetzt sich Gott.«
So wurde die Kirche zum Instrument der Zaren, nationale, kulturelle und politische Ambitionen durchzusetzen. Besonders deutlich trat dies unter Peter dem Großen zutage, der 1721 das Patriarchat zugunsten eines »allerheiligsten regierenden Synods« unter dem Vorsitz des Zaren abschaffte und damit die Kontrolle über die Russisch-Orthodoxe Kirche erlangte. Sie wurde zur Staatskirche, und als solche hatte sie karitativen und Bildungszwecken im Dienste des Zaren nachzukommen. Allerdings sah die Russisch-Orthodoxe Kirche anders als die lateinische ihre Aufgabe nicht im sozialen Engagement und im direkten Kontakt mit den Gläubigen, sondern eher im Mystisch-Asketischen und in der Liturgie. Das mystische Element stellt den Menschen außerhalb des Lebens und negiert die Realität, die Geschichte und die Unabwendbarkeit des Todes. Die Liturgie wiederum hat in der orthodoxen Tradition Vorrang für die Wahrnehmung der christlichen Wahrheit und ersetzt so regelrecht die Theologie.
Der orthodoxe Gottesdienst wird seit jeher in einem sehr sinnlich gestalteten Kirchenraum abgehalten, der zusammen mit den gesungenen Chorälen, den Ikonen, dem Weihrauch und den Gebeten der Gläubigen die eucharistische Handlung erfahrbar machen soll: den Wandel von Brot und Wein in Christi Fleisch und Blut. In der Kommunion nehmen die Gläubigen aktiv daran teil. Die religiöse Erziehung wurde hier durch die kirchliche Handlung erreicht und nicht durch Bücher, die Schule oder das Studium der Bibel außerhalb der Kirche. So verwundert es auch nicht, dass sich die Russisch-Orthodoxe Kirche nicht sonderlich darum bemühte, ihren Gläubigen das Neue Testament als Buch gedruckt in russischer Sprache nahe zu bringen. Erst 1876 wurde eine vollständige russische Ausgabe der Bibel im Zarenreich veröffentlicht. Die liturgische Sprache aber war und blieb das Kirchenslawisch.
Die synodale Phase der Russisch-Orthodoxen Kirche währte bis zum Untergang des Zarenreiches und hinterließ ein widersprüchliches Erbe. Einerseits erhöhte sich die Zahl der Kirchenangehörigen beträchtlich, weil auch das Reich wuchs. Andererseits verlor die Kirche aufgrund der staatlichen Gängelung und weil es ihr an eigenen Konzepten und Einrichtungen der Sozialfürsorge fehlte, an Einfluss in der Gesellschaft. Da es auch keine festen Kirchengemeinden gab, sondern die Gläubigen sich die Kirche, in die sie zum Gottesdienst gehen wollten, nach ihren Bedürfnissen aussuchten, entstanden um russisch-orthodoxe Kirchen keine Gemeinschaften im westlichen Sinne, die einen sozialen Zusammenhalt schufen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche kannte auch keine Kirchensteuer, sondern wurde nach ihrer weitgehenden Enteignung durch die Zaren vom Staat alimentiert und ließ sich so fast alle Dienstleistungen von der Taufe über die Eheschließung, jegliche Weihung und Segnung bis zur Beerdigung in barer Münze von den Gläubigen bezahlen. Das förderte nicht unbedingt das Ansehen der Popen in der Bevölkerung. Trotzdem ist es der Russisch-Orthodoxen Kirche wohl als einziger christlicher Konfession gelungen, das religiöse Element gänzlich mit dem nationalen zu verschmelzen. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert bedeutete »russisch sein« gleichzeitig auch »orthodox sein«. Selbst die sieben Jahrzehnte sowjetischer Herrschaft haben diese Verbindung nicht auflösen können.