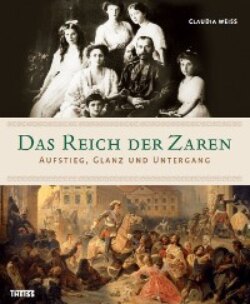Читать книгу Das Reich der Zaren - Claudia Weiss - Страница 21
IKONEN – DIE KUNST DER MÖNCHE
ОглавлениеSeit über tausend Jahren haben die Ikonen enorme Bedeutung in der russischen Kirche. Diese Heiligenbilder machen den Unterschied zwischen Orthodoxie und westlichem Christentum sinnfällig. Ein Chronist warnte anlässlich der Christianisierung der Rus‘ vor den »Lateinern«, welche die Ikonen nicht richtig verehrten. Die Ikone, russisch ikona oder auch obraz, ist die malerische Abbildung des Göttlichen, das menschliche Gestalt angenommen hat wie Gott in Jesus. Dabei steht nicht die Abbildung im Vordergrund, sondern die innere Verbindung zwischen Bild und Abgebildetem. So ist die Ikone vorrangig eine Offenbarung des Heiligen, zugleich aber auch ein Zugang zu Gott. Daher wird sie von den Gläubigen auch »Fenster zur Ewigkeit« genannt. In ihrem Wesen aber ist und bleibt die Ikone ein Stück Holz – nur wenn Heiliges sich in ihr oder durch sie offenbart, darf es verehrt werden. Hier spiegelt sich das für die Orthodoxie typische Element des Mystischen, der sinnlichen Erfahrung des Göttlichen, die ohne intellektuelle Auseinandersetzung auskommt. Entsprechend sind für die orthodoxe Kirche Ikonen keine Kunstwerke, sondern Heiligtümer. Auch der konservative, ein Schema erfüllende Grundzug in der malerischen Gestaltung der Ikonen ist gewollt: Sie sind die Vervielfältigung eines bereits existierenden Bildes. So werden alle Marien-Ikonen auf ein mythisches Bild zurückgeführt, das der Evangelist Lukas gemalt haben soll. Die bekannteste Marien-Ikone ist die Vladimirskaja. Sie ist byzantinischen Ursprungs und gilt als Schutzikone des Russischen Reiches. Ihr wird Wundertätigkeit zugesprochen. Als 1480 das russische Heer unter Ivan III. den Tataren an der Ugra gegenüberstand, wurde die Vladimirskaja an die Front getragen. Die Heere trennten sich kampflos, und das tatarische Joch war für immer von den Russen abgefallen.
Aber nicht nur die Motive wurzeln in mythischen Bildern, auch die Attribute der Darstellungen sind tief im christlichen Symbolsystem verwurzelt. So haben auch die Farben Bedeutung: Gold symbolisiert den Himmel und die himmlische Glückseligkeit, Hellblau steht für die Unendlichkeit, dunkles Rot für Majestät, Weiß für die Unschuld. Eine Besonderheit der Ikonenmalerei ist, dass sie keinen Fixpunkt im Bild kennt, sondern die Perspektive umgekehrt auf den Betrachter zuläuft. Der Standpunkt des Betrachters ist der Endpunkt, die sich ihm in der Ikone offenbarende Welt ist der offene Raum.
Ikonen standen schon immer in engem Zusammenhang mit anderen Formen der Frömmigkeit und des Kultes. Im Kirchenraum sind sie mit den Ikonostasen, den Ikonenwänden, in den Gottesdienst eingebunden. Der Ikonostas grenzt in der Kirche den Versammlungsraum vom Altarraum ab und symbolisiert so zugleich eine Wahrnehmungsgrenze: Er macht sichtbar, dass das Eigentliche am gottesdienstlichen Geschehen nicht sichtbar ist. Aber auch in den Häusern gläubiger orthodoxer Russen fand sich häufig ein krasnyj ugol, eine schöne Ecke, in der die Familienikone hing, vor der gebetet wurde.
Ursprünglich wurden die Ikonen von Mönchen gemalt, die sich durch Kontemplation und Fasten auf diese Arbeit vorbereiteten. Mit wachsendem Bedarf wandelte sich das Ikonen-Malen zu einem Handwerk. Es entstanden Ikonenwerkstätten auf großen Gütern, häufig mit leibeigenen Meistern, wie etwa die Stroganov-Werkstatt, die schulbildend wirkte. Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch Malerdörfer für die Ikonenproduktion bedeutsam. Mochten sich auch die Schaffensorte ändern, die Technik blieb über Jahrhunderte unverändert. Ein Holzbrett wurde innen ein wenig vertieft und mit Leim grundiert, auf den man dann eine Stoffschicht und eine Kreideschicht auftrug. Diese wurde geglättet und poliert, sodass die nur dünn aufgetragenen Temperafarben das Kerzenlicht reflektierten. Die Ikonen wurden in mehreren Schichten von dunkleren zu helleren Farben gemalt. Das Inkarnat – Hände, Füße und Gesichter – entstand als letztes, bevor ein schützender Firnis aus Öl aufgetragen wurde. Ihre beste optische Wirkung erreichen Ikonen im durch Kerzenlicht erleuchteten Kirchenraum – dem Ort, in dem auch ihre mystische Transzendenz zuhause ist.
Die meisten Ikonen sind Werke unbekannter Künstler, denn die Mönche, die sie über Jahrhunderte malten, sahen sich als Werkzeug Gottes und signierten ihre Bilder nicht. Eine Ausnahme ist Andrej Rublev (1370–1430), der seine berühmteste Ikone »Dreifaltigkeit« für das Troize-Sergiev-Kloster schuf.
Auf der Suche nach Salz und Pelzen ziehen Kosakenverbände unter Ataman Ermak 1581 nach Sibirien. Auf dem 1895 vollendeten Gemälde Vassilij Surikovs kämpfen sie gegen die Truppen des Chans Kutschum am Ufer des Irtyš.
Narva und Dorpat fielen noch im selben Jahr in russische Hand, und im August 1560 wurde nach vorangehenden verheerenden Zerstörungen in der Schlacht bei Ermes die militärische Widerstandskraft des Deutschen Ordens endgültig gebrochen. Das Ordensland löste sich in der Folge auf, doch keines seiner Teile unterwarf sich dem russischen Zaren. Livland unterstellte sich lieber dem polnischen, Estland dem schwedischen König.
Kurland wurde als polnischer Vasall ein weltliches Herzogtum, und die Insel Ösel fiel an Herzog Magnus von Holstein, den Bruder des dänischen Königs. Riga und Reval, die beiden wichtigen Hafen- und Handelsstädte, hatte Ivan IV. nicht erobern können, und so hatte er einen Pyrrhussieg errungen, der ihn ab 1561 zu erschöpfenden Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn Polen-Litauen und Schweden zwang.
Ivan IV. kam nicht umhin, seine Ziele weiter zu stecken. 1563 eroberte er das litauische Polock, versäumte es aber, 1566 ein polnisches Friedensangebot anzunehmen, was sich mit der Zeit gegen ihn wendete. Zwar konnte er in den folgenden Jahren noch einige Erfolge in Livland und Litauen erzielen, aber keiner war von Dauer. Auch gelang es ihm nicht, einen eis freien Ostseehafen für Russland zu gewinnen. Während die Moskauer Armee im Westen gebunden war und im Landesinneren der opričnina-Terror tobte, fielen von Südosten her die Krimtataren im Verbund mit den Türken nach Astrachan ein. 1571 legten sie Moskau in Schutt und Asche. 1579 hatte das Schlachtenglück die Russen an den westlichen Fronten endgültig verlassen, und Polen eroberte nach und nach Polock, Velikie Luki und schließlich Pskov zurück. Die Schweden holten sich Estland zurück und besetzten Ingermanland. 1582 musste Ivan IV. einen Waffenstillstand mit Polen-Litauen schließen und alle Eroberungen in Livland und Litauen herausgeben. 1583 folgte der Waffenstillstand mit Schweden, der Russland neben Estland auch die russischen Städte am Finnischen Meerbusen kostete und damit jeglichen Zugang zum Meer. So scheiterte Ivan IV. mit seiner Eroberungspolitik im Westen auf ganzer Linie.