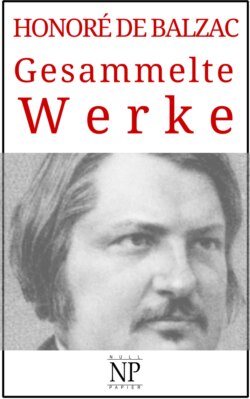Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 28
2
ОглавлениеAls er Claparon seine Angelegenheiten in dieser Weise auseinandersetzen und sich sozusagen eine Marschroute vorschreiben hörte, faßte der Parfümhändler wieder Mut. Seine Haltung wurde sicher und bestimmt und er bekam einen großen Begriff von den Fähigkeiten des ehemaligen Reisenden. Du Tillet hatte es für richtig gehalten, sich von Claparon als Roguins Opfer hinstellen zu lassen. Er hatte die hunderttausend Franken Claparon zugestellt, damit dieser sie Roguin übergebe, der sie ihm dann wieder zurückgezahlt hatte. Der beunruhigte Claparon spielte seine Rolle durchaus natürlich und erzählte jedem, der es hören wollte, daß Roguin ihn hunderttausend Franken koste. Du Tillet hatte Claparon nicht für fest genug gehalten, er konstatierte bei ihm noch zu viel Ehr- und Anstandsgefühl, als daß er ihn in seine Pläne in vollem Umfang eingeweiht hätte, und er wußte außerdem, daß er unfähig war, ihn zu durchschauen.
»Wenn wir nicht den Mut haben, unsern besten Freund hineinzulegen, wer wird sich dann noch von uns an der Nase herumführen lassen?« hatte er zu Claparon an dem Tage gesagt, an dem er diesen seinen Geschäftsagenten, der ihm Vorwürfe machte, wie ein abgenütztes Instrument beiseite warf.
Herr Lebas und Claparon gingen zusammen weg.
»Ich werde mich herausziehen können«, sagte sich Birotteau. »Meine Passiva belaufen sich auf zweihundertfünfunddreißigtausend Franken in Wechseln, davon fünfundsiebzigtausend für mein Haus und hundertfünfundsiebzigtausend Franken für die Terrains. Demgegenüber habe ich die Dividende Roguin, die sich vielleicht auf hunderttausend Franken belaufen wird, die Terrainhypothek kann ich rückgängig machen, also im ganzen hundertvierzig. Es handelt sich also darum, mit dem Huile Céphalique hunderttausend Franken zu verdienen und dann durch Begebung einiger Wechsel oder mit Hilfe eines Bankierkredits den Moment abzuwarten, da ich meinen Verlust wieder gutgemacht und die Terrains ihren Mehrwert erreicht haben werden.«
Wenn ein Mensch, der ins Unglück geraten ist, sich mit mehr oder weniger richtigen Erwägungen, mit denen er sein Kopfkissen polstert, um darauf zu schlafen, ein Luftschloß aufgebaut hat, so wird er häufig dadurch gerettet. Viele Leute halten das Vertrauen, das die Illusion eingibt, für Energie. Und vielleicht besteht die Hälfte des Mutes in der Hoffnung, die ja auch die katholische Religion unter die Tugenden rechnet. Hat die Hoffnung nicht viele Schwache aufrecht erhalten, indem sie ihnen die Zeit gewährte, die Wechselfälle des Geschicks abzuwarten? Entschlossen, dem Onkel seiner Frau seine Lage auseinanderzusetzen, bevor er anderswo Hilfe suchte, ging Birotteau die Rue Saint-Honoré bis zur Rue Bourdonnais entlang, nicht ohne ein ihm sonst unbekanntes Angstgefühl, das ihn so heftig erregte, daß er seine Gesundheit für erschüttert hielt. Die Eingeweide brannten ihm. In der Tat fühlen die Leute, die mit dem Zwerchfell empfinden, dort Schmerzen, während die Leute, die alles mit dem Verstande aufnehmen, Kopfschmerzen bekommen. Bei großen Krisen wird die physische Natur dort angegriffen, wohin die Wesensanlage des Individuums den Sitz des Lebens verlegt hat; schwache Leute bekommen dann Kolik, Napoleon verfiel in Schlaf. Bevor die Zuversicht ehrenhafte Menschen soweit vorwärts treibt, daß sie alle Schranken des Stolzes niederwerfen, müssen sie mehr als einmal im Herzen die Sporen der Notwendigkeit, dieses harten Reiters, verspürt haben! So hatte sich auch Birotteau erst zwei Tage lang anspornen lassen, bevor er seinen Onkel aufsuchte, und auch dann entschloß er sich erst aus Rücksicht auf seine Familie dazu: jedenfalls war er gezwungen, dem gestrengen Eisenhändler seine Lage offen darzustellen. Trotzdem ergriff ihn vor der Tür das innere Schwächegefühl, das jedes Kind empfindet, wenn es zum Zahnarzt geht; aber bei ihm bezog sich dieses Gefühl auf den Gesamtbegriff seines Daseins, nicht auf einen vorübergehenden Schmerz. Langsam stieg Birotteau die Treppe hinauf. Er fand den Alten am Kaminfeuer den Constitutionnel lesend vor einem kleinen Tisch, auf dem sein frugales Frühstück stand: ein Brötchen, Butter, Briekäse und eine Tasse Kaffee.
»Das ist der wahre Weise«, sagte Birotteau, der das Leben des Onkels beneidete.
»Nun?« sagte Pillerault und nahm seine Brille ab, »ich habe gestern im Café David von der Affäre Roguin gehört und von der Ermordung der schönen Holländerin, seiner Mätresse! Ich hoffe, du hast dir, auf unsre Erklärung hin, daß wir als effektive Eigentümer auftreten wollen, die Quittung von Claparon geben lassen?«
»Ach, lieber Onkel, das ist ja das Unglück; du hast den Finger auf die Wunde gelegt: Nein.«
»Aber, zum Henker! Dann bist du ja ruiniert«, sagte Pillerault und ließ seine Zeitung fallen, die Birotteau aufhob, obwohl es der Constitutionnel war. Pillerault wurde von den Überlegungen, die er anstellte, so tief bewegt, daß sein Gesicht, von dem strengen Schnitt einer Medaille, wie Metall unter dem Schlag des Stempels erstarrte; mit starrem Blick fixierte er durch das Fenster die gegenüberliegende Mauer und hörte Birotteaus langer Auseinandersetzung zu. Er prüfte und urteilte, er wog das Für und Wider ab mit der Unerbittlichkeit eines Minos, der den Styx des Handels überschritten hatte, als er den Quai des Morfundus verließ, um seine kleine Wohnung im dritten Stock zu beziehen.
»Nun, lieber Onkel?« sagte Birotteau, der eine Antwort erwartete, nachdem er mit der Bitte geschlossen hatte, Pillerault möchte sechzigtausend Franken Rente verkaufen.
»Nein, mein armer Junge, das kann ich nicht, du bist zu stark kompromittiert. Die Ragons und ich, wir verlieren beide unsre fünfzigtausend Franken. Diese braven Leute haben auf meinen Rat ihre Wortschiner Minenaktien verkauft: ich fühle mich deshalb bei diesem Verluste verpflichtet, ihnen zwar nicht das Kapital zu ersetzen, aber ihnen hilfreich beizuspringen, ihnen, meiner Nichte und Cäsarine. Ihr werdet euch vielleicht alle nach Brot umsehen müssen, und das sollt ihr bei mir finden …«
»Nach Brot, Onkel?«
»Nun ja, gewiß, nach Brot. Du mußt den Dingen, wie sie in Wirklichkeit stehen, ins Gesicht sehen: Du wirst dich nicht herausziehen können. Von fünftausendsechshundert Franken Rente kann ich viertausend entbehren und sie zwischen euch und den Ragons teilen. Wie ich Konstanze kenne, wird sie bei einem solchen Unglück arbeiten wie ein Galeerensklave und sich alles versagen, und du ebenso, Cäsar!«
»Aber es ist doch noch nicht alles verloren, lieber Onkel.«
»Ich sehe anders als du.«
»Aber ich werde dir das Gegenteil beweisen.«
»Nichts würde mich mehr erfreuen.«
Birotteau verließ Pillerault ohne eine weitere Antwort. Er war gekommen, um Trost zu finden und Mut zu schöpfen, und er empfing einen zweiten Schlag; dieser traf ihn in Wahrheit nicht so heftig wie der erste, aber er fiel nicht auf seinen Kopf, er traf ihn ins Herz; und das Herz war bei dem armen Manne das Wesentliche. Nachdem er schon einige Stufen hinabgestiegen war, kehrte er noch einmal um.
»Herr Pillerault,« sagte er kühl, »Konstanze weiß nichts davon, ich bitte, die Sache wenigstens geheim zu halten und auch Ragons zu ersuchen, mir zu Hause nicht die Ruhe wegzunehmen, die ich so nötig brauche, um gegen das Unglück ankämpfen zu können.«
Pillerault machte eine zustimmende Gebärde.
»Du brauchst den Mut nicht zu verlieren, Cäsar«, fügte er hinzu; »ich sehe, daß du mir böse bist; aber später wirst du gerechter über mich urteilen, wenn du an deine Frau und deine Tochter denken wirst.«
Entmutigt durch die Ansicht seines Onkels, den er für einen besonders klaren Kopf hielt, stürzte Cäsar von der Höhe seiner Hoffnungen in den trüben Sumpf der Ungewißheit hinab. Wenn bei solchen fürchterlichen Geschäftskrisen ein Mann nicht eine so stählerne Seele hat wie Pillerault, wird er zum Spielball der Ereignisse; er folgt bald den Meinungen der andern, bald seinen eigenen, wie ein Wanderer, der hinter Irrlichtern herläuft. Er läßt sich von dem Wirbelsturm mit fortreißen, anstatt sich auf die Erde zu legen und nicht hinzusehen, wenn er vorüberbraust, oder seine Bahn zu beobachten, um sie zu vermeiden. Mitten in seinem Schmerze erinnerte sich Birotteau an den Prozeß wegen der Terrainhypothek. Er begab sich nach der Rue Vivienne, zu Derville, seinem Anwalt, um sobald als möglich vorzugehen, falls der Anwalt eine Möglichkeit sehen würde, den Vertrag zu annullieren. Der Parfümhändler traf Derville in seinem Hausrock von weißem Flanell am Kaminfeuer sitzend an, ruhig und gesetzt, wie alle Advokaten, die daran gewöhnt sind, die schrecklichsten Eröffnungen anzuhören. Birotteau fiel zum erstenmal diese unvermeidliche Kühle auf, die eisig auf einen Mann wirken mußte, der in leidenschaftlicher Erregung, tief verletzt, vom Fieber der Angst um sein Vermögen geschüttelt und schmerzhaft in seinem Lebensnerv, in seiner Ehre, in Frau und Kindern getroffen ist, wie es Birotteau war, als er über sein Unglück berichtete.
»Wenn bewiesen werden kann,« sagte Derville, nachdem er ihn angehört hatte, »daß der Darlehnsgeber die Summe, die er Ihnen auf Roguins Veranlassung leihen sollte, nicht bei Roguin deponiert hatte, so ist, da eine Barzahlung nicht stattgefunden hat, die Ungültigkeitserklärung möglich; der Darlehnsgeber kann sich dann nur an die Kaution des Notars halten, ebenso wie Sie mit Ihren hunderttausend Franken. In diesem Falle würde ich für den Prozeß einstehen, soweit man dafür einstehen kann, denn einen Prozeß, der sicher gewonnen werden muß, gibt es nicht.«
Diese Ansicht eines so tüchtigen Rechtsverständigen flößte dem Parfümhändler wieder etwas Mut ein, und er bat Derville, binnen vierzehn Tagen das Urteil zu erwirken. Aber der Anwalt erwiderte ihm, daß eine Entscheidung, die den Kontrakt aufhöbe, allenfalls in drei Monaten zu erreichen sei.
»In drei Monaten!« sagte der Parfümhändler, der schon eine Hilfe gefunden zu haben glaubte.
»Wenn wir auch die Sache energisch betreiben, so können wir doch Ihren Gegner nicht zu demselben Tempo zwingen; er wird alle Fristen ausnutzen, und die Anwälte sind nicht immer zum Termin anwesend; und wer kann wissen, ob Ihr Gegner nicht ein Versäumnisurteil gegen sich ergehen läßt. Es geht nicht so schnell, wie man gern möchte, verehrter Herr«, sagte Derville lächelnd.
»Und beim Handelsgericht?« sagte Birotteau.
»Oh,« sagte der Anwalt, »Handelsrichter und Richter erster Instanz, das sind zwei ganz verschiedene Arten von Richtern. Ihr, ihr brecht die Dinge übers Knie! Aber im Justizpalast haben wir die vorgeschriebenen Formen innezuhalten. Die Form ist die Beschützerin des Rechts. Würden Sie ein solches Urteil aus dem Handgelenk vorziehen, durch das Sie vierzigtausend Franken verlieren können? Und Ihr Gegner, der diesen Betrag zu verlieren in Gefahr ist, wird sich wehren. Die Fristen sind die spanischen Reiter der Justiz.«
»Sie haben recht«, sagte Birotteau, der sich von Derville verabschiedete und fortging, den Tod im Herzen.
»Alle haben sie recht. Geld! Geld!« rief er laut, indem er auf der Straße mit sich selbst redete, wie überbeschäftigte Leute es in dem stürmisch brausenden Paris, das ein moderner Dichter einen Siedekessel genannt hat, tun. Als er in seinen Laden trat, sagte ihm der Kommis, der mit den Rechnungen herumgegangen war, daß mit Rücksicht auf das bevorstehende Neujahr alle die Quittung zurückgegeben und die Rechnung behalten hätten.
»Es ist also nirgends Geld aufzutreiben«, sagte der Parfümhändler laut in seinem Laden.
Er biß sich auf die Lippen, denn alle Kommis hatten ihm den Kopf zugewandt.
So vergingen fünf Tage, fünf Tage, während denen Braschon, Lourdois, Thorein, Grindot, Chaffaroux, alle nicht bezahlten Gläubiger sämtliche Chamäleons-Phasen erlebten, die der Gläubiger durchmachen muß, bevor er in den Ruhezustand gelangt, zu dem ihm die Einsicht verhilft, daß die Bellona des Handels blutige Farben hat. In Paris tritt die Periode des sich zusammenziehenden Mißtrauens ebenso schnell ein, wie es lange dauert, bis sich das Vertrauen wieder ausbreitet: ist der Gläubiger einmal in diese Zeit der einschränkenden kommerziellen Angst und Vorsicht geraten, so kommt er schließlich zu direkten Niederträchtigkeiten, die ihn dem Schuldner überlegen machen. Mit süßlicher Höflichkeit beginnend, gingen die Gläubiger zu dem Rot der Ungeduld, zu dem düsteren Geknatter der Zudringlichkeiten, zu Ausbrüchen getäuschter Erwartungen, zu dem kalten Blau eines gefaßten Entschlusses und endlich zu der schwarzen Unverschämtheit einer beantragten gerichtlichen Vorladung über. Braschon, der reiche Tapezierer aus dem Faubourg Saint-Antoine, der keine Einladung zum Ball erhalten hatte, schlug als Gläubiger, der sich in seiner Selbstsucht verletzt fühlte, zuerst Lärm; er wollte binnen vierundzwanzig Stunden bezahlt sein; er forderte Sicherheiten, und zwar nicht eine Verpfändung des Mobiliars, sondern eine Hypothek, hinter den vierzigtausend Franken auf das Grundstück des Faubourg einzutragen. Immerhin ließen sie, trotz der Heftigkeit ihrer Vorstellungen, ihm doch noch einige Pausen der Ruhe, während deren Birotteau aufatmen konnte. Aber anstatt diese Tirailleurgefechte gegen seine schwierige Lage mit einem energischen Entschluß abzuschlagen, wendete Cäsar sein ganzes Kopfzerbrechen dazu an, zu verhindern, daß seine Frau, der einzige Mensch, der ihm hätte raten können, etwas davon erfuhr. Er stand Wache vor seiner Ladentür und paßte ringsherum auf. Er hatte Cölestin ins Vertrauen gezogen bezüglich seiner augenblicklichen Notlage und Cölestin prüfte seinen Chef mit einem ebenso neugierigen wie erstaunten Blick: in seinen Augen setzte sich Cäsar selbst herab, wie sich in Notlagen die Leute herabsetzen, die an Erfolg gewöhnt sind, und deren ganze Stärke in der Geschicklichkeit besteht, die die Routine Durchschnittsintelligenzen verleiht. Ohne die Fähigkeit, sich mit der notwendigen Energie an so vielen bedrohten Punkten zu gleicher Zeit zur Wehr zu setzen, hatte Cäsar doch den Mut, sich über seine Lage klar zu werden. Für das Ende des Monats Dezember und zum 15. Januar mußte er für sein Haus wie für fällige Wechsel, Miete und laufende Verpflichtungen einen Betrag von sechzigtausend Franken aufbringen, davon dreißigtausend für den 30. Dezember; aus all seinen Hilfsquellen konnte er kaum zwanzigtausend herausholen; es fehlten ihm also zehntausend. Das erschien ihm durchaus noch nicht verzweifelt, denn er dachte bereits nur an den nächsten Augenblick, wie ein Abenteurer, der in den Tag hinein lebt. Bevor das Gerücht über seine peinliche Lage sich in der Öffentlichkeit verbreitete, wollte er daher etwas versuchen, was ihm als ein wichtiger Schritt erschien, sich nämlich an den bekannten Franz Keller zu wenden, den Bankier, Kammerredner und Philanthropen, berühmt wegen seiner Wohltätigkeit und wegen seiner Bemühungen, dem Pariser Handel zu nützen, der bestrebt war, stets als Pariser Deputierter in der Kammer aufzutreten. Der Bankier war Liberaler, Birotteau Royalist; aber der Parfümhändler beurteilte die Menschen mit dem Herzen und sah in der Verschiedenheit der politischen Anschauungen einen Grund mehr, einen Kredit zu erhalten. Wenn Unterlagen erforderlich sein sollten, so zweifelte er nicht an Popinots Opferwilligkeit, von dem er Wechsel über etwa dreißigtausend Franken erbitten wollte, die auch dazu dienen sollten, seinen Prozeß zu gewinnen, und womit er dann den drängendsten Gläubigern eine Garantie bieten konnte. Der mitteilsame Parfümhändler, der seiner geliebten Konstanze auf dem Kopfkissen die kleinsten Ereignisse seines täglichen Lebens erzählte, der hier Mut schöpfte, der durch ihren Widerspruch aufgeklärt wurde, konnte sich jetzt über seine Lage weder mit seinem ersten Kommis, noch mit seinem Onkel, noch mit seiner Frau aussprechen.
Die Gedanken, die er sich machte, bedrückten ihn doppelt. Aber dieser edle Märtyrer wollte lieber leiden, als die Seele seiner Frau in Brand setzen: er wollte sie von der Gefahr erst in Kenntnis setzen, wenn sie vorüber sein würde. Vielleicht schrak er auch vor solch einer furchtbaren Beichte zurück. Die Angst, die ihm seine Frau einflößte, stachelte seinen Mut an. Alle Morgen begab er sich nach Saint-Roch, um eine stille Messe zu hören, und schüttete vor Gott sein Herz aus. »Wenn ich von Saint-Roch nach Hause gehe und keinen Soldaten treffe, so wird meine Bitte erfüllt werden. Dadurch wird Gott mir antworten«, sagte er sich, nachdem er Gott um Hilfe angefleht hatte.
Und er war glücklich, wenn er keinem Soldaten begegnete. Aber das Herz war ihm so schwer, daß er ein anderes Herz haben mußte, an dem er sich ausweinen konnte. Cäsarine, der er sich schon nach Empfang der verhängnisvollen Nachricht anvertraut hatte, blieb auch weiter seine Vertraute. Heimliche Blicke wurden zwischen ihnen gewechselt, Blicke voller Verzweiflung oder getäuschter Hoffnung, dringende Winke von beiden Seiten, im Einverständnis ausgetauschte Fragen und Antworten, Lichtblicke von Seele zu Seele. Vor seiner Frau stellte sich Birotteau heiter und unbekümmert. Wenn Konstanze eine Frage stellte: oh, alles ging gut! Popinot, um den sich Cäsar gar nicht kümmerte, hat Erfolg! Das Öl kommt in Aufschwung! Claparons Wechsel würden eingelöst werden, es sei nichts zu befürchten. Diese gespielte Fröhlichkeit war fürchterlich. Wenn seine Frau in dem prächtigen Bett eingeschlafen war, dann richtete sich Birotteau auf und versank in Grübeln über sein Unglück. Manchmal kam Cäsarine im Hemde, mit einem Schal über ihren weißen Schultern, barfuß herein.
»Papa, ich höre ja, wie du weinst«, sagte sie, selber in Tränen.
Birotteau befand sich nach Absendung des Briefes, in dem er den großen Franz Keller um eine Unterredung gebeten hatte, in einem Zustande derartiger Betäubung, daß seine Tochter ihn ausführen mußte. In den Straßen fielen ihm nur riesige rote Anschläge auf und sein Blick wurde von den Worten gefesselt: »Huile Céphalique«.
Während des katastrophalen Niedergangs der Rosenkönigin erhob sich die Firma A. Popinot strahlend im Morgenlichte des Erfolges. Von Gaudissart und Finot beraten, hatte Anselm für sein Öl eine waghalsige Reklame gemacht. Zweitausend Anschläge waren innerhalb von drei Tagen an den ins Auge fallendsten Stellen von Paris angebracht worden. Niemand konnte es vermeiden, sich dem Huile Céphalique gegenüberzusehen und einen von Finot verfaßten präzisen Satz über die Unmöglichkeit, das Haar wieder wachsen zu machen, und die Gefahren des Färbens zu lesen, woran sich noch ein Zitat aus dem Vortrag Vauquelins in der Akademie der Wissenschaften schloß, eine richtige Beurkundung über die Lebensfähigkeit der toten Haare, die allen denen zugesichert wurde, die das Huile Céphalique gebrauchen würden. Alle Friseure von Paris, alle Perückenmacher und Parfümhändler hatten an ihrer Ladentür eine Anzeige auf Velinpapier in vergoldetem Rahmen angebracht, deren Kopf eine verkleinerte Wiedergabe des Stiches »Hero und Leander« schmückte mit der Unterschrift: »Die alten Völker der Antike erhielten sich ihr Haar durch den Gebrauch des Huile Céphalique.«
»Mit diesen bleibenden Bildern hat er ja eine immerwährende Annonce erfunden«, sagte sich Birotteau, der erstaunt stehengeblieben war und das Schaufenster der Silbernen Glocke betrachtete.
»Hast du das denn nicht bei uns gesehen,« sagte seine Tochter zu ihm, »das Bild, das Herr Anselm selbst gebracht hat, als er Cölestin dreihundert Flaschen Öl übergab?«
»Nein«, sagte er.
»Cölestin hat schon fünfzig davon an Passanten und sechzig an Kunden verkauft.«
»Ah«, sagte Cäsar.
Der Parfümhändler, betäubt von den tausend Glockentönen, die das Elend in den Ohren seiner Opfer erklingen läßt, bewegte sich in einem schwindelerregenden Zustande umher; am Abend vorher hatte Popinot eine Stunde lang auf ihn gewartet und hatte dann mit Konstanze und Cäsarine geplaudert, die ihm sagten, daß Cäsar in seine große Sache vergraben sei.
»Ach ja, die Terrainsache.«
Glücklicherweise hatte Popinot, der einen Monat lang aus seiner Rue des Cinq-Diamants nicht herausgekommen war und jetzt die Nächte und die Sonntage mit Arbeit in der Fabrik verbrachte, weder die Ragons, noch Pillerault, noch seinen Onkel, den Richter, gesehen. Das arme Kind schlief nicht mehr als zwei Stunden! Er hatte nur zwei Kommis, und bei dem Tempo, in dem die Dinge vorwärts gingen, würde er bald vier haben müssen. Im Geschäftsleben hängt alles von der günstigen Gelegenheit ab. Wer das Glück nicht beim Schopfe zu packen versteht, dem schlüpft es aus der Hand. Popinot sagte sich, daß er freudig empfangen werden würde, wenn er nach sechs Monaten zu seiner Tante und seinem Onkel sagen könnte: »Ich bin gerettet, mein Glück ist gemacht!« Freudig empfangen auch von Birotteau, wenn er ihm nach sechs Monaten zwanzig- bis dreißigtausend Franken Gewinnanteil überbringen würde. Er wußte also nichts von Roguins Flucht, von dem Unglück und der peinlichen Lage Cäsars, und konnte daher vor Frau Birotteau kein verräterisches Wort sagen. Popinot hatte Finot fünfhundert Franken für jede große Zeitung zugesagt, aber es gab deren zehn! – dreihundert Franken für jede Zeitung zweiten Ranges, und davon gab es wiederum zehn! –, unter der Bedingung, daß dreimal im Monat eine Notiz über das Huile Céphalique gebracht würde. Bei diesen achttausend Franken verdiente Finot dreitausend, der erste Einsatz, den er auf dem großen grünen Riesenspieltisch der Spekulation wagen wollte! Er hatte sich daher wie ein Löwe auf seine Freunde und Bekannten gestürzt, er wohnte förmlich in den Redaktionsbureaus, er erschien frühmorgens am Bett bei allen Redakteuren und abends war er in allen Theaterfoyers zu sehen. »Denk an mein Öl, lieber Freund, ich selbst habe nichts davon, es ist ein Freundschaftsdienst, weißt du, für Gaudissart, den Lebemann.« Damit begannen und schlossen alle seine Unterredungen. Er stürzte sich auf das Ende aller Schlußspalten der Zeitungen, und setzte dort Artikel hinein, deren Bezahlung er den Redakteuren überließ. Verschlagen wie ein Statist, der Schauspieler werden will, beweglich wie ein Laufbursche, der sechzig Franken im Monat verdient, schrieb er verfängliche Briefe, schmeichelte jeder Eigenliebe, leistete den Chefredakteuren unsaubere Dienste, um seine Artikel anzubringen. Geld, Dinereinladungen, Gemeinheiten, alles mußte seinem leidenschaftlichen Tatendrang dienen. Mit Theaterbilletts bestach er die Arbeiter, die den Satz der Zeitungen gegen Mitternacht beenden, damit sie noch einige immer bereit gehaltene Notizen unter »Vermischtes«, dem Notbehelf der Zeitung, einschoben. Finot verweilte dann in der Druckerei, als ob er mit der Korrektur eines Artikels beschäftigt wäre. Mit allen Leuten befreundet, erreichte er es, daß das Huile Céphalique über die Paste Regnauld, die Brasilianische Mixtur, kurz, über alle jene Erfindungen triumphierte, die zuerst so gescheit waren, den journalistischen Einfluß und die trompetenartige Wirkung zu begreifen, die ein immer wiederkehrender Artikel auf das Publikum ausübt. In dieser harmlosen Zeit waren viele Journalisten wie die Ochsen; sie kannten ihre Macht nicht, sie beschäftigten sich mit Schauspielerinnen, mit Florine, Tullia, Mariette usw. Sie verstanden alles und erwarben nichts. Andoche kümmerte sich nicht um die Claque für eine Schauspielerin, noch um die Anbringung eines Theaterstücks, noch um die Annahme seiner eigenen kleinen Lustspiele, noch um die Bezahlung seiner Artikel; im Gegenteil, er bot im geeigneten Moment noch Geld, oder gelegentlich ein Frühstück an; es gab daher keine Zeitung, die nicht über das Huile Céphalique schrieb, davon, daß es den Untersuchungen Vauquelins entsprach, die sich nicht über diejenigen lustig machte, die glaubten, daß man die Haare wieder wachsen machen könne, und die nicht vor den Gefahren des Färbens warnte.