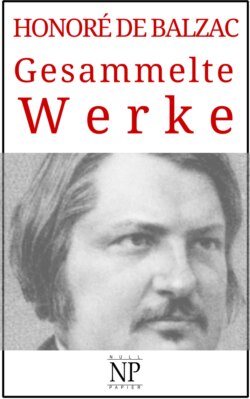Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 38
12
ОглавлениеSeit diesem denkwürdigen Tage führten Cäsar, seine Frau und seine Tochter ihr Leben in vollstem Einvernehmen. Der arme Angestellte wollte ein, wenn auch nicht unmögliches, so doch ungeheures Ergebnis erzielen: die volle Bezahlung seiner Schulden! Diese drei Menschen, durch das Gefühl der gleichen strengsten Redlichkeit verbunden, wurden geizig und versagten sich alles; jeder Heller war ihnen heilig. Mit voller Absicht widmete sich Cäsarine ihrem Geschäft mit der hingebenden Schwärmerei eines jungen Mädchens. Sie verbrachte die Nächte, indem sie sich den Kopf darüber zerbrach, wie dem Geschäft zu einem weiteren Aufschwung verholfen werden könne; sie erfand neue Stoffmuster und entfaltete ihre angeborene kaufmännische Begabung in genialer Weise. Die Geschäftsinhaber waren genötigt, ihren Arbeitseifer zu zügeln, und belohnten ihn mit Gratifikationen; aber wenn sie ihr Putz und Schmucksachen schenken wollten, so lehnte sie ab, sie wollte nur Geld! Jeden Monat brachte sie ihr Gehalt und ihre kleinen Sondergewinne ihrem Onkel Pillerault, und ebenso machte es Cäsar und ebenso seine Frau. Da alle drei sich nicht für geschickt genug hielten und keiner allein die Verantwortung für eine gute Anlage ihrer Ersparnisse übernehmen wollte, so hatten sie Pillerault die endgültige Entscheidung darüber übertragen. Wieder zum Kaufmann geworden, legte der Onkel das Geld in Börsengeschäften an. Später wurde bekannt, daß er dabei von Jules Desmarets und Joseph Lebas unterstützt worden war, die sich beide bemüht hatten, ihm sichere Anlagen nachzuweisen. Der ehemalige Parfümhändler, der bei seinem Onkel lebte, wagte nicht, ihn über die Unterbringung des Geldes, das durch seine, seiner Frau und seiner Tochter Arbeit erworben wurde, zu befragen. Gesenkten Hauptes ging er über die Straße und versuchte, sein niedergeschlagens, entstelltes, stumpf gewordenes Gesicht allen Blicken zu entziehen. Er machte sich sogar Vorwürfe, daß er gute Stoffe trug.
»Wenigstens«, pflegte er zu sagen und blickte dankbar auf den Onkel, »brauche ich nicht das Brot meiner Gläubiger zu essen. Das Brot, das Sie mir geben, wenn es auch nur aus Mitleid mit mir geschieht, schmeckt mir süß, wenn ich bedenke, daß dank dieser himmlischen Güte ich nichts von meinem Gehalt wegzunehmen brauche.« Die Kaufleute, die dem Angestellten begegneten, konnten keine Spur mehr von dem alten Parfümhändler wahrnehmen. Die Gleichgültigsten bekamen einen ungeheuren Begriff von dem Sturz der Menschen aus ihrer Höhe, wenn sie das Gesicht dieses Mannes ansahen, in das der schwärzeste Kummer seine Zeichen gegraben hatte, und das von dem, was es niemals früher beschäftigt hatte, zerstört wurde: vom Nachdenken! Zerstört aber wird nur der, der sich nicht dagegen sträuben will. Leichtlebigen, gewissenlosen Leuten wird man niemals ihr Unglück anmerken. Das religiöse Gefühl allein vermag niedergeworfenen Existenzen seinen besonderen Stempel aufzudrücken; diese glauben an eine Zukunft, an eine Vorsehung; es schwebt ein Leuchten über ihnen, das kennzeichnend ist, eine Art frommer Ergebung mit Hoffnung vermischt, die rührend ist; sie wissen, was sie alles verloren haben, wie der gefallene Engel, der an der Pforte des Himmels weint. Kridare dürfen nicht an der Börse erscheinen. Cäsar, aus der Gesellschaft der vollberechtigten Kaufleute ausgestoßen, bot das Bild des am Himmelstor um Gnade flehenden Engels dar. Vierzehn Monate hindurch frommen Grübeleien über sein Unglück hingegeben, versagte sich Cäsar jedes Vergnügen. Obgleich der unveränderten Freundschaft der Ragons sicher, war es unmöglich, ihn zu bewegen, zu ihnen zum Diner zu kommen, ebensowenig wie zu Lebas, den Matifats, den Protez und Chiffrevilles, nicht einmal zu Herrn Vauquelin, die alle bemüht waren, Cäsars hervorragendem Verhalten Ehre zu erweisen. Er zog es vor, allein in seinem Zimmer zu bleiben, um nicht einem seiner Gläubiger unter die Augen treten zu müssen. Das wärmste Entgegenkommen seiner Freunde erinnerte ihn immer wieder bitter an seine Lage. Auch Konstanze und Cäsarine gingen nirgends hin. An Sonn- und Festtagen, den einzigen, wo sie frei waren, holten die beiden Frauen Cäsar zur Messe ab und leisteten ihm, nach Erfüllung der religiösen Pflichten, Gesellschaft bei Pillerault. Dieser lud dann den Abbé Loraux ein, dessen Worte Cäsar in seinen Prüfungen aufrecht erhielten, und so blieben sie im engsten Kreise zusammen. Der ehemalige Eisenhändler war selbst im Punkte der Ehrenhaftigkeit zu empfindlich, als daß er Cäsars Feingefühl mißbilligt hätte. Deshalb sann er darauf, die Anzahl der Personen zu vergrößern, vor denen sich der Kridar mit freiem Blick und erhobenem Haupte zeigen konnte.
Im Monat Mai des Jahres 1820 wurde diese gegen das Unglück kämpfende Familie für ihre Anstrengungen mit einer Festlichkeit belohnt, mit der sie der Leiter ihres Geschicks überraschen wollte. Der letzte Sonntag dieses Monats war der Jahrestag von Konstanzes Verlobung mit Cäsar. Pillerault hatte im Einverständnis mit Ragon ein kleines Landhaus in Sceaux gemietet und der frühere Eisenhändler wollte dort das Einweihungsfest geben.
»Cäsar,« sagte Pillerault zu seinem Neffen am Sonnabend Abend, »morgen gehen wir aufs Land und du wirst mitkommen.«
Cäsar, der eine vortreffliche Hand schrieb, machte abends Abschriften für Derville und einige andere Advokaten. Auch am Sonntag arbeitete er, mit kirchlichem Dispens, wie ein Sklave daran.
»Nein,« antwortete er, »Herr Derville wartet auf eine Vormundschaftsabrechnung.«
»Deine Frau und deine Tochter verdienen wohl eine Belohnung. Du findest auch nur unsere Freunde draußen: den Abbé Loraux, die Ragons, Popinot und seinen Onkel. Im übrigen wünsche ich es.«
Cäsar und seine Frau waren bei dem Getriebe ihrer Geschäfte niemals wieder nach Sceaux gekommen, obgleich sie beide von Zeit zu Zeit den Wunsch hatten, dort den Baum wiederzusehen, unter dem der erste Kommis der Rosenkönigin vor Glück beinahe ohnmächtig geworden war. Während der Fahrt, die Cäsar mit Frau und Tochter im Wagen sitzend machte, den Popinot kutschierte, warf Konstanze ihrem Manne Blicke des Einverständnisses zu, ohne jedoch ein Lächeln auf seine Lippen hervorzaubern zu können. Sie flüsterte ihm einige Worte zu, aber er schüttelte statt aller Antwort nur den Kopf. Der liebevolle Ausdruck zärtlicher Empfindung, der, wenn auch erzwungen, so doch unerschütterlich in ihrem Blicke leuchtete, machte Cäsars Gesicht, anstatt es aufzuhellen, nur noch trüber und ließ ihm die zurückgehaltenen Tränen in die Augen treten. Vor zwanzig Jahren hatte der arme Mann denselben Weg als ein wohlhabender, hoffnungsfreudiger junger Mensch gemacht, der in ein junges Mädchen verliebt war, ebenso schön wie jetzt Cäsarine; damals träumte er von Glück, und heute saß er im Wagen, vor ihm sein edles Kind, bleich von durchwachten Nächten, und seine tapfere Frau, deren Schönheit dahingeschwunden war, wie die von Städten, über die die Lava eines Vulkans sich ergossen hat. Nur die Liebe war die alte geblieben! Cäsars Haltung dämpfte die Freude im Herzen seiner Tochter und Anselms, die für ihn das reizvolle Einst vergegenwärtigten.
»Seid glücklich, Kinder, ihr habt ein Recht darauf«, sagte der arme Vater mit herzzerreißendem Tone. »Ihr könnt euch in aller Sorglosigkeit lieben«, fügte er hinzu.
Als er diese Worte sagte, hatte Birotteau die Hände seiner Frau ergriffen und küßte sie mit so andachtsvoller Verehrung, daß Konstanze mehr dadurch bewegt wurde als durch die lebhafteste Freude. Als sie bei dem Landhause anlangten, wurden sie von Pillerault, den Ragons, dem Abbé Loraux und dem Richter Popinot mit Blicken und Begrüßungen so empfangen, daß Cäsar sich wohlfühlte; alle waren bewegt, daß dieser Mann immer noch so erschien wie am Tage nach dem Hereinbrechen seines Unglücks.
»Geht ein bißchen im Wäldchen von Aulnay spazieren,« sagte der Onkel Pillerault und legte Cäsars Hand in Konstanzens, »und nehmt Anselm und Cäsarine mit! Um vier Uhr erwarten wir euch zurück.«
»Die armen Leute, wir würden sie nur genieren,« sagte Frau Ragon, gerührt von der echten Trauer ihres Schuldners, »er wird bald wieder froh werden.«
»Das nennt man Reue ohne Schuld«, sagte der Abbé Loraux.
»Er konnte nur durch das Unglück groß werden«, sagte der Richter.
Vergessen können, das ist das große Geheimnis starker, schöpferischer Persönlichkeiten, vergessen, wie die Natur, die vom Vergangenen nichts weiß und zu jeder Stunde das Mysterium der unermüdlichen Zeugung sich erneuern läßt. Schwache Existenzen, wie Birotteau, verharren in ihrem Kummer, anstatt aus der Erfahrung eine Lehre zu ziehen, sie sättigen sich mit ihm und vernutzen sich, indem sie tagaus tagein ihr ganzes Unglück von Anfang an wieder überdenken. Als die beiden Paare den Weg nach dem Wäldchen von Aulnay betreten hatten, das einen der reizendsten Abhänge in der Umgebung von Paris bekrönt, und sich der lachende Blick auf das Vallée-aux-Loups öffnete, lösten sich bei der Schönheit des Tages, der Anmut der Landschaft, dem ersten Grün und den süßen Erinnerungen an den schönsten Tag seiner Jugend die Fesseln von Cäsars Seele; er preßte den Arm seiner Frau an sein pochendes Herz, sein Auge verlor die gläserne Starrheit und ließ den Glanz der Freude aufleuchten.
»Endlich kenne ich dich wieder, mein armer Cäsar«, sagte Konstanze zu ihrem Manne. »Ich denke, es geht uns jetzt so gut, daß wir uns ab und zu auch eine kleine Freude gestatten dürfen.«
»Darf ich das denn?« sagte der arme Mann. »Ach, Konstanze, deine Liebe ist das einzige Gut, das mir noch geblieben ist. Ja, ich habe alles verloren, sogar das Vertrauen zu mir, ich fühle keine Kraft mehr in mir, mein einziger Wunsch ist, noch so lange zu leben, bis ich meine irdischen Verpflichtungen erfüllt habe. Du, liebes Weib, du, die du für mich immer die Vorsicht und die Klugheit warst, du, die klar gesehen hat, du, die du dir keine Vorwürfe zu machen brauchst, du kannst dir eine Freude gönnen: ich allein bin unter uns dreien der Schuldige. Vor anderthalb Jahren, bei diesem verhängnisvollen Feste, da sah ich meine Konstanze, das einzige Weib, das ich geliebt habe, vielleicht in noch strahlenderer Schönheit vor mir als das junge Mädchen, mit dem ich vor zwanzig Jahren auf diesem Wege wandelte, auf dem jetzt unsere Kinder gehen! … In anderthalb Jahren habe ich diese Schönheit, meinen Stolz, meinen berechtigten Stolz, vernichtet … Je besser ich dich kenne, um so mehr liebe ich dich. Ach, Liebste,« sagte er mit einem Tone, der seiner Frau ans Herz ging, »ich wollte, daß du mich lieber scheltest, als daß ich sehen muß, wie du dich bemühst, mir meinen Kummer zu lindern.«
»Und ich, ich habe nicht gedacht,« erwiderte sie, »daß nach zwanzigjähriger Ehe die Liebe einer Frau zu ihrem Manne noch inniger werden könnte.«
Diese Worte ließen Cäsar für einen Augenblick all sein Unglück vergessen, denn für ein Herz wie das seine bedeuteten sie einen Schatz. Und so ging er beinahe heiter auf »ihren« Baum zu, der zufälligerweise nicht abgeschlagen worden war. Das Ehepaar ließ sich unter ihm nieder und sah auf Anselm und Cäsarine, die um dieselbe Wiese herumgingen, ohne es zu merken, und die wahrscheinlich glaubten, den andern noch immer voraus zu gehen.
»Liebes Fräulein,« sagte Anselm, »halten Sie mich für so niedrig gesinnt und so habgierig, daß ich den Anteil Ihres Vaters an dem Huile Céphalique erworben habe, um ihn für mich auszunutzen? Mit Freuden bewahre ich seine Hälfte für ihn auf und lege sie für ihn an. Und wenn mir dabei Wertpapiere zweifelhaft erscheinen, so übernehme ich sie auf meine Rechnung. Wir können einander erst am Tage nach der Rehabilitierung Ihres Vaters angehören, aber ich beschleunige dieses Datum mit all der Kraft, die die Liebe verleiht.«
Der Liebende hatte sich wohl gehütet, sein Geheimnis seiner Schwiegermutter zu verraten. Auch bei den harmlosesten Verliebten ist immer der Wunsch lebendig, in den Augen ihrer Geliebten groß zu erscheinen.
»Und wird das bald sein?« fragte sie.
»Bald«, erwiderte Popinot. Diese Antwort wurde in einem so zu Herzen gehenden Ton gegeben, daß die züchtige, reine Cäsarine ihrem geliebten Anselm ihre Stirn darbot, auf die er einen heißen, aber respektvollen Kuß drückte – soviel Adel lag in der Haltung dieses Kindes.
»Alles geht gut, Papa«, sagte sie mit schlauem Gesicht zu Cäsar. »Sei nett, plaudere mit uns und lege deine finstere Miene ab.«
Als die so innig vereinte Familie in Pilleraults Haus zurückkehrte, bemerkte Cäsar, ein so schlechter Beobachter er sonst war, doch in Ragons Wesen eine Veränderung, die auf ein wichtiges Ereignis schließen ließ. Auch Frau Ragons Begrüßung war so liebenswürdig, als ob ihr Blick und ihr Ton Cäsar zu verstehen geben wollten: »Wir sind bezahlt.«
Beim Nachtisch erschien der Notar von Sceaux; Pillerault bat ihn, Platz zu nehmen, und sah Birotteau an, der eine Überraschung zu ahnen begann, ohne sich ihre Bedeutung erklären zu können.
»Lieber Neffe, in diesen anderthalb Jahren haben die Ersparnisse deiner Frau, deiner Tochter und die deinigen zwanzigtausend Franken erbracht. Ich habe dreißigtausend Franken als Konkursdividende empfangen; wir können also deinen Gläubigern fünfzigtausend Franken bezahlen. Herr Ragon hat als Dividende ebenfalls dreißigtausend Franken erhalten; der Herr Notar bringt dir daher eine Quittung, daß deine Freunde voll, mit Zinsen, bezahlt sind. Der Rest der Summe liegt bei Crottat, zur Befriedigung Lourdois’, der Mutter Madou, des Maurer- und Tischlermeisters und deiner dringlichsten Gläubiger. Im nächsten Jahre wollen wir weiter sehen. Mit geduldigem Ausharren erreicht man viel.«
Birotteaus Freude war unbeschreiblich und weinend warf er sich dem Onkel in die Arme.
»Heute darf er sein Kreuz wieder anlegen«, sagte Ragon zum Abbé Loraux.
Der Beichtvater befestigte das rote Band am Knopfloch des Angestellten, der sich während des Abends zwanzigmal im Spiegel besah und eine Freude bezeigte, über welche Leute, die sich für erhaben über so etwas halten, gelacht hätten, die aber die guten Bürgersleute durchaus natürlich fanden. Am nächsten Tage begab sich Birotteau zu Frau Madou.
»Ach, Sie sind es, mein guter Kerl,« sagte sie zu ihm, »ich habe Sie gar nicht erkannt, so grau sind Sie geworden. Na, ihr, ihr verhungert nicht, ihr bekommt immer noch ne Stellung. Ich, ich arbeite wie ein Pferd in der Tretmühle und verdiene nicht das Wasser.«
»Aber Frau Madou …«
»Nein, nein, das soll kein Vorwurf sein,« sagte sie, »ich habe Ihnen ja quittiert.«
»Ich bin hergekommen, um Ihnen zu melden, daß ich heute bei dem Notar Crottat Ihnen den Rest Ihrer Forderung nebst Zinsen bezahlen werde.«
»Ist das wirklich wahr?«
»Seien Sie um ein halb zwölf Uhr dort …«
»Das ist anständig; volle Zahlung und vier Prozent«, sagte sie mit naiver Verwunderung. »Hören Sie, lieber Herr, ich mache gute Geschäfte mit Ihrem kleinen Rotkopp; der is anständig und läßt mich gut verdienen, ohne den Preis zu drücken, weil er mich entschädigen will; wissen Sie was, ich werde Ihnen eine Quittung geben, aber behalten Sie Ihr Geld, mein armer Alter! Die Madou ist hitzig und schreit leicht, aber hier hat sie auch was«, sagte sie und schlug sich dabei auf die dicksten Fleischkissen, die jemals in den Markthallen gesehen worden sind.
»Keinesfalls,« sagte Birotteau, »das Gesetz ist klar und deutlich, ich wünsche, Sie voll zu bezahlen.«
»Na, dann werde ich mich nicht länger bitten lassen«, sagte sie. »Aber morgen in der Markthalle, da werde ich Ihr ehrenwertes Verhalten überall herumerzählen. Ach, das is eine Seltenheit, diese Geschichte!«
Dieselbe Szene spielte sich bei Crottats Schwiegervater, dem Stubenmaler, aber in etwas anderer Form ab. Es regnete draußen und Cäsar hatte seinen Schirm an die Tür gestellt. Der reichgewordene Malermeister war nicht sehr liebenswürdig, als er bemerkte, wie das Wasser auf den Fußboden seines schönen Speisezimmers lief, wo er mit seiner Frau beim Dejeuner saß.
»Also was wünschen Sie, armer Vater Birotteau?« sagte er in dem groben Tone, in dem die Leute mit lästigen Bettlern zu sprechen pflegen.
»Herr Lourdois, hat Ihnen Ihr Schwiegersohn nicht mitgeteilt …«
»Was denn?« fragte Lourdois ungeduldig, der an irgendeine Bettelei dachte.
»Daß Sie sich heute vormittag um einhalb zwölf Uhr bei ihm einfinden sollen, um mir über meine volle Zahlung Quittung zu erteilen? …«
»Ach, das ist etwas anderes; aber nehmen Sie doch Platz, Herr Birotteau, und essen Sie einen Bissen mit uns …«
»Machen Sie uns doch das Vergnügen, mit uns zu frühstücken«, sagte Frau Lourdois.
»Nein, Herr Lourdois, ich muß alle Tage aus der Hand an meinem Schreibtisch frühstücken, um etwas Geld zu verdienen; aber mit der Zeit hoffe ich, allen Schaden, den ich meinen Nächsten verursacht habe, wieder gutmachen zu können.«
»Wahrhaftig,« sagte der Malermeister und schob eine Schnitte mit Gänseleberpastete in den Mund, »Sie sind ein Ehrenmann.«
»Und was macht Frau Birotteau?« sagte Frau Lourdois.
»Sie führt Herrn Anselm Popinot die Bücher und die Kasse.«
»Arme Leute«, sagte Frau Lourdois zu ihrem Manne.
»Wenn Sie mich brauchen sollten, mein lieber Herr Birotteau, kommen Sie nur zu mir,« sagte Lourdois, »vielleicht kann ich Ihnen helfen …«
»Ich brauche Sie nur heute um elf Uhr, Herr Lourdois«, sagte Birotteau und entfernte sich. Dieses erste Ergebnis machte dem Kridar Mut, wenn es ihm auch noch nicht seine Ruhe wiedergab; der Wunsch nach Wiederherstellung seiner Ehre rieb ihn übermäßig auf; er hatte seine blühende Gesichtsfarbe völlig verloren, sein Blick war erloschen, sein Antlitz abgemagert. Wenn alte Bekannte Cäsar früh um acht oder nachmittags um vier Uhr auf seinem Hin- und Rückwege in der Rue de l’Oratoire begegneten, in demselben Überrock, den er zur Zeit der Katastrophe getragen hatte, und den er, wie ein armer Unterleutnant seine Uniform, schonte, mit ganz weiß gewordenem Haar, bleich und ängstlich, so hielten ihn einige gegen seinen Wunsch fest, obwohl er, um sich spähend, auszuweichen suchte, indem er wie ein Dieb an den Mauern entlangschlich.
»Ihr ehrenhaftes Verhalten ist allgemein bekannt, lieber Freund«, sagten sie zu ihm. »Aber alle bedauern, daß Sie, ebenso wie Ihre Tochter und Ihre Frau, so hart gegen sich selbst verfahren.«
»Gönnen Sie sich doch etwas mehr Zeit«, sagten andere, »an einer Geldwunde stirbt man nicht.«
»Nein, aber an einer Seelenwunde«, antwortete der arme ermattete Cäsar einmal Matifat.
Zu Beginn des Jahres 1822 wurde der Bau des Kanals Saint-Martin beschlossen. Die im Faubourg du Temple gelegenen Terrains erreichten wahnsinnige Preise. Nach dem Projekt sollte das Grundstück du Tillets, das früher Cäsar Birotteau gehörte, in der Mitte durchschnitten werden. Die Gesellschaft, die die Baukonzession für den Kanal erhalten hatte, wollte ihm einen ungeheuren Preis zahlen, wenn der Bankier das Terrain zu einem bestimmten Termin übergeben könnte. Der Mietvertrag, den Cäsar mit Popinot geschlossen hatte, verhinderte das. Der Bankier suchte deshalb den Drogisten in der Rue des Cinq-Diamants auf. Wenn Popinot auch du Tillet gleichgültig war, so empfand Cäsarines Verlobter einen instinktiven Haß gegen diesen Menschen. Er kannte weder den Diebstahl noch die niederträchtigen Machenschaften des erfolgreichen Bankiers, aber eine innere Stimme sagte ihm: Dieser Mensch ist ein strafloser Dieb. Popinot hätte nicht das kleinste Geschäft mit ihm machen mögen, seine Gegenwart war ihm verhaßt. Dazu mußte er gerade jetzt sehen, wie du Tillet sich an dem, dessen er seinen früheren Prinzipal beraubt hatte, bereicherte, denn der Wert der Terrains an der Madeleine begann schon so zu steigen, daß man die Riesenpreise ahnen konnte, die sie im Jahre 1827 erreichten. Als der Bankier daher den Anlaß seines Besuchs ihm mitgeteilt hatte, betrachtete ihn Popinot mit erhöhter Entrüstung.
»Ich will es nicht ablehnen, von meinem Mietvertrage zurückzutreten, aber ich verlange dafür sechzigtausend Franken und werde keinen Heller von dieser Summe ablassen.«
»Sechzigtausend Franken?« rief du Tillet aus und machte Anstalten, sich zu entfernen.
»Ich habe noch fünfzehn Jahre Kontrakt und müßte für eine neue Fabrik jährlich dreitausend Franken mehr ausgeben. Also es bleibt bei sechzigtausend Franken, oder wir brauchen über die Sache nicht weiter zu reden«, sagte Popinot und ging in den Laden zurück, wohin ihm du Tillet folgte.
Die Diskussion wurde lebhaft, und es fiel der Name Birotteau, als Frau Konstanze gerade herunterkam, die du Tillet seit dem berühmten Ball zum erstenmal wiedersah. Der Bankier konnte beim Anblick der Veränderung, die das Aussehen seiner ehemaligen Prinzipalin erfahren hatte, ein Zeichen der Überraschung nicht zurückhalten und schlug, erschreckt über sein Werk, die Augen nieder.
»Der Herr«, sagte Popinot zu Frau Birotteau, »verdient an ›Ihren‹ Terrains dreihunderttausend Franken und will uns nicht sechzigtausend Franken Entschädigung für unsern Mietvertrag gewähren …«
»Das sind dreitausend Franken Rente«, sagte du Tillet emphatisch.
»Dreitausend Franken! …« wiederholte Frau Konstanze einfach, aber mit eindringlicher Betonung. Du Tillet erblaßte. Popinot sah Frau Birotteau an. Es entstand einen Augenblick ein tiefes Schweigen, das diese Szene für Anselm noch unerklärlicher machte.
»Unterzeichnen Sie Ihren Abstand, ich habe das Schriftstück schon von Crottat entwerfen lassen,« sagte du Tillet und zog ein gestempeltes Papier aus seiner Seitentasche, »ich werde Ihnen einen Scheck auf die Bank über sechzigtausend Franken ausstellen.«
Popinot sah Frau Konstanze mit unverhohlenem Erstaunen an; er glaubte zu träumen. Während du Tillet den Scheck an einem Stehpult unterzeichnete, verschwand sie und ging wieder in den Zwischenstock hinauf. Der Drogist und der Bankier tauschten ihre Papiere aus und du Tillet entfernte sich mit kühlem Gruße.
»Endlich!« sagte Popinot und sah du Tillet nach, der nach der Rue des Lombards ging, wo sein Cabriolet hielt. »Dank diesem eigenartigen Vorfall werde ich in wenigen Monaten Cäsarine mein nennen können. Mein armes, kleines Weib wird sich dann nicht länger tot zu arbeiten brauchen. Aber wie merkwürdig! Ein einziger Blick Frau Konstanzes hat das bewirkt! Was für ein Zusammenhang besteht zwischen ihr und diesem Räuber? Was sich hier eben ereignet hat, ist höchst eigentümlich.«