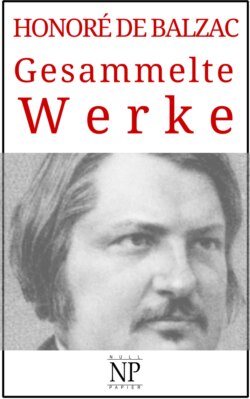Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 40
14
ОглавлениеEs folgte nun eine breite Ausführung über diesen Gegenstand, wobei der Graf von Grandville, seiner Rolle entsprechend, Gelegenheit fand, die Liberalen, die Bonapartisten und andere Gegner des Königshauses zu beschuldigen. Die Ereignisse der Folgezeit haben bewiesen, daß dieser Beamte mit seinen Befürchtungen recht behalten hat.
»Die Flucht eines Pariser Notars, der die von Birotteau bei ihm hinterlegten Werte unterschlagen hat,« fuhr er fort, »hat den Ruin des Antragstellers entschieden. In dieser Sache hat der Gerichtshof ein Urteil gefällt, aus dem ersichtlich ist, in welchem Grade das Vertrauen der Klienten Roguins in unwürdiger Weise mißbraucht worden ist. Es kam nun ein Vergleich zustande. Zur Ehre des Antragstellers muß hierzu bemerkt werden, daß sein Verhalten hierbei von einer rühmenswerten Lauterkeit gewesen ist, wie man ihr bei keinem der skandalösen Konkurse, durch die die Pariser Handelswelt täglich geschädigt wird, begegnet ist. Die Gläubiger Birotteaus fanden auch die geringste Habe des Unglücklichen zu ihrer Verfügung vor: seine Kleider, meine Herren Richter, seine Schmucksachen, Dinge des täglichen Gebrauchs, und zwar nicht nur die seinigen, sondern auch die seiner Frau, die auch auf alle ihre Rechte zugunsten der Konkursmasse verzichtete. Damit hat sich Birotteau des Ansehens, das ihm sein städtisches Ehrenamt eingetragen hatte, würdig erwiesen; er war damals Beigeordneter des Bürgermeisters im zweiten Bezirk und hatte eben das Kreuz der Ehrenlegion erhalten, das ihm ebensosehr wegen seiner royalistischen Hingebung, mit der er im Vendémiaire auf den Stufen von Saint-Roch gekämpft hatte, die mit seinem Blute gerötet wurden, wie für seine Tätigkeit als Handelsrichter, in der er wegen seines klaren Urteils geschätzt und wegen seiner vermittelnden Hilfsbereitschaft verehrt wurde, und seiner Stellung als bescheidener städtischer Beamter, der die Ehre, Bürgermeister zu werden, abgelehnt und hierfür auf einen Würdigeren, den verehrten Herrn von Billardière, einen der edelsten Vendéer, hingewiesen hat, den er in den schlimmen Tagen schätzen gelernt hatte.«
»Diese Wendung ist schöner als meine«, sagte Cäsar leise zu seinem Onkel.
»Da die Gläubiger infolge des loyalen Verhaltens dieses Kaufmanns, seiner Frau und seiner Tochter, die ihre ganze Habe hergegeben hatten, eine Dividende von sechzig Prozent auf ihre Forderungen erhielten, unterzeichneten sie den Vergleich unter Betonung ihrer Hochachtung für den Schuldner und verzichteten auf den Rest ihrer Ansprüche. Ich lenke die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs auf den Text dieses Vergleichs hin.«
Hier verlas der Generalstaatsanwalt die betreffende Stelle des Vergleichs.
»Angesichts einer so wohlwollenden Stellungnahme, meine Herren Richter, würden viele Kaufleute sich ihrer Verpflichtungen für enthoben angesehen haben und stolzen Hauptes wieder in der Öffentlichkeit erschienen sein. Weit entfernt hiervon, beschloß Birotteau, ohne sich entmutigen zu lassen, sich den glorreichen Tag, der heute zu seinem Ruhme erschienen ist, zu erobern. Und davon hat er sich durch nichts abschrecken lassen. Von unserm vielgeliebten Monarchen wurde ihm eine Stellung gegeben, damit der bei Saint Roch Verwundete sein Brot hätte; dieser aber bewahrte sein Gehalt für seine Gläubiger auf und verbrauchte nichts davon für seinen Unterhalt, denn die hingebende Fürsorge seiner Familie stand ihm zur Seite …«
Hier drückte Birotteau weinend seinem Onkel die Hand.
»Auch seine Frau und seine Tochter legten den Ertrag ihrer Arbeit in die gemeinsame Sparbüchse, denn sie teilten Birotteaus edle Grundsätze. Beide entsagten ihrer Stellung, um eine niedrigere anzunehmen. Solche Opfer, meine Herren Richter, verdienen laut gerühmt zu werden, denn sie sind am schwersten von allen zu bringen. Folgende Aufgabe hatte sich Birotteau gestellt.«
Der Generalstaatsanwalt verlas nun die Konkurstabelle und benannte die noch geschuldeten Beträge und die Namen der Gläubiger.
»Ein jeder dieser Schuldbeträge ist bezahlt worden und zwar mit Zinsen, meine Herren Richter, und nicht etwa gegen einfache Quittungen, die eine strenge Nachprüfung erfordern, sondern gegen authentische Quittungen, die der gewissenhaftesten richterlichen Prüfung standhalten, und die amtlich in der gesetzlich vorgeschriebenen Form als richtig befunden worden sind. Sie werden Birotteau nicht seine Ehre, aber die Rechte, deren er sich beraubt sah, wieder zusprechen und Sie werden damit ein gerechtes Urteil fällen. Ein solcher Fall unterliegt so selten Ihrer Prüfung, daß wir nicht unterlassen können, dem Antragsteller auszusprechen, wie freudig wir ein solches Verhalten begrüßen, das schon durch allerhöchste Gunst ermutigt worden ist.« Dann stellte er seine formellen Anträge im üblichen Gerichtsstil.
Der Gerichtshof faßte seinen Beschluß, ohne sich zur Beratung zurückzuziehen, und der Präsident erhob sich, um das Urteil zu verkünden. »Der Gerichtshof«, sagte er zum Schlusse, »hat mich beauftragt, Birotteau seine Genugtuung darüber auszusprechen, daß er ein solches Urteil fällen konnte. Gerichtsdiener, die nächste Sache.«
Birotteau, den die Redewendungen des berühmten Generalstaatsanwalts wie mit einem Ehrenkleide umhüllt hatten, war vor Freude wie zerbrochen, als er den feierlichen Urteilsspruch aus dem Munde des ersten Präsidenten des höchsten französischen Gerichtshofes vernahm, der zeigte, daß auch die unerschütterliche Rechtsprechung ein menschliches Empfinden kannte. Er vermochte seinen Platz an den Schranken nicht zu verlassen, er stand wie angenagelt da und starrte bewegungslos die Richter an, als seien es Engel, die ihm die Tore zu der menschlichen Gesellschaft wieder geöffnet hatten; der Onkel nahm ihn beim Arm und zog ihn mit sich fort in die Vorhalle. Jetzt steckte sich Cäsar, der der Weisung Ludwigs XVIII. nicht Folge geleistet hatte, mechanisch das Band der Ehrenlegion ins Knopfloch und wurde sogleich von seinen Freunden umringt und im Triumph in den Wagen getragen.
»Wohin wollt ihr mich denn bringen, liebe Freunde?« sagte er zu Joseph Lebas, Pillerault und Ragon.
»Nach Hause.«
»Nein, es ist drei Uhr, ich will von meinen Rechten wieder Gebrauch machen und zur Börse gehen.«
»Zur Börse«, rief Pillerault dem Kutscher zu und gab Lebas einen deutlichen Wink, denn er hatte bei dem Rehabilitierten beunruhigende Symptome wahrgenommen und fürchtete, daß er von Sinnen kommen könnte.
Der ehemalige Parfümhändler betrat nun den Börsensaal am Arme seines Onkels und Lebas’, der beiden angesehenen Kaufleute. Seine Rehabilitierung war schon bekannt geworden. Die erste Person, die die drei Kaufleute, denen Ragon folgte, bemerkte, war du Tillet.
»Ah, mein verehrter Prinzipal, ich bin entzückt, zu sehen, daß Sie sich herausgezogen haben. Und ich habe wohl durch die Bereitwilligkeit, mit der ich mich von dem kleinen Popinot habe rupfen lassen, zu diesem erfreulichen Ende Ihrer Sorgen beigetragen. Ich freue mich über diese glückliche Lösung ebenso, als ob sie mich selbst beträfe.«
»Das kann auch nicht gut anders sein,« sagte Pillerault, »Ihnen wäre so etwas nie passiert.«
»Wie soll ich das verstehen, Herr Pillerault?« fragte du Tillet.
»Im guten Sinne«, sagte Lebas und lächelte über die vergeltende Bosheit Pilleraults, der, ohne etwas Näheres zu wissen, diesen Menschen für einen Bösewicht hielt.
Jetzt bemerkte Matifat Cäsar. Sogleich umringten die namhaftesten Kaufleute den früheren Parfümhändler und die Börse brachte ihm eine Ovation dar; er empfing die schmeichelhaftesten Glückwünsche und Händedrücke, die viel Neid erregten und auch bei manchem Gewissensbisse erweckten, denn von hundert Anwesenden hatten mehr als fünfzig schon einmal liquidiert. Gigonnet und Gobseck, die sich in einer Ecke unterhielten, betrachteten den tugendhaften Parfümhändler mit Augen, wie Physiker den ersten elektrischen Zitteraal, der ihnen gebracht wurde, betrachtet haben müssen. Dieser Fisch, der mit Elektrizität wie eine Leydener Flasche geladen ist, wird als die merkwürdigste Erscheinung des Tierreichs angesehen. Nachdem er den Weihrauch seines Triumphes genügend ausgekostet hatte, stieg Cäsar wieder in den Wagen, um in sein Haus zurückzukehren, wo der Ehevertrag seiner geliebten Cäsarine und des getreuen Popinot unterzeichnet werden sollte. Ein nervöses Lachen, das ihn befallen hatte, beunruhigte seine drei alten Freunde. Es ist ein Fehler der Jugend, zu glauben, jedermann erfreue sich derselben Kraft wie sie, ein Fehler, der aber aus ihren Vorzügen entspringt; statt Menschen und Dinge durch eine scharfe Brille zu sehen, sieht sie sie, unter dem Reflex ihrer eigenen Glut, rosig gefärbt, und möchte ihre überschäumende Lebenslust auch den alten Leuten mitteilen. Wie Cäsar und Konstanze, so hatte auch Popinot das prächtige Bild des von Birotteau gegebenen Balles in seinem Gedächtnis bewahrt. Während ihrer drei Prüfungsjahre hatten Konstanze und Cäsar, ohne es sich zu gestehen, Collinets Orchestermusik oft in den Ohren gehabt, sie hatten die glänzende Gesellschaft wieder vor sich gesehen und das so grausam bestrafte freudige Gefühl empfunden, ebenso wie Adam und Eva zuweilen an die verbotene Frucht zurückdenken mußten, die ihrer ganzen Nachkommenschaft den Tod und das Leben gebracht hat, denn die Neuerschaffung von Engeln scheint ein göttliches Geheimnis zu sein. Aber Popinot konnte an dieses Fest ohne Gewissensbisse und mit Entzücken zurückdenken; Cäsarine hatte sich damals in all ihrem Glanze ihm, dem armen Jungen, zugesagt. An diesem Abend hatte er die Gewißheit erlangt, um seiner selbst willen geliebt zu werden! Als er daher die von Grindot eingerichtete Wohnung für Cölestin erworben hatte mit der Bedingung, daß alles darin unberührt bleiben müsse, als er auch die geringste Kleinigkeit, die Cäsar und Konstanze gehört hatte, wie ein Heiligtum aufbewahrte, hatte er immer davon geträumt, auch seinen Ball zu geben, ein Hochzeitsballfest. Er hatte dieses Fest mit Liebe vorbereitet, aber dabei seinen Prinzipal nur in den notwendigen, nicht in seinen unsinnigen Ausgaben nachgeahmt; die unsinnigen waren ja bereits gemacht worden. So sollte das Diner von Chevet geliefert werden und die Gäste ungefähr dieselben sein. Der Abbé Loraux trat an die Stelle des Großkanzlers der Ehrenlegion, auch der Präsident des Handelsgerichts, Lebas, fehlte nicht. Popinot hatte auch Herrn Camusot eingeladen, um sich für die Rücksicht, die er Birotteau erwiesen hatte, erkenntlich zu zeigen. Die Herren von Vandenesse und von Fontaine kamen an Stelle Roguins und seiner Frau. Cäsarine und Popinot hatten in bezug auf die Balleinladungen eine sorgfältige Auswahl getroffen. Beide scheuten sich in gleicher Weise vor der Öffentlichkeit bei der Hochzeitsfeier selbst; sie hatten sich deshalb dieses für zartfühlende, reine Herzen peinliche Gefühl erspart und den Ball für den Tag der Unterzeichnung des Ehevertrages angesetzt. Konstanze hatte ihr kirschrotes Kleid vorgefunden, in dem sie ein einziges Mal in, ach so flüchtigem Glanze erschienen war! Cäsarine hatte Popinot die Überraschung bereitet, sich wieder in der Balltoilette zu zeigen, von der er immer und immer wieder mit ihr gesprochen hatte. So sollte Birotteau in seiner Wohnung das bezaubernde Schauspiel wieder vor sich sehen, das er nur an einem einzigen Abend genossen hatte. Weder Konstanze, noch Cäsarine, noch Anselm hatten eine Ahnung davon, daß diese Riesenüberraschung Cäsar gefährlich werden könnte, und sie erwarteten ihn um vier Uhr mit einer Freude, die sie Kindereien treiben ließ.
Nach der unaussprechlichen Erregung, die ihm die Rückkehr zur Börse verursacht hatte, sollte dieser Held der kaufmännischen Redlichkeit noch die Überraschung ertragen, die ihn in der Rue Saint-Honoré erwartete. Als er sein altes Haus betrat und am Fuße der Treppe, die unberührt geblieben war, seine Frau in ihrem kirschroten Sammetkleide, Cäsarine, den Grafen von Fontaine, den Vicomte von Vandenesse, den Baron von La Billardière, den berühmten Vauquelin erblickte, da breitete sich ein leichter Schleier über seine Augen, und der Onkel Pillerault, der ihm den Arm reichte, fühlte, wie er erzitterte.
»Das ist zu viel,« sagte der Philosoph zu dem verliebten Anselm, »er wird soviel Wein, wie du ihm einschenkst, nicht vertragen können.«
Die Freude war eine so allgemeine, daß alle die Erregung Cäsars und sein Schweigen der natürlichen Freudetrunkenheit zuschrieben, die aber nicht selten tödlich werden kann. Als er sich in seinem alten Heim wiederfand, als er den Salon, die Gäste, die festlich in Balltoilette erschienenen Damen wiedersah, da rauschte plötzlich das heroische Schlußmotiv der großen Beethovenschen Symphonie ihm durch Kopf und Herz. Die himmlische Musik ertönte mit ihrem strahlenden Glanze, jubelte in allen Übergängen und ließ ihre Trompetenklänge in allen Windungen dieses übermüdeten Gehirns widerhallen, für das sie das große Finale bedeuten sollte.
Überwältigt von diesem inneren Musikrauschen, faßte er den Arm seiner Frau und sagte leise mit von einem zurückgehaltenen Blutstrom erstickter Stimme: »Mir ist nicht wohl!«
Die erschreckte Konstanze führte ihren Mann in ihr Zimmer, bis zu dem er mühsam gelangte; hier sank er in einen Sessel und sagte:
»Herrn Haudry, Herrn Loraux!«
Der Abbé Loraux erschien, gefolgt von den Gästen und den Damen in Balltoilette, die alle stehen blieben und eine entsetzte Gruppe bildeten. Angesichts dieser Festgesellschaft drückte Cäsar seinem Beichtvater die Hand und neigte das Haupt auf die Brust seiner vor ihm knienden Frau. Ein Gefäß war ihm in der Brust gesprungen und eine Aortageschwulst erstickte sein letztes Atmen.
»Hier stirbt ein Gerechter«, sagte der Abbé Loraux in ernstem Tone und wies auf Cäsar mit jener göttlichen Gebärde hin, wie sie Rembrandt auf seinem Gemälde »Die Auferweckung des Lazarus durch Christus« wiederzugeben vermocht hat. Jesus heißt hier die Erde, ihre Beute zurückgeben, der fromme Priester zeigte dem Himmel einen Märtyrer der kaufmännischen Redlichkeit, damit er ihn mit der ewigen Palme kröne.