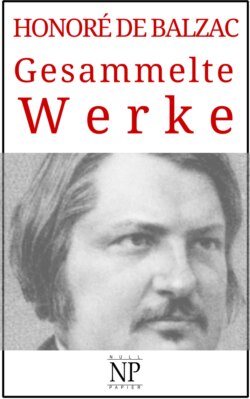Читать книгу Honoré de Balzac – Gesammelte Werke - Оноре де'Бальзак, Honoré de Balzac, Balzac - Страница 36
10
ОглавлениеWas Frau Konstanze selbst anlangt, so ging sie noch am selben Tage zu Popinot und bat ihn, seine Kasse und Buchführung übernehmen und ihm die Wirtschaft führen zu dürfen. Popinot verstand, daß sein Haus das einzige war, wo die Frau des Parfümhändlers mit dem schuldigen Respekt behandelt werden würde, auf den sie ihrer Stellung nach, wenn sie sich nicht erniedrigen wollte, Anspruch hatte.
Mit seinem vornehmen Empfinden gab er ihr ein Gehalt von dreitausend Franken jährlich nebst Verpflegung und ließ sein Zimmer für sie herrichten, während er sich das Mansardenzimmer eines seiner Kommis nahm. So mußte die schöne Parfümhändlerin, nachdem sie einen Monat lang sich der Pracht ihrer Wohnung hatte erfreuen können, jetzt in dem abscheulichen Zimmer mit dem Blick auf den dunklen feuchten Hof hausen, wo Gaudissart, Anselm und Finot das Stiftungsfest für das Huile Céphalique gefeiert hatten.
Als Molineux, der vom Handelsgericht ernannte Agent, die Aktiva Cäsar Birotteaus in Beschlag nahm, stellte Konstanze mit Cölestins Unterstützung die Inventur auf. Dann entfernten sich Mutter und Tochter in einfacher Kleidung und begaben sich zu ihrem Onkel Pillerault, ohne auch nur einmal ihr Haupt nach dem Hause zurückzuwenden, in dem sie den dritten Teil ihres Lebens verbracht hatten. Schweigend setzten sie ihren Weg nach der Rue Bourdonnais fort, wo sie zum erstenmal seit ihrer Trennung mit Cäsar zusammen aßen. Es war eine traurige Mahlzeit. Jeder hatte Zeit zum Nachdenken gehabt, sich den Umfang der übernommenen Pflichten klargemacht und seine Standhaftigkeit geprüft. Sie fühlten sich alle drei wie Matrosen, die bereit sind, mit dem Unwetter zu kämpfen, ohne sich die Gefahr zu verhehlen. Birotteau faßte wieder Mut, als er vernahm, mit welchem Eifer hohe Persönlichkeiten für ihn gesorgt hatten; aber er mußte weinen, als er erfuhr, welche Stellung seine Tochter annehmen sollte. Dann drückte er seiner Frau die Hand, als er sah, mit welcher Tapferkeit sie wieder anfangen wollte zu arbeiten. Dem Onkel Pillerault wurden zum letztenmal in seinem Leben die Augen naß bei dem Anblick des rührenden Bildes dieser drei miteinander vereinigten und verschmolzenen Wesen, von denen das schwächste und niedergeschlagenste, Birotteau, die Hand erhob und sagte: »Wir wollen wieder hoffen!«
»Der Ersparnis halber«, sagte der Onkel, »wirst du bei mir bleiben und mein Zimmer und mein Brot mit mir teilen. Ich habe mich schon lange so allein gelangweilt, du wirst mir mein armes Kind, das ich verloren habe, ersetzen. Von hier hast du nach der Rue de l’Oratoire zu deiner Kasse auch nur ein paar Schritte.«
»Gütiger Gott,« rief Birotteau aus, »mitten im Unwetter leitet mich noch ein freundlicher Stern.«
Wenn der Unglückliche sich in sein Schicksal ergeben hat, dann hat er seinem Unglück eine Grenze gesetzt. Da Birotteaus Sturz nunmehr eine vollzogene Tatsache war, sträubte er sich nicht mehr dagegen und gewann seine Kraft wieder zurück. Ein Kaufmann, der Konkurs angemeldet hat, dürfte sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen, als eine Oase in Frankreich oder im Auslande aufzusuchen, um dort zu leben und sich mit nichts zu befassen, wie ein Kind, das er ja jetzt ist; denn das Gesetz erklärt ihn für minorenn und für unfähig, irgendeinen öffentlich- oder privatrechtlichen Akt zu vollziehen. In Wirklichkeit geschieht das jedoch nicht so. Bevor er sich wieder sehen läßt, wartet er einen Geleitsbrief ab, dessen Ausstellung noch niemals von einem Konkursverwalter oder Gläubiger verweigert worden ist, denn wenn er ohne dieses »exeat« betroffen würde, müßte er verhaftet werden, während er im Besitz dieses Schutzbriefes sich als Parlamentär auf feindlichem Gebiet bewegen kann, nicht aus Neugierde, sondern um den dem Konkursschuldner feindlichen Gesetzesbestimmungen entgegenzuwirken. Jedes Gesetz, das in das Privateigentum eingreift, muß notwendigerweise die Fähigkeit, Betrügereien zu ersinnen, ausgiebig entwickeln. Das Denken des Bankrotteurs wie das eines jeden, dessen Interessen durch irgendein Gesetz geschädigt werden, richtet sich darauf, es in bezug auf sich unwirksam zu machen. Dieser Zustand des bürgerlichen Todes, in dem der in Konkurs Geratene wie eine Schmetterlingspuppe verharren muß, währt etwa drei Monate, welche Zeit für die Formalitäten erforderlich ist, bevor man zu der Versammlung schreitet, in der die Gläubiger und der Schuldner einen Friedensvertrag schließen, eine Transaktion, die der »Vergleich« genannt wird. Diese Bezeichnung zeigt deutlich genug, daß nach dem Sturm, der durch die gewaltsam verletzten Interessen erregt war, nunmehr wieder Einvernehmen herrscht.
Zur Prüfung der Forderungen ernennt das Handelsgericht nun sofort einen Konkursverwalter, der über die Interessen der Masse der unbekannten Gläubiger zu wachen und den Schuldner gegen vexatorische Angriffe seiner gereizten Gläubiger zu schützen hat; eine Doppelrolle, die zu spielen vortrefflich wäre, wenn die Konkursverwalter die Zeit dazu hätten. Der Konkursverwalter überträgt jetzt einem Agenten das Recht, die Hand auf das Geschäft, die Immobilien, die Waren zu legen und die in der Bilanz aufgeführten Aktiva nachzuprüfen; endlich erläßt der Gerichtsschreiber eine Aufforderung an alle Gläubiger, die mit dem Trompetenton der Annonce in den Zeitungen bekanntgemacht wird. Die angeblichen oder wirklichen Gläubiger werden dadurch verpflichtet, eiligst zusammenzutreten und die provisorischen Syndici zu ernennen, die an die Stelle des Agenten treten, sich die Schuhe des Schuldners anziehen, durch eine Fiktion des Gesetzes der Kridar1 selber werden, um nun alles zu liquidieren, zu verkaufen, über alles Verträge abzuschließen, kurz, alles zugunsten der Gläubiger zu Geld zu machen, wenn sich der Schuldner nicht widersetzt. Die Mehrzahl der Pariser Kridare verständigt sich mit den provisorischen Syndici, und zwar aus folgendem Grunde: Die Ernennung eines oder mehrerer definitiver Syndici ist ein Akt leidenschaftlicher Erregung seitens der rachebedürftigen, betrogenen, verhöhnten, verspotteten, gefoppten, bestohlenen und getäuschten Gläubiger. Obwohl nun die Gläubiger ja ziemlich allgemein getäuscht, bestohlen, gefoppt, verhöhnt und betrogen werden, so gibt es doch in Paris innerhalb der Kaufmannschaft keine Aufregung, die länger als drei Monate andauerte. Im Geschäftsleben werden Handelswechsel, da man stets auf die Einlösung wartet, nur auf drei Monate ausgestellt. Nach drei Monaten schlafen die von allem Hinundherrennen, wie es ein Konkurs mit sich bringt, todmüde gewordenen Gläubiger an der Seite ihrer vortrefflichen kleinen Frauen. Hiernach werden die Ausländer begreifen, wie sehr in Frankreich das Provisorische definitiv ist; von tausend provisorischen Syndici werden nicht fünf zu definitiven. Man begreift also, weshalb sich der durch einen Konkurs hervorgerufene Haß legen muß. Aber für diejenigen, die nicht so glücklich sind, Kaufleute zu sein, muß doch das dramatische Schauspiel eines Konkurses näher erklärt werden, damit sie verstehen, wie er in Paris zu einer ungeheuerlichen gesetzlichen Farce wird, und wie Cäsars Fallissement eine außergewöhnliche Ausnahme bildete.
Dieses schöne kaufmännische Drama hat drei wohl zu unterscheidende Akte: erster Akt: der Agent, zweiter Akt: die Syndici, dritter Akt: der Vergleich. Es gibt hier, wie bei allen Theaterstücken, ein doppeltes Schauspiel: die Inszenierung für das Publikum und die Arbeit hinter der Szene, die Vorstellung, wie sie das Publikum sieht, und wie sie von den Kulissen aus gesehen erscheint. Hinter den Kulissen befinden sich der Schuldner und sein Anwalt, der Advokat der Kaufleute, die Syndici, der Agent und endlich der Konkursverwalter. Niemand außerhalb von Paris hat eine Ahnung davon und niemandem in Paris ist es unbekannt, daß ein Richter beim Handelsgericht der eigenartigste Beamte ist, den eine Gesellschaft hatte erdenken können. Dieser Richter muß befürchten, daß sich die Justiz jeden Augenblick gegen ihn selbst wenden kann. Paris hat das Schauspiel erlebt, daß der Präsident eines Handelsgerichts genötigt war, Konkurs anzumelden. Anstatt daß man einen alten Kaufmann, der sich von den Geschäften zurückgezogen hat und für den ein solches Amt eine Anerkennung für ein ehrenhaft geführtes Leben bedeuten würde, nähme, ist der Richter ein mit ungeheuren Unternehmungen überlasteter, an der Spitze eines riesigen Hauses stehender Geschäftsmann. Die conditio sine qua non bei der Wahl dieses Richters, der über die Flut von Handelsprozessen, die unaufhörlich in der Hauptstadt anhängig gemacht werden, urteilen soll, ist also, daß er Mühe haben muß, seine eigenen Geschäfte zu erledigen. Das Handelsgericht, das ein geeignetes Übergangsstadium für einen Kaufmann darstellen sollte, der hier, ohne sich lächerlich zu machen, in die Kreise des Adels aufsteigen könnte, setzt sich statt dessen aus Geschäftsleuten zusammen, die mitten in ihrer Tätigkeit stehen und unter ihren Entscheidungen leiden können, wenn sie mit einer Gegenpartei, wie Birotteau mit du Tillet, zu tun haben, die damit unzufrieden ist.
Der Konkursverwalter ist daher notgedrungen eine Person, vor der viele Worte gewechselt werden, der sie anhört, während er an sein Geschäft denkt und das öffentliche Verfahren den Syndicis und dem Anwalt überläßt, abgesehen von gewissen eigenartigen, ungewöhnlichen Fällen, wo die Betrügereien sich unter merkwürdigen Formen vollzogen haben und ihn zu der Bemerkung veranlassen, daß die Gläubiger oder der Schuldner geschickte Leute sein müssen. Diese Persönlichkeit, die in dem Drama dieselbe Rolle spielt wie die Königsbüste in einem Audienzsaal, sieht man früh zwischen fünf und sieben Uhr auf ihrem Holzhof, wenn es ein Holzhändler, in seinem Laden, wenn es, wie früher Birotteau, ein Parfümhändler ist; abends am Schluß des Diners zwischen Käse und Birne – aber immer in fürchterlicher Hetze. Diese Persönlichkeit ist also im allgemeinen stumm. Aber seien wir nicht ungerecht gegen das Gesetz; die in Eile gemachten Gesetze, die diese Materie regeln, haben dem Konkursverwalter die Hände gebunden, und wiederholt muß er zu Betrügereien seine Zustimmung geben, weil er, wie wir gleich sehen werden, nicht die Macht hat, sie zu verhindern.
Der Agent kann auch, anstatt der Mann der Gläubiger zu sein, der Mann des Schuldners werden. Jeder hofft, seinen Anteil an der Dividende zu vergrößern, indem er sich eine Bevorzugung seitens des Kridars verschafft, bei dem man immer zurückbehaltene Werte vermutet. Der Agent kann sich beiden Seiten zur Verfügung stellen, sei es, daß er die Geschäfte des Kridars nicht zugrunde richtet, oder daß er für einflußreiche Leute etwas beiseite bringt: er schützt also die Ziege und den Kohlkopf. Häufig hat ein geschickter Agent es nicht zum Urteilsspruch kommen lassen, indem er die Forderungen ankaufte und dem Kaufmann wieder aufhalf, der dann wie ein Gummiball in die Höhe sprang. Der Agent hält sich an die am reichsten gefüllte Futterkrippe, sei es, daß er dazu neigt, die stärksten Gläubiger zu decken und den Schuldner preiszugeben, sei es, daß er die Gläubiger lieber der Zukunft des Schuldners opfert. So ist das, was der Agent tut, entscheidend. Er, ebenso wie der Anwalt, ist für jede Rolle in diesem Stücke zu gebrauchen; sie übernehmen die Rolle aber nur, wenn ihr Honorar sichergestellt ist. Unter durchschnittlich tausend Konkursen ist der Agent neunhundertfünfzigmal der Mann des Schuldners. Zur Zeit, in der diese Geschichte spielt, schlugen die Anwälte fast immer dem Konkursverwalter ihren Agenten zur Ernennung vor, einen Mann, dem die Geschäfte des Kaufmanns bekannt waren, und der es verstand, die Interessen der Konkursmasse und die des ehrenwerten Mannes, der ins Unglück geraten war, in Einklang zu bringen. Seit einigen Jahren lassen sich erfahrene Richter den gewünschten Agenten bezeichnen, um ihn gerade nicht zu nehmen, und zu versuchen, einen einigermaßen ehrlichen zu ernennen.
Während sich dieser Akt abspielt, treten die Gläubiger, die falschen und die echten, zusammen, um die provisorischen Syndici zu bezeichnen, die, wie erwähnt, in Wahrheit die definitiven sind. Bei der Wählerversammlung steht denen, die fünfzig Sous zu fordern haben, das gleiche Stimmrecht zu wie den Gläubigern, deren Forderung fünfzigtausend Franken beträgt: die Stimmen werden eben gezählt und nicht gewogen. Diese Versammlung, in der sich auch die von dem Schuldner eingeführten falschen Wähler befinden, die einzigen, die bei der Wahl niemals fehlen, schlägt als Kandidaten Gläubiger vor, aus denen der Konkursverwalter, ein Präsident ohne Machtbefugnisse, »gezwungen« ist, die Syndici zu wählen. So empfängt der Konkursverwalter fast immer aus der Hand des Kridars diejenigen Syndici, die diesem genehm sind, abermals ein Mißbrauch, der eine Katastrophe zu der übelsten Burleske macht, der die Justiz ihren Schutz angedeihen lassen kann. Der Ehrenmann, der ins Unglück geraten ist, erlangt damit die Legalisierung des Betruges, den er vorbereitet hat. Im allgemeinen verhält sich der Pariser Kleinhandel durchaus vorwurfsfrei. Wenn ein Krämer in Konkurs gerät, dann hat der arme Mann schon das Umschlagetuch seiner Frau veräußert, sein Silberzeug verpfändet, das Hemd vom Leibe verkauft und steht nun zugrunde gerichtet mit leeren Händen da, selbst ohne Geld für den Anwalt, der sich natürlich sehr wenig um ihn kümmert.
Das Gesetz verlangt, daß dem Vergleich, der dem Kaufmann einen Teil seiner Schuld erläßt und ihm gestattet, sein Geschäft wieder zu betreiben, von einer bestimmten Majorität, nach den Beträgen und den Personen berechnet, zugestimmt sei. Um dieses große Werk zustande zu bringen, müssen der Kridar, seine Syndici und sein Anwalt inmitten der einander entgegenstehenden und sich durchkreuzenden Interessen mit diplomatischer Geschicklichkeit zu Werke gehen. Das übliche Manöver besteht darin, daß man dem Teil der Gläubiger, der die vom Gesetze verlangte Majorität ausmacht, eine Prämie anbietet, die sich der Schuldner außer der im Vergleich festgesetzten Dividende zu zahlen verpflichtet. Gegen diesen ungeheuerlichen Betrug gibt es kein Mittel; die dreißig Handelsgerichte, die aufeinander gefolgt sind, kennen ihn aus ihrer Praxis. Nachdem sie sich genügend darüber klar geworden waren, haben sie sich schließlich entschlossen, solche betrügerischen Abmachungen für ungültig zu erklären, und da die Schuldner ein Interesse daran haben, sich über eine solche »Extorsion« zu beschweren, so hofften die Richter, auf diese Weise die Konkurse moralischer zu gestalten, aber sie werden damit nur bewirken, daß sie noch unmoralischer werden; die Gläubiger werden eben noch üblere Tricks aushecken, die die Richter als Richter herabwürdigen und aus denen sie als Kaufleute ihren Vorteil ziehen.
Ein anderes sehr gebräuchliches Manöver, von dem der Ausdruck »ernsthafter und legitimer Gläubiger« herstammt, besteht darin, Gläubiger zu schaffen, so wie du Tillet ein Bankhaus geschaffen hatte, und eine gewisse Anzahl von Claparons einzuführen, hinter deren Haut sich der Kridar verbirgt, der damit die Dividende der echten Gläubiger verringert, sich so eine Reserve für die Zukunft schafft und sich gleichzeitig die für den Vergleich erforderlichen Stimmen und Summen sichert. Die »lustigen und illegitimen« Gläubiger sind dasselbe wie die in das Wahlkollegium eingeführten falschen Wähler. Was kann der »ernsthafte und legitime« Gläubiger gegen die »lustigen und illegitimen« machen? Sich ihrer entledigen, indem er sie angreift! Schön. Aber um diese Eindringlinge zu vertreiben, muß der »ernsthafte und legitime« Gläubiger seine Geschäfte im Stiche lassen, einen Anwalt mit der Sache betrauen, welcher Anwalt, da er hieran fast nichts verdient, es vorzieht, Konkurse zu »dirigieren«, und sich um eine solche Bagatellsache wenig kümmert. Um den »lustigen« Gläubiger zu verdrängen, ist es nötig, in das Labyrinth der Vorgänge einzudringen, bis auf entfernte Zeiten zurückzugehen, die Bücher durchzusehen, beim Gericht zu erwirken, daß der falsche Gläubiger die seinen vorlegt, die Unwahrscheinlichkeit der falschen Vorspiegelungen klarzulegen, sie den Handelsrichtern zu erweisen, zu klagen, hin und her zu laufen und viele Leute dafür zu interessieren; dann muß er gegenüber jedem »illegitimen und lustigen« Gläubiger den Don Quichote spielen, der, wenn er der »Lustigkeit« überführt ist, sich zurückzieht, sich den Richtern empfiehlt und sagt: »Entschuldigen Sie, Sie irren sich, ich bin ein ›sehr ernsthafter‹ Gläubiger.« Und das alles vorbehaltlich der Rechte des Schuldners, den Don Quichote vor das Obergericht zu ziehen. Während dieser Zeit gehen die Geschäfte des Don Quichote schlecht und es kann ihm passieren, daß er selbst Konkurs anmelden muß.
Moral: Der Schuldner ernennt seine Syndici, kontrolliert seine Schulden und arrangiert seinen Vergleich selbst.
Kann man sich nach diesen Angaben nun nicht leicht vorstellen, was für Intrigen, was für Schliche eines Sganarelle, Erfindungen eines Frontin, Lügen eines Mascarillo und Windbeuteleien eines Scapin diese beiden Systeme erzeugen? Es gibt kein Fallissement, das nicht genügend Stoff enthielte, um vierzehn Bände wie die »Clarissa Harlow« damit zu füllen. Ein einziges Beispiel wird genügen. Der berüchtigte Gobseck, der Meister der Palmas, Gigonnets, Werbrusts, Kellers und Nucingens, war bei einem Konkurse beteiligt, bei dem er sich vorgenommen hatte, einen Kaufmann, der es verstanden hatte, ihn hineinzulegen, gehörig heranzubekommen; er erhielt auch von ihm in Wechseln, die erst nach dem Vergleich fällig waren, einen Betrag, der zusammen mit der Dividende seine ganze Forderung gedeckt haben würde. Gobseck setzte nun einen Vergleich durch, bei dem dem Schuldner fünfundsiebzig Prozent erlassen wurden. In dieser Weise wurden die Gläubiger zugunsten von Gobseck betrogen. Aber der Kaufmann hatte diese unrechtmäßigen Wechsel mit der Unterschrift seiner im Konkurse befindlichen Gesellschaftsfirma ausgestellt und konnte daher auch bei ihnen den Abzug von fünfundsiebzig Prozent machen, und Gobseck, der große Gobseck, erhielt kaum fünfzig Prozent. Seitdem grüßte er seinen Schuldner stets mit ironischem Respekt.
Da alle von einem Kridar zehn Tage vor der Konkursanmeldung eingegangenen Verpflichtungen anfechtbar sind, so bemühen manche klugen Menschen sich, gewisse Geschäfte mit einer bestimmten Anzahl von Gläubigern abzuschließen, die ebenso wie sie ein Interesse haben, möglichst schnell zu einem Vergleich zu gelangen. Sehr gerissene Gläubiger treten an sehr unerfahrene oder sehr beschäftigte Gläubiger heran, malen die Lage möglichst schwarz und kaufen ihnen ihre Forderungen für die Hälfte dessen ab, was bei der Liquidation als auf sie entfallend zu erwarten ist; auf diese Weise kommen sie zu ihrem Gelde, da sie zu ihrer Dividende noch die Hälfte, das Drittel oder das Viertel hinzubekommen, das sie bei dem Ankauf der Forderungen verdient haben. Das Fallissement ist der mehr oder weniger hermetische Verschluß eines Hauses, in dem die Plünderung noch einige Säcke Geld zurückgelassen hat. Glücklich der Kaufmann, der sich durchs Fenster, übers Dach, durch den Keller oder durch ein Loch einschleichen kann, sich einen Sack nimmt und so seinen Anteil vergrößert! In diesem Durcheinander, wo das »Rette sich, wer kann« der Beresinaschlacht erklingt, ist alles ungesetzlich und gesetzlich, falsch und richtig, anständig und unanständig. Bewundert wird der Mann, der es versteht, sich zu »decken«. Sich decken heißt, sich einiger Werte zum Schaden der andern Gläubiger bemächtigen. Ganz Frankreich war von den Debatten über ein Fallissement in einer Stadt erfüllt, die Sitz eines Obergerichts war, und wo die Beamten, die mit den Kridaren unter einer Decke steckten, sich so dicke Kautschukmäntel anzogen, daß der Mantel der Justiz ein Loch bekam. Es war erforderlich, wegen begründeten Verdachts die Verhandlung über diesen Konkurs einem andern Gerichtshof zu übertragen. Denn in dem Ort, wo dieser Konkurs ausgebrochen war, war weder ein unparteiischer Konkursverwalter, noch Agent, noch Richter aufzutreiben.
Dieses skandalöse Verfahren ist in Paris so allgemein bekannt, daß jeder Kaufmann, so wenig er auch von Geschäften in Anspruch genommen sein mag, wofern er nicht an dem Konkurse mit einem erheblichen Betrage beteiligt ist, das Fallissement als ein Unglück, gegen das man nicht versichert ist, hinnimmt, es auf Gewinn- und Verlustkonto abschreibt und nicht die Torheit begeht, auch noch seine Zeit zu opfern; er kümmert sich lieber um seine Geschäfte. Was den kleinen Händler anlangt, der vor jedem Monatsende sich ängstigt, seinen Karren mühsam weiterschiebt und den ein teurer Prozeß von endloser Dauer, auf den er sich einlassen soll, ohne sich ein klares Bild davon machen zu können, mit Entsetzen erfüllt, so macht er es wie die großen Kaufleute, senkt betrübt das Haupt und trägt seinen Verlust.
Die großen Kaufleute melden gar nicht mehr Konkurs an, sondern sie liquidieren nach getroffenem gütlichem Übereinkommen; die Gläubiger erklären sich mit dem, was man ihnen bietet, für abgefunden. Man vermeidet so die Schande, die gesetzlichen Fristen, die Honorare für die Anwälte und die Verschleuderung der Waren. Jedermann ist überzeugt, daß bei einem Konkurs weniger herauskommt als bei einer Liquidation, und so gibt es in Paris mehr Liquidationen als Konkurse.
Der Akt, der von den Syndicis gespielt wird, ist dazu bestimmt, zu beweisen, daß kein Syndicus bestechlich ist, und daß zwischen ihnen und dem Kridar nicht das geringste Einverständnis vorliegt. Das Publikum, das mehr oder weniger selber einmal Syndicus gewesen ist, weiß, daß jeder Syndicus ein »gedeckter« Gläubiger ist. Es hört zu, glaubt, was es will, und erscheint schließlich an dem Tage, wo der Vergleich vorgeschlagen wird, nachdem drei Monate damit hingebracht worden sind, die Forderungen aus den Aktiven und Passiven festzustellen. Die provisorischen Syndici erstatten alsdann der Versammlung einen kleinen Bericht, dessen Formulierung im allgemeinen folgendermaßen lautet:
»Meine Herren, unsere Forderungen betragen rund eine Million. Wir haben unseren Mann abgetakelt wie eine gescheiterte Fregatte. Die Nägel, das Eisen, das Holz, das Kupfer haben insgesamt dreihunderttausend Franken erbracht. Es entfallen also dreißig Prozent auf unsere Forderungen. Froh, daß wir soviel herausbekommen haben, während unser Schuldner uns nur hunderttausend Franken hätte lassen können, erklären wir ihn für einen Aristides, beantragen eine Anerkennungsbelohnung und eine Ehrenkrone für ihn und schlagen vor, ihm seine Aktiva zu belassen, indem wir ihm zehn bis zwölf Jahre Zeit gewähren, um uns noch fünfzig Prozent nachzuzahlen, die er so gütig ist, uns zu versprechen. Hier ist der Vergleich, kommen Sie an den Schreibtisch und unterzeichnen Sie ihn.«
Auf diese Rede hin beglückwünschen sich die frohen Kaufleute und umarmen sich. Nach der gerichtlichen Beglaubigung des Vergleichs wird der Kridar wieder ein Kaufmann wie vorher; man gibt ihm seine Aktiva zurück, er eröffnet sein Geschäft wieder, ohne daß ihm das Recht benommen ist, mit der zugesagten Dividende nochmals Konkurs zu machen, so einen kleinen Nachkonkurs, der oft vorkommt, wie wenn eine Mutter neun Monate nach der Hochzeit ihrer Tochter ein Kind zur Welt bringt.
Kommt ein Vergleich nicht zustande, so wählen die Gläubiger nunmehr die definitiven Syndici und treffen außergewöhnliche Vorkehrungen, indem sie sich zusammentun, um das Vermögen und das Geschäft ihres Schuldners zu Gelde zu machen, wobei sie ihre Hand auch auf alles das legen, was ihm einmal zufließen wird, auf die Erbschaft vom Vater, von der Mutter, der Tante usw. Diese rigorosen Maßregeln werden nach vertragsmäßigem Übereinkommen durchgeführt.
1 Schuldner nach der Eröffnung des Konkurses <<<