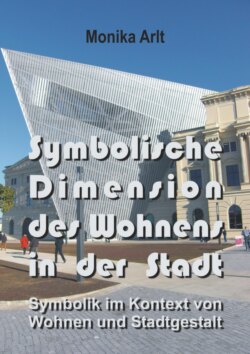Читать книгу Symbolische Dimension des Wohnens in der Stadt - Monika Arlt - Страница 5
Einleitung
Оглавление„Symbolik“ im Kontext von Wohnen und Stadtgestalt klingt seltsam fremd, unkonventionell und schwer verständlich. In den meisten Publikationen zum Thema Wohnen und Stadtgestalt spielt die symbolische Dimension auch keine Rolle. Über das Zähneputzen wissen die meisten Menschen mehr, als über die Bedeutung von Symbolen und damit auch über die Bedeutung von Symbolen als Gefühlspartner und Identitätsstifter in ihren Leben.
Dabei gibt es in allen Gesellschaften einen kulturellen Symbolismus, der die Gemeinsamkeiten und Vereinbarungen der jeweiligen Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Selbstverständlich wollen die meisten Berlinbesucher durch das Brandenburger Tor hindurch oder einen Blick auf die Gedächtniskirche werfen, selbstverständlich wollen viele Parisbesucher auf den Eiffelturm und wollen in New York die Besucher die Freiheitsstatue sehen. Viele andere Bauten und Orte demonstrieren ihre Symbolkraft nicht so offensichtlich oder nicht für so viele Menschen.
Die Kulturen der Welt und aller Zeitalter waren immer auch von ihren Mythen und Symbolen bestimmt. Symbole schaffen Verbindungen — über solche Verbindungen gestalten sich Lebensräume in ihren Bedeutungen im Bewusstsein und im Unbewussten ihrer Bewohner. Um Hinschauen zu können, muss etwas sichtbar sein, und vor dem Hintergrund des Wissens, der Assoziationen und des Empfindens der Bewohner und der Betrachter nehmen die Symbole Einfluss auf den Gemütszustand — heimlich, unheimlich, real, irreal. Einsicht in diese symbolische Dimension menschlichen Lebens, wie sie durch die Bilder der Stadt ermöglicht wird, ist für das Leben und Wohnen in der Stadt von unschätzbarem Wert. Wo gebaute Objekte in den Städten, Gemeinden und Landschaften emotionales Erleben auslösen, wo Menschen durch die symbolische Qualität von Ereignissen berührt werden, entstehen solche Gemeinsamkeiten, entsteht Identifikation. Allerdings lässt sich nur das, was bewusst wird, auch korrigieren und verändern.
Jedes Ding das einen Bedeutungsüberschuss, ein „Mehr“ veranschaulicht, das über die Gegenständlichkeit des Objektes hinausgeht, kann Symbol, Sinnbild, Merkzeichen für jemanden werden: Das Auto ist für viele Besitzer ein Statussymbol, die „Manschettensprache“ als leicht identifizierbarer sozialer Code für Erfolg, ein Messer, das eigentlich zum Brotschneiden genutzt wird, als Statussymbol eines „Aufschneiders“, die Rose — das Symbol der Liebe, die Taube — ein Symbol für den Frieden, der Wolkenkratzer — ein Symbol für Potenz, die Freiheitsstatue … das Hakenkreuz …
Symbole gewinnen ihre kollektive Kraft erst dann, wenn eine Vielzahl von Menschen sich angezogen fühlt, gepackt wird, dem Zauber erliegt oder „das Ding“ einfach in seiner symbolischen Dimension versteht und respektiert. Die kollektive Kraft entwickelt sich aus dem Gemeinsamen und dem Einigenden, dem „Wir-Gefühl“, das sich in der gemeinsamen Gefühlsbeziehung vieler Menschen zu einem Symbol manifestiert. Die Aussage: Das ist ja nur ein Symbol, oder: Das ist ja nur symbolisch gemeint, zeugt von dem Unwissen über die enorme Kraft der Symbole, sofern sie bewusst eingesetzt wird, um unbewusst wirksam zu werden.
Es gibt dieses Unbestimmbare des Wohnalltags, die spezifische Atmosphäre einer Stadt, eines Ortes und es gibt eine Magie des Realen in dem, was fasziniert und berührt.
Wohnungen, Häuser, Straßen, Quartiere und auch die Städte als Ganzes „erzählen“ Geschichten, bergen mythische Orte und die „Stars“ dieser Orte sind die Symbole. Schwer fassbar aber real vorhanden nehmen die Bilder der Umwelt Einfluss auf den Gemütszustand der Bewohner in ihrem Wohnalltag. Gestalten und Bilder, Formen und Farben in der äußeren Realität korrespondieren mit Geschichten, Mythen und Symbolen des „Innen“ im Bewussten und Unbewussten der Bewohner und Besucher.
Die Bildsprache der gebauten Umwelt, die Ausstrahlung von Orten und Gegenständen wirken auf den Menschen ein, trüben die Stimmung oder hellen sie auf, öden ihn an oder lassen es prickeln.
So erlaubt die Bildsprache einer Wohnung beispielsweise eine symbolische Einsicht in eine angepasste, defizitäre, opulente, pompöse, erstarrte, vernachlässigte oder anderweitig charakterisierbare „Ein-Richtung“ eines Bewohners. Die Bildsprache einer Stadt oder eines Objektes erlaubt Eindrücke, die vermitteln, ob dieser Ort offen oder schwer zugänglich, lebendig, bedrohlich, angenehm oder erstarrt, verstopft oder in anderer Weise aus der Balance geraten ist. Die symbolische Dimension erstreckt sich auf dieses „Mehr“, auf die Bedeutung, die durch Formen, Farben, Gestalten, Ordnungen und Proportionen zum Ausdruck kommt und auf die Gefühle, die davon bei den Betrachtern und Nutzern ausgelöst werden.
Zentrales Element jeder Bildsprache ist die Symbolbildung. Je mehr, je komplexer die Geschichten — auch widersprüchliche — über die Bildsprache verbunden sind, desto stärker ist die Kraft des Symbols. Banale, billige Investorenarchitektur setzt ebenso Zeichen, ist ebenso Symbol für eine Einstellung zur gebauten Umwelt, wie eine stimmige, bedeutsame Architektur, die man sich von dem Ort, an dem sie sich befindet, nicht wegzudenken vermag. Die Geschichten der „Banalmoderne“ sind banal. Sie lassen sich auf Effizienz, Langeweile und Rendite reduzieren. Auch die Geschichten von Signalbauten sind oft banal, wenn sie keinen Bedeutungsüberschuss erlauben, und wenn sie keine Sinnbezüge generieren außer dem, durch ihre Größe oder durch ihre Theatralik Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Immer wieder gibt es aber Architekten, Ingenieure, Baukünstler und Künstler, die als „Form- und Farb-Magier“ Symbole nutzen und gute Verbindungen zwischen „innen und außen“ herstellen. Die Verbindung von inneren Mustern, den Zyklen des Lebens, Tag und Nacht, Licht und Dunkel, zu den Jahreszeiten, zu Pflanzen und Tieren, dem Kosmos, den Lastern und Tugenden, den Wünschen und Hoffnungen, zu Elementen, der ganzen Vielfalt des Lebens und seiner Geschichte ist die „Magie“, zu der sie fähig sind. Auf den Wechselwirkungen gründen sich die Netzwerke von Bildern, Zeichen und Symbolen in den Wohnungen und in Straßen, Quartieren und Plätzen der Städte. Transparent und lustvoll genutzt können sie stabilisierende Kräfte entfalten. Wer die Potenziale baukultureller, technischer und organisatorischer Innovationen erschließen will, wer neue Lösungen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung entdecken will, hat es immer mit der symbolischen Dimension solcher Bilder zu tun.
Vielfach wird behauptet, starke Bilder ließen sich nicht planen, es seien jeweils nur Glücksfälle, wenn eine „richtige“ Antwort auf einen Ort gegeben und so der „Geist des Ortes“ zum Erscheinen gebracht wird. Wenn es gelingt, solchen Bildern und Vorstellungen eine symbolische Qualität zu verleihen, und zwar eine, von der eine Vielzahl von Menschen berührt wird, können solche Lösungen erfolgreich sein. Es sind die Symbole, die eine Verbundenheit mit dem Leben spüren lassen,
Als Beispiel für die Kraft und die Bedeutung der symbolischen Dimension kann die neuerliche Geschichte eines Weges dienen, der wiederum eine Geschichte aus der Zeit der DDR in Deutschland erzählt:
Ein einfacher Weg in Potsdam erregte für eine lange Zeit die Gemüter, ein Uferweg um den Griebnitzsee. Er wurde von einigen Anwohnern, über deren Grund er ging, für die Allgemeinheit gesperrt. Viele Interessen spielten in dem Wertekonflikt, der sich dadurch entzündet hatte, eine Rolle. Was in der Diskussion zwar nicht den vorrangigen Stellenwert bekam, aber für die symbolische Qualität des Konflikts eine wesentliche Rolle spielte, war die symbolische Bedeutung und Qualität des Ortes. Der Weg als ehemaliger Postenweg der DDR-Grenzer war bereits 15 Jahre öffentlich gewesen und hatte sich zu einem Erinnerungsort, einem Symbol der Freiheit entwickelt. Inzwischen gibt es einen rund 160 Kilometer langen Radweg entlang der früheren Grenze um das alte Westberlin, der mit Infotafeln und Erinnerungsstelen für die Mauertoten bestückt ist. Durch die Sperrung des Weges durch einige wenige Anlieger ist dieser Erinnerungsweg, der eine weltweite Bedeutung für die Öffnung von Grenzen hat, unterbrochen. Langsam gewöhnt man sich an diese Situation. Doch dürfte nicht der Vorrang des Gemeinwohls vor dem Eigennutz das stärkste Argument in diesem Konflikt sein, sondern die Bedeutung des Weges als Symbol, als Übersetzer zwischen Vergangenheit und Gegenwart und als Gefühlspartner und Identitätsstifter für Menschen, die ehemals durch die Grenze getrennt waren.
In seiner Philosophie der symbolischen Formen räumte Ernst Cassirer der religiösen und künstlerischen Erfassung der Realität neben den exakten Wissenschaften einen selbstständigen Platz ein (vgl. Hegenbart 1984). Cassirer sah den Schlüsselbegriff zum Verständnis der menschlichen Kultur in der des Symbols. Er verstand die Grundfunktionen des Bewusstseins in der Repräsentation von Symbolen und unter „symbolischer Prägnanz“ die Art, in der ein Wahrnehmungserlebnis als „sinnliches“ Erlebnis zugleich einen bestimmten nicht-anschaulichen „Sinn“ in sich fasst und ihn zur unmittelbaren konkreten Darstellung bringt. Der symbolische Prozess war für ihn wie ein einheitlicher Lebens- und Gedankenstrom, der das Bewusstsein durchflutet, und der in dieser seiner strömenden Bewegtheit erst die Vielfältigkeit und den Zusammenhang des Bewusstseins, erst seine Fülle wie seine Kontinuität und Konstanz zuwege bringt (Cassierer, 1994, Dritter Teil, 10.Aufl.). Es dürfte interessant sein, die Aussage in dieser poetischen Sprache mit den Ergebnissen neurowissenschaftlicher Forschung in Verbindung zu bringen.
Im Wechselspiel zwischen Innen und Außen, zwischen den äußeren Gestalten, Orten und Umwelten und dem inneren Labyrinth der Psyche gibt es individuelle und kulturelle Muster und strukturelle Analogien. Der Neuropsychologe Chris Frith stellt fest: Unser Gehirn konstruiert Modelle der Welt und modifiziert sie ständig auf der Basis von Signalen, die unsere Sinnesorgane empfangen. Was wir tatsächlich wahrnehmen, sind daher die Modelle, die unser Gehirn von der Welt kreiert (Frith 2010).
Symbole können als eine mögliche Form solcher Modelle der Welt gelten. Symbole sind aber nicht dazu in der Lage, die Triebkräfte der Menschen oder der Gesellschaft zu zähmen. Sie können sie, wie im Nationalsozialismus geschehen, sogar im Kontext von staatlicher Monumentalsymbolik der Gebäude und Rituale verstärken. Aus dem Einigenden des Symbols entwickelt sich seine kollektive Kraft, seine Anziehungskraft im Guten wie im Bösen. Über die Kraft und das Unheil der manipulativ verwendeten Symbole im Nationalsozialismus ist heute genügend Kenntnis vorhanden. Staatliche Monumentalsymbolik gibt es auch heute noch zur Genüge, vornehmlich in Diktaturen. In Deutschland hat es den entsetzlichen Missbrauch gegeben, dass Menschen mithilfe von Mythen, Riten und Symbolen in der Masse und in den Aktionsbünden der Kinder-, Jugend-, Männer- und Frauenorganisationen zu einem „Heil“ schreienden und zur Selbstaufgabe choreografierten Instrument geworden sind. Nahezu ein ganzes Volk ist dem „Ungeist“, dem bösen Geist als dem Archetypus eines Größenwahnsinnigen verfallen, in den es eigene Wünsche von Größe und Macht projiziert hat, mit dem es ungeheuerliche Verbrechen begangen hat.
Das macht es noch heute so schwer, die symbolische Dimension des Lebens und Wohnens in der Stadt wahrzunehmen und damit zu arbeiten, zu experimentieren und Symbole, Mythen und Rituale im positiven Sinne, im Sinne von Selbstsymbolen und gemeinschaftsbildenden Symbolen in der Stadt offensiv zu verwenden.
Die heutige Zeit ist aber durchaus keine symbolarme Zeit. Nur wird mit den Symbolen unterschwellig und vielfach auf unbewusste Weise für die Adressaten umgegangen. Werbung und Eventmanagement inszenieren ihre Marken und Ereignisse mithilfe von Mythen und Symbolen durchaus manipulativ. Symbolische Einsicht versteht sich dahin gehend, sich der Symbole und des eigenen Unbewussten zu bedienen, ohne den Boden der Wirklichkeit zu verlassen und die eigene Vernunft zu verleugnen. Im Alltag sind gute Selbstsymbole erforderlich und eben auch Einsicht und Verständnis für die Sprache und die Implikationen der Symbole.
So nutzt eine Frau mit ihrer Muschelsammlung Symbole der Hoffnung, des Schutzes, der Geborgenheit, die sie als „Kraftdreher“ bezeichnet. In einzelne davon hat sie sich früher manchmal gedanklich verkrochen, wenn das Leben für sie unerträglich wurde. Eine Magersüchtige ist einem Schönheitsideal verfallen, das verhindert, dass sie ihren Körper realitätsgerecht wahrnehmen kann. Das Idealbild der schlanken Frau ist für sie zu einem angstbesetzten Symbol geworden, das sie antreibt, je mehr sie versucht ihm zu entkommen. Eine Störung dieser Art wird sie allerdings kaum mithilfe von Selbstsymbolen oder durch Einsicht in die symbolische Dimension ihrer Fantasiegebilde auflösen können, ohne therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Der Dienstwagen eines Politikers und die Zahl seiner Bodyguards sind durchaus Symbole für die Bedeutung dieser Person. Dagegen zeugt der Begriff der „Symbolpolitik“, wie er in der Presse für politische Schaukämpfe mit viel Lärm um nichts verwendet wird, von der Absicht, einen Sachverhalt als unwahr darzustellen oder ihm eine Bedeutung zukommen zu lassen, die der Realität nicht entspricht. Der Symbolbegriff wird hier in einer Weise verwendet, die etwas Unglaubwürdiges, Unzuträgliches, Gefährliches signalisiert oder den Sachverhalt in seiner Bedeutung herunterspielt.
Es ist kein Missverständnis erforderlich und auch kein Glauben an universelle Wahrheiten, um das Vorhandensein von Symbolen zu erkennen. Es genügt, die Wirklichkeit zu hinterfragen. Die Vernunft braucht dabei nicht auszusetzen. Auch ohne kulturelle Regression lassen sich verschüttete Quellen nutzen, und die sind nötig, um die Welt lebendig und beweglich wahrzunehmen.
In den Kathedralen des Mittelalters waren symbolische Gestalten für Tugenden und Laster physisch für die Betrachter erfahrbar. Die griechische Mythologie hatte in den Figuren von Zeus, Hera, Athene, Apoll, Aphrodite, Eros, Ares und vielen anderen Gestalten des Götterkosmos die personifizierten Verhaltensmuster von Macht und Gerechtigkeit, Ehre, Schönheit, Verlangen, List und Feindschaft zur Verfügung. Symbolische Welten von der Antike über Mittelalter, Renaissance, Barock bis in die Neuzeit von Jugendstil, Art Deco und Bauhaus bilden die Kultur jeder Epoche, waren Mittel der Erkenntnis. Das Christentum hatte mit seiner Bilderwelt und ihrer diesbezüglichen Deutungsmacht einen erzieherischen Auftrag. Anzunehmen ist, dass über die Darstellungen in Bildern, Skulpturen und Objekten Gefühle wie Gottesfurcht, Schauder und Beglückung erzeugt wurden. Bedeutungen sind überliefert, manche verschlüsselten Botschaften waren — und sind — nur für „Eingeweihte“ zugänglich. Die individuelle emotionale Bedeutung lässt sich allerdings heute, außer bei manchen großen Kunstwerken oder bei „Ehrfurcht gebietenden“ Bauwerken, kaum noch nachvollziehen.
Heute muss es eine andere, zeitbezogene Symbolik geben. Künstler wie Olafur Eliasson haben mit ihren Gestaltungen dazu Wege gewiesen und bereits viel zu einer neuen Gefühlskultur beigetragen. Mit dem Rainbow Panorama hat Eliasson einen mythischen Ort in der dänischen Stadt Aarhus geschaffen.
Mythische und poetische Orte in der Stadt sind oft von großer Anziehungskraft. In manchen Städten, wie zum Beispiel in Berlin, gipfelt diese Kraft darin, dass sich Tausende Menschen in angesagten Klubs oder wie in Grünanlagen zum Feiern, Grillen und Spielen versammeln. Solche Orte werden zu Konflikträumen, wenn sich unterschiedliche Interessen nicht miteinander vereinen lassen. Der Park gleicht nach beendeter Grillaktion einer Müllhalde. Solange sich Menschen nicht verantwortlich und nicht mit dem Energiesystem der Gegenwart, in der sie leben, verbunden fühlen, solange sie die Bedeutung und die Folgen ihres Tuns und ihre Verankerung in der Stadt nicht wahrnehmen, werden sie ihr Verhalten nicht verändern.
Die verbindende, symbolische Dimension ist eine Basis, auf der Veränderungen in Gang gesetzt werden können. Sie kann so lange nicht genutzt werden, solange dieser Dimension keine Bedeutung beigemessen wird. Das Juma-Projekt (jung, muslimisch, aktiv) in Berlin hat sich dieser Problematik angenommen und sie in Moscheen und Kulturvereine gebracht. Getragen von der Weisheit des Islams als einer symbolischen Weisheit, in der es unter anderem auch um den Fortbestand und um Sauberkeit in der Welt geht, erscheinen ein Umdenken und die Änderung des achtlosen Verhaltens langfristig möglich. Durch das Juma-Projekt wird ein neues, ein anderes Herangehen an ein Problem möglich, indem nach dem „Mehr“ gefragt wird, und indem zum Ausdruck gebracht wird, wofür ein Objekt steht und was es mit dem eigenen Leben und dem Leben auf der Erde zu tun hat,
Die meisten Bewohner der Stadt sind durchaus in der Lage sich selbst zu „autorisieren“ und ihr eigenes Leben und die Dinge, mit denen sie sich umgeben, in Besitz zu nehmen. Manche tun das extensiv, sehr zum Ärger der Behörden. Mancherorts wächst dort aber auch die Einsicht, den Bewohnern Mitverantwortung und Teilhabe zuzugestehen. Es macht Sinn, sich im selbstbestimmten Leben und Wohnen das Recht zu nehmen, die eigene Lebensgeschichte, „den eigenen Mythos“ aufzuspüren und sich im Kontext der eigenen Natur, des eigenen Körpers zu erfahren, sich manches zuzutrauen und manches auch „zu verdauen“. Die Deutungsmacht lässt sich erweitern, alles kann für jemanden, für Gruppen oder Mengen von Menschen Bedeutung erlangen. Dazu muss nicht Nabelschau betrieben werden, das kann mithilfe von Fantasie, Kreativität, Intuition und Innovation geschehen — und das betrifft nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch die Straße, das Quartier, den Park und die ganze Stadt. Dazu ist die Information über Sachverhalte erforderlich, die Erstaunen und manchmal auch Entzücken oder Abscheu beim Erleben von Gegenständen, Objekten und Orten hervorrufen, wenn Kunst und Kreativität im Spiel sind. Ein „Kiezaktivist“ in Moabit nimmt für sich in Anspruch, der Kiez sei sein Zuhause, sein Wohnzimmer, das wolle er schönmachen. Aber nicht zu schön. Wie in einer WG, in der alle ihre Zimmer haben und man trifft sich regelmäßig in der Küche.
Was spricht dagegen, eine Wohnung, eine Straße, ein Quartier, eine Stadt, selbst einen vermüllten Park als Bild zu betrachten und mit den inneren Bildern und Symbolen in Beziehung zu setzen? Was spricht dagegen, im Falle von Störungen des Zusammenlebens, gemeinsam einen Verhaltenskodex zu entwickeln und Verpflichtungen einzugehen, die einen symbolischen Ausdruck finden.
Die Bilder und die Geschichten sind im Erleben der Bewohner aber ganz unterschiedlich. Gutes Leben und Wohnen in der Stadt ist nicht etwas, worauf man sich allgemein verständigen kann. Dafür gibt es zu viele unterschiedliche Bilder, Vorstellungen und Sichtweisen. Jeder Einzelne, jede Gruppe in der Gesellschaft entwickelt da eigene Qualitäten, einen eigenen zeitgefassten Raumwillen, wie der Architekt Mies van der Rohe das genannt hat. Im Spiegel des jeweils eigenen Erlebens der umgebenden Bilderwelt können sich einzelne Menschen oder Gruppen aber des Mythos eines Ortes bewusst werden. Wenn es gelingt sich selbst dort wiederzufinden, sich angenommen zu fühlen, ist im Einklang mit dem Ort symbolisches Erleben, sind symbolische Einsichten erfahrbar. Das ergibt Vielfalt, Unterscheidung und Besonderheit, das ergibt Möglichkeiten für ein breites Spektrum an Formen, Szenerien und „Bühnen“, auf denen sich die Bewohner erkennen und erfahren können.
Eine Flanierstraße der anderen Art, ein „Catwalk“ in Berlin, die Kastanienallee, auch „Casting-Allee“ genannt, ist ein Beispiel für eine solche Bühne in der Stadt. Wie die Stadt allerdings mit den Änderungswünschen der Bürger im Zusammenhang mit dem Umbau der Allee umging, ist auch ein Beispiel für den Umgang der Behörden mit den Symbolen der Stadt. Die 82 Einwände wurden wohl lediglich nur geprüft. Die Interessen der Anwohner und der anderweitig Betroffenen dürften bei der Verwaltung auf wenig Wohlwollen gestoßen sein.
Es würde der gebauten Umwelt guttun, wenn Architekten, Planer, Baufachleute und die Verantwortlichen in den Ämtern ihre Entscheidungen unter ausreichender Beteiligung der Betroffenen und in der Rolle als (Mit)Verantwortliche für die Identifikation und die Gesundheit der Bewohner und Benutzer heraus treffen würden. Solche Entscheidungen müssten die symbolische Dimension einbeziehen. Es könnten Symbole des Lebens, der Nachhaltigkeit und der Hoffnung installiert werden, anstelle von Symbolen der Angst, der Gleichgültigkeit und der Demütigung, wie sie in manchen heruntergekommenen Gebäuden, Wohnanlagen oder Quartieren in der Stadt offensichtlich zum Ausdruck kommen. Stadtplanung, die sich mehr am Reißbrett und an der Stadtmöblierung orientiert, als an den Bedürfnissen der Bewohner, kann der demokratischen Gesellschaft nicht genügend Ausdruckskraft verleihen. Dazu bedarf es einer Baukunst, die mit Symbolen arbeitet — früher mit viel Pathos, heute auf mehr partizipatorische Weise.
Die Frage danach, wie psychische Bedürfnisse durch die Gestalten und Formen von Stadtgestalt und Wohnumwelt befriedigt werden könnten, wird eher selten gestellt. Investorenarchitekturen haben in der Regel in erster Linie gute Renditen als Ziel. Da spielt die Architektur nur eine Rolle im Hinblick auf gute Verkauf- oder Vermietbarkeit. Es gibt aber auch Architekten, die eine funktionsfähige und zweckmäßige Gestaltung im Sinn haben, und die doch auch Protagonisten für eine Architektur sind, bei der das einzelne Gebäude Teil der „gesamten Musik“ einer Stadt ist, die den Menschen guttut.
Der Architekt Richard Neutra sah zum Beispiel in der Kunst des Architekten eine Parallele zur Kunst des Arztes. Er war der Ansicht, dass ein Architekt, der sich anschickt, das Rezept für die Milieubehandlung einer Familie zu schreiben oder eine Diät für das kombinierte Nervensystem einer Gruppe von menschlichen Wesen, wohl intuitiv, aber auch mit der vorsichtigen Sympathie des Arztes, jeden seiner Fälle ins Auge fassen müsse. Neutra sah die Bewohner als „Klienten“, deren „organische Harmonie“, Gesundheit und Entfaltungsmöglichkeiten in dem umgebenden Raum von Wohnung und Haus Bestand haben sollten (vgl. Neutra 1957). Diese Einstellung hat sicher auch heute noch ihre Berechtigung.
Einmischung der Kunst, vielfältiges Nebeneinander, gute Mischungen, Architekturvorstellungen wie sie in Baugruppenprojekten mit ökologischem Anspruch zum Ausdruck kommen, aber auch das Leben in Gemeinschaftsprojekten, wie es sich in manchen ehemals besetzten Häusern abspielt, zeigen eine solche Richtung auf. Die Gebäude setzen Zeichen, die den kulturellen Geist oder auch den Widerstand ihrer Bewohner nach außen tragen. Die Gebäude lassen sich in ihrem gestalterischen Ausdruck und in ihrer Verbundenheit mit dem Ort als Selbstsymbole deuten. Die Dimension des Symbolischen „spielt ihre Rolle“ an der Schnittstelle zwischen individuellem gutem Leben und Wohnen in der Stadt und dem „Gut Wohnen“ als Wirtschaftsgut, Kultur- und Sozialgut. Um diese Schnittstelle geht es, um einen gedachten Ort, der abgrenzt und verbindet. Ohne Bewohner, ohne Bewohnerzufriedenheit gibt es kein gutes Wohnen, ohne guten Wohnungsbau als ein wertvolles und Wert-gebendes „Gut“ gibt es keine zufriedenen Bewohner.
Die Arbeit mit Bildern und Symbolen als diagnostischem Element in der Kunsttherapie dient als Vorbild für die Entdeckung der symbolischen Dimension des Wohnens in der Stadt. Störungen und Konflikte sind Bestandteile von Entwicklungsprozessen. An ihnen lassen sich Unpassendes, Unsicherheiten, Abhängigkeiten und Verwirrungen am besten deutlich machen. Vielfach liegen die Konfliktpotenziale genau da, wo die Menschen nicht im Bilde sind, wo über sie und nicht mit ihnen entschieden wird. Die vielleicht interessanteste Frage, die sich stellt, ist diejenige, ob und inwieweit die betroffenen und beteiligten Menschen „im Bilde“ sind und wie sie die symbolische Qualität der Bilder nutzen können.
Zielgruppe dieser Publikation sind deshalb nicht nur Fachleute, Architekten und Planer, Wohnungsunternehmen die Wohnraum zur Verfügung stellen und die Immobilienwirtschaft. Zur Zielgruppe gehören auch interessierte Laien. Für alle gilt, dass es sich lohnt die Geschichten, die Bilder, Mythen und Symbole, die persönlichen und die der näheren und weiteren Wohnumgebung zu erkunden, in der Absicht, das Genießbare zu genießen, Genießbares zu schaffen und das Ungenießbare zu entdecken und wenn möglich zu verdauen. Dabei geht es um das „symbolische Mehr“ das nötig ist, um sich mit der eigenen Wohnung und der Stadt, in der man wohnt, identifizieren zu können. Unverwechselbare und unvergleichliche Gegenstände, Orte und Objekte bieten die Möglichkeit, sich in ihnen wiederzufinden, sich selbst zu entdecken.
Im Wohnen präsentiert sich die individuelle Existenz, gibt ihren individuellen Vorstellungen und Interpretationen Ausdruck. Sogar hinter irrationalen Verhaltensweisen lässt sich immer auch etwas Verstehbares finden, und das kann etwas sein, das trägt, als eigene künstlerische Aktivität und Selbstinszenierung, als Ausdruck kreativen Lebens. Dem Wohnen wird ein Sinn gegeben — eine Versicherung der Existenz.
Für das Bauen sind symbolische Einsichten, Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich, um Orte herzustellen, mit denen die Bewohner und Besucher einer Stadt sich identifizieren können.