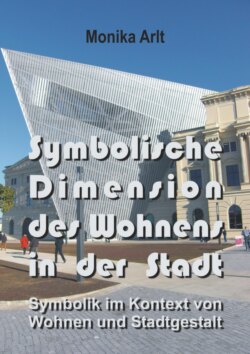Читать книгу Symbolische Dimension des Wohnens in der Stadt - Monika Arlt - Страница 6
Symbole, Mythen und Rituale — ihre Bedeutung für die Gestaltung und das Wohnen in der Stadt
ОглавлениеDie Architektur der Städte ist maßstäblich oder unmaßstäblich gebaute Realität von Ideen und Vorstellungen. Sie ist die Vergegenständlichung von Vorstellungen über räumliches menschliches Verhalten. Die Bilderwelten der Städte geben Zeugnis von diesen Vorstellungen. Gebäude und Räume in der Stadt sind die konkrete Verkörperung dessen, was Menschen in Räumen bewegt, und was sie miteinander und mit den äußeren Räumen verbindet.
Die gebaute Umwelt existiert nicht allein zum Zweck des Gebrauchs aufgrund ihrer Funktionalität, sie bewirkt auch Zu-Stimmung oder Ablehnung, das Gefühl dazuzugehören, sich darin wiederzufinden, darauf stolz sein zu können, dort Zuflucht zu finden oder auch Gefühle von Fremdheit und Unbehagen. Gebaute Umwelt hält auf diese Weise individuelle, kollektive, kulturelle und zivilisatorische Welterfahrung bereit. Solche Erfahrung kann alle menschlichen Gefühle enthalten, sie kann erschrecken, langweilen, Sicherheit geben, Freude machen.
Der britische Architekturkritiker Deyan Sudjic sieht Architektur daher als die machtvollste Form der Massenkommunikation, als „gebaute Macht“ an. Im Umkehrschluss kann man behaupten, dass Stadtplaner und Architekten „die Macht haben“ nicht nur Orte zu schaffen, die für Spektakel stehen, sonder gute, vernünftige Orte, oder auch solche, die verzaubern.
Orte die vergewaltigen, die Kampfstimmung auslösen, wo Gewalt ausgeübt, wo Resignation erzeugt wird, entwickeln sich eher dort, wo kein Planer und keine Behörde mehr hinschauen. Da gibt es Orte und Räume des Exhibitionismus, Dauerausstellungen der Selbstinszenierung, Orte der schnellen Befriedigung, Orte für die schnelle Vermarktung von Produkten.
Orte, Bauwerke, Denkmäler sind immer Zeichenträger mit symbolischer Qualität für einzelne Menschen, für Gruppen oder auch für Menschenmassen. Wenn sie für gesellschaftliche Haltungen und Einstellungen oder für gesellschaftliche Veränderungsprozesse stehen, dann erlaubt ihr Bedeutungsüberschuss vielfältigste Interpretationen. Eine Ruine wie das Künstlerhaus Tacheles in Berlin kann von unterschiedlichen Personengruppen sowohl im Bereich von Symbolik, Fantasie und Innovation, von Identität und Authentizität verortet, als auch von Verbrauchtheit, Langeweile, von Alter, Abnutzung und Verfall gedeutet werden. Weltoffenheit und Zukunftsfähigkeit, Zusammengehörigkeit, Achtung, Respekt, Herkunft und Teilhabe, Neuigkeit, Frische, Unverbrauchtheit und vieles andere mehr kann sich als symbolische Qualität zum Ausdruck bringen, insbesondere aber auch die Inszenierung von Macht. Über spekulative Bauten als Machtinszenierungen und Statussymbole wird versucht, „Aufmerksamkeitskapital“ anzuhäufen und Identifikation zu erzeugen, und das gelingt auch immer wieder.
Die Spannweite dessen, was die symbolische Qualität der gebauten Umwelt ausmacht, erstreckt sich von staatlicher Monumentalsymbolik, wie sie in diktatorischen Systemen gepflegt wurde und wird, um Menschen zur Identifikation mit dem System zu bewegen, bis hin zu einer subtilen Symbolik, der es gelingt, in einem einzelnen Objekt den ganzen Kosmos präsent zu machen.
Ein augenfälliges Beispiel für eine solche symbolische Präsenz ist das aus der Antike überkommene Pantheon in Rom, erbaut im zweiten Jahrhundert unter Kaiser Hadrian. Es macht für seine Liebhaber, aber auch für jeden empfindsamen Menschen, der sich in dem Kuppelraum befindet, den Zusammenhang zwischen Himmel und Erde durch die Bewegung des Lichts erfahrbar, welches durch die Öffnung im Scheitel der Kuppel fällt. Die Kuppel symbolisiert das Himmelsgewölbe. Mit ihrer Höhe und ihrem Durchmesser von 43,20 m lässt sich die Form einer Kugel in den Innenraum legen. Die Kugel, in der Antike ein Symbol für Vollkommenheit, vermittelt sich manchem heutigen Betrachter durchaus als gefühlsmäßige Erfahrung von Vollkommenheit.
Ein heutiges aktuelles Beispiel für symbolische Präsenz ist das Kunsthaus von Peter Zumthor in Bregenz, ein strahlender Kubus, der wie ein Leuchtkörper das wechselnde Licht des Himmels und des Bodensees aufnimmt und Licht und Farbe zurückstrahlt. Als Kunstwerke stechen die Installationen von Dani Karavan oder solche von Olafur Eliasson hervor, wie zum Beispiel das Rainbow Panorama auf dem Dach des Kunstmuseums in Aarhus, das die Besucher durch den Regenbogen wandeln lässt.
Der Maßstab für ein gelungenes Bauwerk hängt nicht von der Größe, der Monumentalität des Objekts ab, sondern kann auch heute noch mit der Vitruvschen Trias von Nützlichkeit, Dauerhaftigkeit und Schönheit in Verbindung gebracht werden. Die Ratschläge, die Andrea Palladio in seinen Vier Büchern zur Architektur (Palladio 1984 nach Ausgabe von 1570) gab, sollten seiner Vorstellung nach von allen begabten und verständigen Menschen, die bestrebt seien gut und anmutig zu bauen, beachtet werden. Heute wird in der Architektenschaft über „Kontextqualität“ diskutiert, den Zusammenhang von Wissen über menschliche Bedürfnisse, und von technischem Wissen für die Umsetzung in gebaute Umwelt. Kontextqualität schließt die Beteiligung der betroffenen Menschen ein.
Der im Dezember 2012 verstorbene Architekt Oscar Niemeyer, der letzte große Architekt der Moderne, hat zweifellos mit Brasilia und dem UN-Hauptquartier in New York große, symbolische Architektur entworfen. Kontextqualität war nicht seine Sache. Der Kunde, so soll er einmal gesagt haben, interessiere ihn einen Dreck. Vereinzelt gibt es eine solche Haltung vermutlich auch heute noch. Es gibt aber inzwischen auch eine große Zahl von Planern und Architekten, die sich der Tatsache bewusst sind, dass die frühe Beteiligung der Menschen vor Ort die Durchführung der Bauaufgabe wesentlich vereinfacht. Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der gebauten Umwelt und eine den Menschen zugewandte, symbolische Qualität, ist Beteiligungskultur unerlässlich.
Es gibt die Gebäude, Räume und Gegenstände, die den Menschen zugewandt sind. Sie kommen ihnen „physisch und psychisch“ entgegen, indem sie Aufenthaltsqualität vermitteln. Ihre symbolische Qualität steht für eine Welt, die Ausdruck von der Kompetenz, Kreativität und dem Geschichtsverständnis ihrer Schöpfer ist. Auch Einkaufzentren — Shopping-Mals — bieten Aufenthaltsqualität, allerdings nicht für jedermann. Die Passagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die noch in einigen europäischen Städten existieren und die von jedem Menschen „passiert“ werden können, sind auch heute noch Orte, die den Charakter von etwas Allgemeingültigem und Symbolischem haben. Aus dem Gewöhnlichen einer überdachten Straße ist etwas Anziehendes, etwas Magisches geworden.
Magie des Realen nennt Moritz Holfelder sein Hörbuch über den Architekten Peter Zumthor. Zumthor gehört zu den Architekten, die mit ihren Bauten ein Mehr an Bedeutung, einen Sinnzusammenhang über den Gegenstand hinaus schaffen. Mit ihren Formen und Farben, Räumen und Begrenzungen, mit den Öffnungen, dem Licht und den Schatten bewirken sie ein ästhetisches Ereignis. Wie eine „psychische Ladung“, die eine spürbare Kraft ausstrahlt, berührt die symbolische Qualität emotional und auch körperlich durch das Hingezogen- oder Abgestoßen-Werden. Sie erzeugt Atmosphäre, sie beeinflusst Gefühle, sie kann einzelne Menschen, Gruppen, Mengen oder auch Massen berühren und faszinieren.
Das Spiel mit Symbolen lässt andere Optionen zu, als einen „Brei der Metropolen“ oder eine „Banalmoderne“. In einer aufgeklärten Weise lassen sich Symbole für das Leben und Wohnen in der Stadt nutzbar machen. Einsichten in Symbolik sowie symbolische Fähigkeiten und Fertigkeiten können als Werkzeuge zur Schaffung von Urbanität und Lebendigkeit in der Stadt genutzt werden.
Architektur kann die Welt nicht retten. Durch gute Gestaltung lassen sich keine besseren Menschen schaffen. Wo allerdings Gestaltbildungsprozesse am Werk sind, wo gute Gestalten geformt, gebildet und hergestellt werden, die einen positiven Bedeutungsüberschuss haben, der mit den inneren Mustern der Bewohner in Berührung kommt, gibt es auch Auswirkungen auf seelische Gestaltbildungsprozesse.
Symbole zähmen nicht die Triebkräfte der Individuen oder der Gesellschaft. Sie lassen sich aber für den Diskurs, für Teilhabe und für die Gestaltung nutzen, indem ihre Implikationen zur Sprache gebracht werden. Symbole sind zeitlose Gestalten und Formen, die Menschen über deren Subjektivität hinweg in einem kollektiven Bewusstsein und mit der von allen wahrnehmbaren Außenwelt verbinden.
Was verstanden, was integriert ist, kann offengelegt werden. Das schafft neue Räume, die den Geist des Ortes berücksichtigen.
Anders als bei der herkömmlichen Bürgerbeteiligung kann unter Einbeziehung der symbolischen Dimension, wie in einem Mediationsprozess, die Gefühlslage „vor Ort“ wahrgenommen, verstanden und im symbolischen Kontext erörtert werden.
Symbolische Einsicht lässt sich auf diese Weise auch als Training für die Aufdeckung auch der „dunklen Seiten der Macht“ verstehen. Die monströsen Monumente des 19. Jahrhunderts in Deutschland haben zum Beispiel in ihrer Symbolik viel zum vaterländischen Empfinden und damit zur nationalen Identität beigetragen. Eine Symbolfigur Deutschlands als Reichsgründer, Feldherr, Verräter und Nationalheld war und ist für viele, insbesondere für die Besucher der Ausstellungen zum Varusjahr 2009, der Cheruskerfürst Arminius. Das historische Ereignis, die Varusschlacht, aus der er als Sieger hervorging, wurde zum Mythos. Dieser Mythos wurde lange Zeit dazu genutzt, die Deutschen von anderen Völkern abzugrenzen und ihre eigene Identität als Nachfahren der Germanen und „als Sieger“ zu begründen.
Für Länder haben Symbole eine große Bedeutung. Griechenland ist ohne die Akropolis nicht vorstellbar und die klassischen Bauwerke geben dem Land seine nationale Identität.
Eine Nation braucht Erinnerung — auch an ihre Erfolge, so heißt es in der Urkunde der Deutschen Nationalstiftung zum Nationalpreis 2008, der den Initiatoren für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal im Juni 2008 in der Französischen Friedrichskirche in Berlin übergeben wurde. Mit ihrem langfristigen Engagement haben sie es möglich gemacht, dass Deutschland ein Denkmal für etwas „Erfreuliches“, die erste erfolgreiche friedliche Revolution auf deutschem Boden, erhält. Ein solches Denkmal wäre u. a. auch ein Symbol für den Mut, den Bürger der DDR bewiesen hatten. Jürgen Engert, der Preisträger, sagte in seiner Dankesrede sinngemäß: Wenn Menschen keine Angst mehr haben, ist jede Diktatur am Ende. Ein Denkmal, das solche Vorstellungen von Mut, Wahrheit, Selbstachtung und Veränderung abbildet und transportiert, stellt eine Verbindung zwischen den Menschen her, die diesen Mut gehabt haben, und denen, die davon profitieren. In der Realität der Auseinandersetzungen zum Wettbewerb für ein solches Denkmal sind diese Gedanken zunächst allerdings auf der Strecke geblieben.
Der Architekt Peter Zumthor hat mit einer kleinen Feldkapelle am Pilgerweg nach Trier ein großes Symbol für die Verbindung von Himmel und Erde geschaffen. Zumthor ist ein Architekt, der sich im Dienst moderner Architektur auf die Suche nach Substanz und Wahrheit gemacht hat. Im Finden von Gestalten schafft er Gebäude mit Symbolfunktion. Sein Entwurf für die Topografie des Terrors in Berlin hatte den Anspruch, das Unaussprechliche, das Trauma der nationalsozialistischen Herrschaft ans Licht zu bringen. Er ist damit an den Widerständen in der Stadt gescheitert. Die Stadt hat in einer Art „Minimalkonsens“ einen rechteckigen „Kasten“ an diesen Ort gesetzt, und sie hat damit nicht gewonnen. Das nüchterne Bauwerk besitzt keine eigene Ausstrahlung im Hinblick auf die Wahrheit, wie sie an diesem Ort in Erinnerung an das damalige dortige Geschehen erforderlich gewesen wäre. Die Nüchternheit des bestehenden Gebäudes ist Symbol für die Distanz, die dem Besucher eingeräumt wird.
So gibt es etwas wie einen guten „symbolischen Gebrauch der Stadt“ durch das Gewahrsein ihrer symbolischen Dimension und der Implikationen dieser symbolischen Qualität. Wer sich mit seiner eigenen Lebensgeschichte in der Stadt verankern kann, z. B. über die Identifikation mit Personen, Ereignissen und Gestaltungen aus Vergangenheit und Gegenwart der Stadt, verfügt über einen solchen Gebrauch. Die Stadt Eisleben zum Beispiel hat mit der kulturellen und baulichen Bezugnahme auf ihren großen Sohn Martin Luther der Stadt einen Bedeutungsüberschuss zukommen lassen, der einen Gewinn für die Stadt insgesamt darstellt.
Wo in Herkunftsgeschichten und in Religionen die eine Wahrheit als höher und moralisch höherwertig eingeschätzt wird als die der anderen, und die eigene Wahrheit als die einzig richtige erachtet wird, existiert aber nur ein verkürztes Symbolverständnis und eine deutlich eingeschränkte symbolische Einsicht. Verliebtheit in einen Ort, in eine Stadt oder in einen Gegenstand muss nicht heißen, dass man dem Liebesobjekt, seiner Schönheit und der Magie „heillos“ verfällt.
Ein aufgeklärter und spielerischer Umgang mit Symbolen, Mythen und Ritualen richtet sich auf ihre positiven Möglichkeiten. Viele Künstler und Architekten wissen um diese Kräfte. Sie finden „die richtigen Worte“ und den richtigen Ausdruck. Dani Karavan, Anselm Kiefer, Olafur Eliasson sind nur einige Namen von Künstlern, die für viele stehen, denen das gelingt. Architekten wie Herzog & de Meuron, die zu den Olympischen Spielen 2008 das Nationalstadion in Peking entworfen und realisiert haben, sind mit symbolischen Fertigkeiten vertraut und wissen um das Verbindende dieser emotionalen Kräfte und Energien. Gottfried Böhm, der einzige deutsche Pritzkerpreisträger, hat skulpturale Bauten geschaffen, die zu den Ikonen des 20. Jahrhunderts zählen.
Aber auch mancher einfache Wohnhof kann über eine hohe symbolische Qualität verfügen. Er kann als perfektes Symbol für eine Gemeinschaft gelten, indem er die Gemeinschaftsprinzipien lebendig und bildhaft vor Augen führt: das miteinander Kommunizieren, gemeinsames Essen, Spielen, die Pflege der Pflanzen und Tiere.
Die lebensreformerischen Siedlungsprojekte des CIAM (Congrès International d´Architecture Moderne) haben seinerzeit im Jahre 1929 in Frankfurt diese Ziele in Abkehr vom Mietskasernenelend der Gründerzeit verkörpert. Mit ihren für Gemeinschaftsaktivitäten symbolhaften und dazu auffordernden Außenräumen haben sie auf die identitätsstiftende Wirkung für die Gemeinschaft hingewirkt. Wohnanlagen mit solchen geschlossenen Wohnhöfen sind auch heute noch in allen großen Städten sehr beliebt. Schon 1913 war die Falkenberg-Siedlung bei Grünau im Berliner Bezirk Treptow-Köpenik von Bruno Taut entstanden. Aufgrund ihrer Farbigkeit hatte sie schnell den Namen Tuschkastensiedlung erhalten. Über das Gemeinschaftserlebnis hinaus hat das Spiel mit den Farben, wenn damals nicht unbedingt Begeisterung, so doch Aufmerksamkeit erzeugt, und dient heute noch als Identifikationsobjekt.
In einer ganz anderen Kategorie bietet ein städtisches Bauwerk, die Erasmusbrücke in Rotterdam, entworfen von dem Architekten Ben van Berkel, ein Bild, das zu einem Symbol für die Stadt Rotterdam geworden ist. Das Bild des 139 Meter hohen Pylonen, geknickt und in der Mitte gespalten, ist ein Symbol der Unvollkommenheit im Kontext einer vollkommenen Harmonie. Gerade aus diesem Widerspruch heraus ist die Brücke perfekt und ein treffendes Symbol für die Stadt Rotterdam, die im Zweiten Weltkrieg geknickt, fast nahezu zerstört worden ist.
Die Magie des Eiffelturms in Paris, Symbol für ein damaliges technisches Wunderwerk, die Gedächtniskirche in Berlin als Ruine, als Mahnmal auf dem Kurfürstendamm in Berlin, sind Beispiele für Symbole als Identifikationsobjekte. Eine Stadt muss ihre mythischen Orte und ihre Symbole hüten, bewahren und pflegen. Durch diese Orte, Räume und Gebäude, durch ihre Geschichten und Mythen wird die Stadt zusammengehalten. Das Leben erhält seine Struktur durch die Dinge, die geschehen, und die Geschichten, die darüber erzählt werden — die Mythen, die sich bilden.
Jedes Leben ist ein Mythos. In der Stadt kommen Mythen, Symbole und Rituale vielfach in gegenständlichen Formen zum Ausdruck, die viele Menschen begeistern. Die Objekte erzählen die Geschichte der Stadt auf einer überindividuellen Ebene, so wie eine Schublade in einem Küchentisch individuelle Geschichten über eine ganze Familie erzählen kann. Die Bilder schaffen Ein-Bildungen. Sie haben Auswirkungen auf die kulturellen Muster und Wertesysteme, auf die Ideen und Ideale der Bewohner und Besucher.
Eine Stadt braucht viele solcher Orte, die ihre Geschichten erzählen und die auf diese Weise Verbindungen bewirken. Die Bürger der Stadt und auch viele Besucher fühlen sich durch sie verbunden, auch wenn sich nicht alle gleichermaßen mit den einzelnen Objekten identifizieren können. Die Symbole der Stadt, aber auch die der eigenen Wohnumwelt, sind wie die Knotenpunkte in einem Netzwerk der Alltagskultur, die eine Funktion als „Muster“ in diesem Gewebe haben, die das Gewebe stabilisieren. Sie sind das „Bindegewebe“ der Gesellschaft.
Das gilt für Städte, die mit ihren Denkmälern und Kunstwerken das wertvolle Volksvermögen, das Erbe vergangener Jahrhunderte, über die Kriege hinweg bewahren konnten. Das gilt aber auch für zeitgenössische Bauwerke. Nicht umsonst hat der Architekt Oswald Mathias Ungers das Podest der 1997 eröffneten Hamburger Kunsthalle mit dem Spruch des schottischen Künstlers Hamilton Finlay überhöht: Die Heimat ist nicht das Land, sie ist die Gemeinschaft der Gefühle.
Anlässlich einer Veranstaltung zum Berichtsjahr 1994 der Internationalen Bauausstellung, IBA Berlin 1987, hat Dieter Claessen die Auffassung vertreten, dass die Stabilisierung einer Gesellschaft evolutionär über ihre Symbole erfolge. Die nicht von Instinkten geleiteten Menschen haben von je her ihr psychisches Gleichgewicht dadurch her-gestellt, dass sie ihre Umwelt ordneten und übergreifend stabilisierten. Teils geschah das durch Schutzbauten und deren „Mobilisierung“, die Abwehrwaffen, teils durch gegenseitige Benennung und Zuordnung, teils indem sie die Um-welt be-deuteten, das heißt, die Naturerscheinungen, sich selbst und die Folgen ihres eigenen und fremden Tuns als „Symbole für etwas“ auffassten. Die gesamte Umwelt, nun ihre Welt, wurde symbolisch besetzt ... Da diese Art der Stabilisierung tief in der Evolution zum Menschen hin verankert war, entwickelten sich an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Bedingungen durchaus unterschiedliche Interpretationen der Welt, unterschiedliche Symbolwirklichkeiten, die sich nach außen hin häufig am deutlichsten als religiös darstellten (Claessens, 1984).
Nach wie vor sind Symbolwirklichkeiten in der Evolution verankert. Sie haben sich in den westlich aufgeklärten Gesellschaften weitgehend von den Religionen gelöst. Allerdings beginnt der Islam heute offensiv mit seinen Gebetshäusern in ganz Europa symbolisches Terrain baulich-symbolisch zu besetzen, und sich damit zu legitimieren.
Das Bild eines eher „verklemmten“ Umgangs mit einem Symbol zeigt zum Beispiel die neue US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin, entworfen von dem kalifornischen Büro More Ruble Yudell. Botschaftsgebäude sind immer schon Symbole, indem sie baulich eine Botschaft ihres Landes vermitteln. In der Presse wurde die Botschaft als denkwürdig provinzielle Architektur beschrieben. Sie signalisiert aber in erster Linie ein „Safety first“. In Bezug auf die damalige Regierung der USA verraten die Zeichen stimmig den Hochsicherheitstrakt.
Wo es strukturelle Analogien gibt, wo innere Muster auf korrespondierende Muster in Form von Bildern, Symbolen, mythischen Orten im Außen treffen, kann sich ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Stimmigkeit, der Identität mit dem Ort oder der Situation einstellen. Seelenlandschaften korrespondieren mit äußeren Landschaften. Eine solche äußere Landschaft war seinerzeit der 1995 von Christo und Jeanne-Claude verhüllte Reichstag.
Ein Gefühl von Stimmigkeit und Zugehörigkeit lag in diesen Tagen der Verhüllung wie eine Hülle über dem gesamten Reichstagsgelände — es war eine kurze Zeit lang zu einem mythischen Ort geworden. Wie bei einem festlichen Ereignis verbreitete sich bei den sich rund um das Bauwerk aufhaltenden Menschen ein Erlebnis von Verbundenheit durch Schönheit im Anblick der silbrigen Verpackung des Gebäudes.