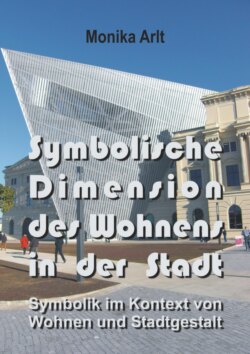Читать книгу Symbolische Dimension des Wohnens in der Stadt - Monika Arlt - Страница 9
Symbole und das Unbewusste
Оглавление
Eine Besonderheit der Symbole liegt darin, dass sie Brücken zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind. Das Unbewusste ist auch durchaus nicht nur das Unsichtbare. Es ist lediglich „der andere Schauplatz“.
Lange Zeit wurde das Unbewusste vornehmlich als das „Primitive“, das „Niedere“, das „Kranke“, das „Degenerierte“ ausgegrenzt. „Heute“, so Prof. Dr. Michael Hagner auf einer internationalen Konferenz mit dem Thema: Das Unbewusste als Störung der Wissensordnung und als Antrieb der Wissensproduktion, im Kulturlabor Berlin 2007, „leben wir in einem neurowissenschaftlichen Biedermeier“. Das Unbewusste hat aus dieser Sicht seinen Schrecken verloren. Es ist in die Bereiche des Kollektiven ausgewandert. Es ist in den Genen oder über die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften im Gehirn lokalisierbar. Wer damit allerdings meint, man habe es „im Griff“, der ist damit einer Fehlinterpretation aufgesessen.
Heute können wir sagen, dass sich das Unbewusste nicht nur im Traum, in Bildern, Symbolen, Kunst, Märchen und Mythen, Riten und Zeremonien, Sprache und Bewegung, Geschichten und Fehlleistungen mitteilt, sondern in allen Bildern, die symbolische Qualität für jemanden haben. Das kann auch das Bild einer Stadt, einer Straße, eines Quartiers sein, das Bild, das ein Künstler herstellt, oder das Bild eines psychisch Kranken. Die Bildqualität lässt das Erleben auf eine nicht vorgeformte Weise mit der symbolischen Dimension des Unbewussten interagieren.
Heute ist bekannt, dass sich das Gehirn im bewussten Bereich mit 10 bis 40 informationstechnischen Einheiten pro Minute, im unbewussten Bereich dagegen mit bis zu 100 Millionen Einheiten beschäftigt. Auch wenn die bewussten Erfahrungen nur Bruchteile ausmachen, so liegt der Rest doch nicht brach. Das Gehirn arbeitet immer.
Viele Verhaltensweisen erfolgen zwangsläufig unbewusst, reflexhaft. Wie beim Autofahren handelt es sich um automatische Vorgänge, die den bewussten Denkvorgang nur partiell tangieren. Autofahren wäre ohne solche Habitualisierung gar nicht möglich. Unbewusst ablaufende Vorgänge, eingeübte Verhaltensweisen, Habitualisierungen sind Vorbedingungen der menschlichen Existenz. Individuelle und soziale Verhaltensweisen dieser Art werden allerdings dann problematisch oder auch gefährlich, wenn die Habitualisierung die Wahrnehmung der Realität verhindert.
Gewohnheit als das Gewohnte, im Kontext einer gleichbleibenden, verlässlichen Identität, versteht sich im Festhalten und Behalten und lässt nicht los, was einmal gefunden und für gut befunden wurde. Man macht sich etwas vor und verhindert unbewusst die direkte Wahrnehmung und die diesbezügliche Gefühlswahrnehmung — zum Beispiel wenn Ordnung als höchster Wert erachtet wird und Tätigkeiten des Aufräumens und Saubermachens oder des Sammelns von Gegenständen zwanghaft werden.
In der Psychoanalyse ist das Unbewusste seit Freud, Jung und Adler ein grundlegendes Konzept. Diese Psychoanalytiker der ersten Stunde haben erkannt, dass das Unbewusste Symbole produziert, die für das menschliche Leben bedeutsam sind. Das Unbewusste lässt Intuition entstehen und es vermag Einfälle auf das hin zu ordnen, worauf es ankommt.
C. G. Jung hat sich gewünscht, dass jeder Mensch sein eigenes Unbewusstes dazu erforschen möge, und er war der Meinung, es sei der Mühe wert zu erforschen, ob das eigene Unbewusste Wege kennt und weist, die das Bewusstsein nicht erwartet. Es enthält alle Aspekte der menschlichen Natur, Gut und Böse und es ist grenzenlos und mächtig wie die Sterne)). Die Kreativität, die durch die Arbeit mit dem eigenen Unbewussten ausgelöst werden könne, sei stärker als Gewalt und sie sei auch ein angemessenes Mittel gegen Gewalt, wenn sie als Instrument genutzt werde.
Neben den individuellen Symbolen, die mit persönlichen Mustern und Komplexen korrespondieren, hat C. G. Jung eine tiefer in der menschlichen Psyche liegende Schicht des Unbewussten beschrieben, welche archetypische Vorstellungsbilder enthält. Er war der Auffassung, den Menschen sei eine Tendenz zur Formung von kollektiven und mythologischen Bildern angeboren, die kulturübergreifend überall auf der Welt entdeckt werden könnte. Diese im Menschen angelegten archetypischen Bilder könnten über die Zugänge des Unbewussten, wie Träume, Mythen, Märchen, Bilder, Spiritualität, Meditation, Yoga und anderem mehr abgerufen werden. Aus „Es“ solle „Ich“ werden — für Jung handelte es sich dabei um ein „Es“, das weit über die Triebstruktur der Sexualität hinausreicht.
Potenziell sind Symbole in der Psychoanalyse und -therapie etwas Tiefgehendes, bis hin in die „Konstruktion“ oder „Dekonstruktion“ des Unbewussten der Persönlichkeit. Für Susanna K. Langer ist die Bildung von Symbolen (…) eine ebenso ursprüngliche Tätigkeit des Menschen wie essen, schauen oder sich bewegen. Sie ist der fundamentale, niemals stillstehende Prozess des Geistes (Langer, 1965). In der Psychoanalyse und –therapie geht es ganz wesentlich darum, eine Symbolsprache für Unsagbares, Verstörendes, traumatische Erlebnisse und Beziehungen zu finden. Die Symbolisierungsprozesse sind notwendig, damit kognitiv Verstandenes emotional verfügbar gemacht werden kann.
Die Wirkung der Symbole beruht auf einer Art „psychischer Ladung“ zwischen inneren, mentalen Prozessen und äußeren Gegebenheiten. Die Farbe Rot auf großen Flächen lässt die meisten Menschen diese „Ladung“ sinnlich erfahren. Im Zusammentreffen des konkreten Objekts oder Subjekts, eines Ereignisses oder Ortes der Umwelt mit Wahrnehmungs- und Identitätsmustern von einzelnen Menschen, Gruppen oder Menschenmengen entsteht strukturelle Ähnlichkeit, eine Übereinstimmung des existenziell Vorhandenen. Eine solche Übereinstimmung ist im positiven Sinne bei der Farbe Rot die Erfahrung von etwas Hervorgehobenem, Bedeutendem, im negativen Sinne die von Bestrafung, Versagen, Verwerflichkeit. Der Begriff der Aura oder der Atmosphäre reicht nicht aus, um den Bedeutungsüberschuss dessen, was sich in diesem intermediären Raum zwischen Mensch und Umwelt ereignet, auszudrücken. Die Synthese von realer Gestalt und Vorstellung ist das Feld der symbolischen Dimension der räumlichen Umwelt.
Die heute bekannte Plastizität des Gehirns lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass Symbole auch als Muster in Form von strukturellen Analogien zwischen Außen- und Innenwelt existieren. Sie bringen sich als „Bauchgefühle“ für oder gegen die inneren und äußeren Gegebenheiten zum Ausdruck.
Der Psychologe Gerd Gigerenzer (vgl. Bauchentscheidungen, Gigerenzer 2007) vertritt die Auffassung, dass Bauchgefühle nicht nur ein Impuls oder eine Laune sind, sondern auch ihre eigene Gesetzmäßigkeit haben. Die Intelligenz des Unbewussten liegt darin, dass es, ohne zu denken, weiß, welche Regel in welcher Situation vermutlich funktioniert. Als Beispiel aus der Zeit des Nationalsozialismus verweist er auf eine Untersuchung des Historikers Christopher Brownig, die auf die besondere Identifikation von Männern in Uniform mit ihren Kameraden hinweist. Der einfachen Faustregel Tanz nicht aus der Reihe folgend, haben sich damals nur wenige Menschen den Ritualen und den unfassbar grausamen Befehlen verweigert. Die Uniform als Symbol, dessen man sich zugehörig fühlte, und die unbewusste Befolgung einer einfacher Regel hatte verheerende und moralisch verwerfliche Handlungsweisen zur Folge. Unter anderem hat auch symbolische Einsicht, die Einsicht in einen Sinn- und Bedeutungszusammenhang, den jemand nicht mehr bereit ist mitzutragen, nicht stattgefunden.
Symbolische Einsicht drängt das Negative, das Unbegreifliche und Bedrohliche nicht in die Tiefen des Unbewussten weg, sondern lässt Widersprüche und negative Emotionen zu. Wo sich Verbindung ergibt, wo eine spezifische Wahrnehmung Vergnügen bereitet oder Einsicht erzeugt, kann „Freundschaft geschlossen werden“ mit dem Gebäude, dem Ensemble, der Straße, dem Quartier, der Stadt, den Menschen und den Dingen in ihrer verbindenden symbolischen Qualität. Man fährt hin, sucht sie auf oder holt sie sich ins Haus.
Orte des Leidens und der Schande — die Vernichtungslager des Nazi-Regimes, die Wohn- und Sterbeorte für unzählige Menschen waren — sind heute Erinnerungsorte und Symbole für das größte Verbrechen an der Menschheit. Sie werden von vielen Menschen aufgesucht, die sich der Verantwortung verpflichtet fühlen, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe.
In Zeiten des Konflikts, der Gefahr und der Enttäuschung kommen symbolische und religiöse Bilder und Mythen ins Spiel, um Ideologien und Positionen in den Konflikten zu rechtfertigen. Sofern eine bestimmte Vorstellung oder Geisteshaltung als höher, überlegener oder als die einzig wahre erachtet werden, existiert ein reduziertes, eindimensionales Symbolverständnis und eine sehr eingeschränkte symbolische Einsicht. In solcher Beschränktheit sind manche Menschen sogar bereit, das eigene Leben und das anderer Menschen für die höhere Sache zu opfern.
Damit ist die Welt der Bilder, Mythen und Symbole zugleich Verbindung und Verführung, Rettungsanker und Instrument der dunklen Triebkräfte der Psyche. Es gibt das Schreckliche und das Schöne, das Gezähmte und das Ungezähmte, das Schwere und das Leichte, die Angst und die Lust. Die Bilder dazu kommen nicht aus sich heraus, sondern sind Gebilde der menschlichen Fantasie, mentale Modelle im Bewussten und im Unbewussten. Die Dämonen der Angst, der Sucht, der Hysterie und der Depression, der Zerstreuung und des Zwangs gehören als schmerzhafte Erfahrungen zum Leben. Aber viele dieser Monster lassen sich auch dienstbar machen, so, wie es die Märchen und Mythen immer schon gezeigt haben und wie sie durch gute Rituale immer wieder auch gezähmt werden konnten.
Es gibt das Wunderbare und das Geheimnisvolle. Es kann und soll Spaß machen, sich z. B. bei einem Konzert oder bei einem Fußballspiel der „unterirdischen“ Dynamik des Unbewussten hinzugeben. Ein vernünftiger Umgang mit Risiken und Unwägbarkeiten besteht in der Fähigkeit, sich mit Unsicherheit vertraut zu machen und gelassen selbst mit unlösbaren Problemen zu leben. Selbst eine „falsche“ Deutung der Welt, eine nützliche Fiktion, ist manchmal besser als gar keine, sofern sie als hilfreiche Deutung funktioniert und anderen Menschen nicht schadet.
Kreativität und Fantasie sind etwas Wunderbares, etwas, das sich naturwissenschaftlichen Gesetzen nicht unterordnen lässt. Kunst, Mythologie und symbolische Einsicht sind Formen der Erkenntnis, die Menschen untereinander und mit ihrer Lebenswelt verbinden. Wer versucht, symbolische Einsicht walten zu lassen, dem erschließt sich eine neue Weite für die Entfaltung der Persönlichkeit und dem erschließt sich auch eine tröstende Verbindung zur Ewigkeit, ohne dass dem Leben seine Realität von Schmerz und Trauer, Lust und Vergnügen genommen wird. Der unbewussten Reaktion auf Gegenstände, Bilder, symbolische Formen, Riten und Mythen hat allerdings ein bewusstes Verständnis der Zusammenhänge nachzufolgen, bei dem die Implikationen der symbolischen Dimension soweit wie möglich aufgedeckt werden.
Wahrnehmung im Sinne eines solchen Verständnisses ist mehr als Sehen, Wiedererkennen und der Gebrauch der Gegenstände. Sie schließt die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Lust oder Unlust, vernünftiges oder unvernünftiges Verhalten, Langeweile oder Ergriffenheit mit ein und erstreckt sich auf über den Gegenstand hinausgehende Informationen, die einen Wert oder eine Bedeutung für den Wahrnehmenden enthalten. Die Wirklichkeit ist nicht mehr zum Wegschauen, sondern dient dazu, die Welt um eine erstaunliche und erträgliche Dimension zu erweitern. Es besteht deshalb eine Verpflichtung dahin gehend, die symbolischen Implikationen von Ereignissen, Objekten, Orten aufzudecken und soweit wie möglich transparent zu machen. Dafür muss die verlorene Sprache der Symbole wiedererlernt werden. So ist es beispielsweise für Eltern sehr wichtig, sich darüber zu informieren und sich damit auseinandersetzen, welche Symbolik ihre Kinder in ihren Kinderzimmern verwenden. Gruppen und Kulte, die bestrebt sind Jugendliche an sich zu binden, verfügen über solche Symbole, und als verantwortungsvolle Eltern gehört es zu ihrer Aufsichtspflicht sich damit auseinanderzusetzen und auch den Kindern und Jugendlichen den Kontext deutlich zu machen. Die „psychische Ladung“ von Symbolen, die Gefühlsreaktionen auslöst, kann „zum Sprechen“ gebracht werden und dadurch bestenfalls Gegensätze innerhalb der eigenen Psyche miteinander versöhnen. Dies wahrzunehmen ist eine Chance, die den Sinn des Erwerbs symbolischer Fähigkeiten begründet.
„Sich wiederfinden“ kann man auch in der Realität der Natur, der Landschaften, Wälder, an Flüssen, Bergen, Seen sowie in der Kunst, in Bildern, in der Musik. Das Erlebnis ist immer wieder ein beglückendes, eines, das „begeistert“, das über die eigene Person hinausweist.
Aber auch gebaute Umwelt kann Menschen begeistern. Die Gedächtniskirche, der Eiffelturm, das Brandenburger Tor, die Freiheitsstatue in New York und die Jesus-Statue in Rio — Bauwerke und Wahrzeichen in aller Welt haben ihre Fans. Sie sind für sie Symbole für Freiheit, Mut, Glauben, Vertrauen, Sicherheit, Lebenslust, Heimat, Zuversicht.
Gruppen und manchmal auch Massen von Menschen lassen sich von etwas begeistern, das sie anzieht, beglückt, manchmal sogar verändert. Je mehr Geschichten — auch widersprüchliche — damit verbunden sind, desto stärker das Symbol. Geschichten, die von vielen verstanden werden, setzen Kräfte frei. Die Betrachter, Benutzer, Leser, Hörer, Liebhaber sind begeistert, fasziniert von etwas Gemeinsamem, etwas Geheimnisvollem, und dieses Etwas ist Projektionsfläche für Eigenes, für die eigenen Vorstellungen, Erfahrungen und Wünsche.
Der amerikanische Komplexitätsforscher Stuart Kauffman hat dem Universum die Spur einer enormen, zumindest teilweise keinen Grenzen unterworfene Kreativität zugewiesen, die er als „Wunder“ bezeichnete. Ein Absatz aus dem Glaubensbekenntnis von Albert Einstein weist einen ähnlichen Weg: Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist Unerreichbares verborgen ist, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich religiös. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.