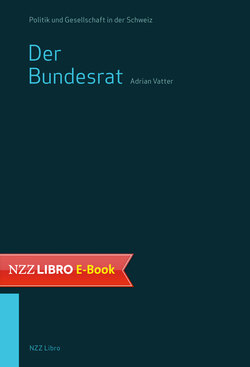Читать книгу Der Bundesrat - Adrian Vatter - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Die Stellung der Schweizer Regierung im internationalen Vergleich
ОглавлениеDas Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative bildet eines der wichtigsten Ausprägungsmerkmale eines politischen Systems, wobei es in der Praxis vergleichsweise schwierig zu erfassen ist (Lijphart 2012).23 Beschränkt man sich zunächst auf die Erfassung der formalen Befugnisse von Regierung und Parlament, wie sie Siaroff (2003) vorgenommen hat24 und wie sie von Vatter (2009) für weitere Länder ergänzt wurde, zeigt sich ein klares Bild:25 Das Schweizer Parlament nimmt innerhalb der OECD-Staaten in Bezug auf seine verfassungsrechtliche Stellung und seine formalen Mitwirkungsrechte einen Spitzenplatz ein (siehe Abbildung 2.2). Die Schweiz gehört damit wie die nordischen Länder in diejenige Gruppe, in der die Regierung nur schwach ausgebaute Agendakontrollrechte besitzt. Somit unterscheidet sie sich stark von majoritär geprägten Ländern wie Grossbritannien und Kanada mit einer dominanten Exekutive. Diese Erkenntnisse bestätigen zunächst die ältere Forschung, die die Schweiz in der Regel derjenigen Ländergruppe zuordnet, die sich aus einer komparativen Perspektive durch die geringste Regierungskontrolle und die gleichzeitig ausgeprägtesten Befugnisse der parlamentarischen Ausschüsse und der einzelnen Abgeordneten auszeichnet (Döring 1995).
Es wäre jedoch unvollständig, die Machtverhältnisse zwischen Exekutive und Legislative aus einer rein formalrechtlichen Perspektive zu erfassen. Ebenso relevant sind die effektiven Kontrollmöglichkeiten des Parlaments gegenüber der Regierung, die von Informations- und Kontrollressourcen bestimmt werden. Schnapp und Harfst (2005) nehmen eine Erhebung dieser Ressourcen in 22 westlichen Demokratien vor.26 Hier zeigt sich, dass die starken formalen Befugnisse der Schweizer Legislative keine Entsprechung in der Ressourcenausstattung der eidgenössischen Parlamentsmitglieder finden. Diese sind vielmehr im internationalen Vergleich äusserst spärlich ausgestattet und belegen den viertletzten Rang unter den knapp zwei Dutzend Ländern, ganz im Gegensatz zu den grosszügig mit Mitteln bedachten Volksvertretern und Volksvertreterinnen etwa in Deutschland oder den USA. Damit bestätigen Schnapp und Harfst (2005) die Befunde von Z’graggen und Linder (2004) und Z’graggen (2009), die den Schweizer Nationalrat in einer vertieften Analyse von 20 OECD-Staaten als eines der am schwächsten professionalisierten Parlamente mit sehr geringen Ressourcen bezeichnen, das einer hochprofessionellen Exekutive gegenübersteht.27
Schliesslich können die formalen Legislativrechte nach Siaroff (2003) sowie die parlamentarischen Kontroll- und Machtressourcen nach Schnapp und Harfst (2005) unter gleichmässiger Gewichtung zu einem kombinierten Index des formalen und faktischen Verhältnisses zwischen Exekutive und Legislative zusammengefasst werden.28 Die Ausrichtung der Indizes wird beibehalten, sodass höhere Werte auf Exekutivdominanz hinweisen (siehe Abbildung 2.3). Die Kombination der formalen und der faktischen Machtverhältnisse zwischen Exekutive und Legislative bestätigt die spezifische Mischform der schweizerischen Demokratie im internationalen Vergleich. Der Nationalrat hat zwar ausgeprägte formale Befugnisse gegenüber dem Bundesrat, die jedoch zu einem beträchtlichen Teil durch eine geringe Ressourcenausstattung neutralisiert werden. Eine Erkenntnis, die im Übrigen auch durch Einschätzungen von Expertinnen und Experten bestätigt wird (Vatter 2008).
Flick Witzig und Bernauer (2018) haben eine neue und vom Regierungssystem unabhängige Messung der Machtteilung zwischen Exekutive und Legislative im internationalen Vergleich vorgenommen, die nicht nur auf das Modell der parlamentarischen Demokratie Bezug nimmt. Bei ihrer Messung des Machtverhältnisses zwischen Regierung und Parlament legen Flick Witzig und Bernauer (2018) das Gewicht nicht auf die verfassungsmässig festgelegten Rechte der beiden Gewalten, sondern auf ihre tatsächlichen Befugnisse in der politischen Praxis sowie auf die der Legislative zustehenden Ressourcen. Gemäss ihrer empirischen Analyse von 22 Demokratien befindet sich das Schweizer Parlament im Mittelfeld, während es zusammen mit der spanischen und isländischen Legislative das Schlusslicht bildet, was die ressourcenbedingte Parlamentsausstattung angeht.
Die Befunde zeigen, dass je nach Perspektive die Schweiz über ein sehr mächtiges Parlament und eine schwache Regierung oder über ein sehr ausgeglichenes Machtverhältnis zwischen Exekutive und Legislative verfügt. So gibt es zunächst keine andere entwickelte Demokratie, bei der das Parlament eine verfassungsrechtlich so starke und von der Regierung unabhängige Stellung hat wie die Schweizer Bundesversammlung, was damit zusammenhängt, dass die Schweiz über ein nicht parlamentarisches System verfügt. Vor allem hinsichtlich der Wahl der Regierung, des Verhältnisses zwischen Regierung und Parlament sowie der Auslösung der und Mitwirkung an der Gesetzgebung verfügt das Bundesparlament über eine starke Stellung gegenüber dem Bundesrat. Dies relativiert sich aber, wenn man die tatsächlichen Befugnisse in der politischen Praxis berücksichtigt. So wird beispielsweise die Kontrolle der Regierung durch das Parlament durch das Fehlen einer grossen Oppositionspartei geschwächt. Noch einmal anders sieht es aus, wenn die Ausstattung mit legislativen Ressourcen in den Mittelpunkt gerückt wird. Hier steht die Schweiz an drittletzter Stelle. Als Milizparlament mit fast keinem eigenen Personal bleibt ihm trotz vieler Kompetenzen zwangsläufig nur eine selektive Kontroll- und Gesetzgebungstätigkeit gegenüber Regierung und Verwaltung übrig. Trotzdem sollte sein effektiver Einfluss nicht unterschätzt werden (Vatter 2018).