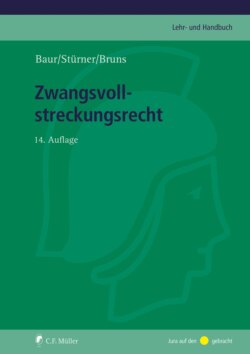Читать книгу Zwangsvollstreckungsrecht, eBook - Alexander Bruns - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Partikulare Gesetzgebung, französisches Recht und Reichszivilprozessordnung
ОглавлениеSchrifttum:
Gaul ZZP 85 (1972), 251; Schlink, Commentar über die französische Civil-Prozessordnung, Bd. IV, 1857; Hahn, Materialien zur ZPO, Bd. I, II, 1880, S. 420 ff.
3.20
Die Vollstreckungsprinzipien des gemeinen Prozesses sind nach und nach durch partikulare Gesetzgebung verändert worden, die nach 1806 auch immer stärker französischer Vorlage folgte. Die Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten von 1793 (24. Titel) versuchte, die kritisierte Schwerfälligkeit gemeinrechtlicher Vollstreckung zu vermeiden, indem sie außer dem Exekutionsgesuch beim Prozessgericht erster Instanz keine weiteren Gläubigeranträge zum Fortgang des Verfahrens verlangte, vielmehr das Gericht von Amts wegen die Vollstreckung durch seine Exekutoren weiter betreiben ließ (Amtsbetrieb). Den entscheidenden Anstoß zu Neuerungen gaben hingegen der französische Code civil und der Code de procédure civile von 1806. Der Code de procédure civile war von dem Grundgedanken bestimmt, die Vollstreckung sei Sache der Parteien, nicht des Gerichts (Deregulierung der Vollstreckung). Daraus ergaben sich wichtige Konsequenzen. Das mit einer Klausel versehene Urteil konnte vom Gläubiger vollstreckt werden, ohne dass es gerichtlicher Mitwirkung bedurfte; der Gläubiger erhielt vielmehr direkten Zugang zum Vollstreckungsorgan. Das Vollstreckungsorgan, nämlich der Gerichtsvollzieher („huissier“), war Beauftragter des Gläubigers und nicht Hilfsorgan des Gerichts. Der Gerichtsvollzieher war umfassend für alle Formen der Geldvollstreckung zuständig (Mobiliarpfändung, Forderungspfändung, Immobiliarpfändung), gerichtliche Mitwirkung blieb die – z.T. allerdings unvermeidbare – Ausnahme; Naturalvollstreckung kannte der Code civil – eine Nachwirkung römischrechtlicher Geldkondemnation und Konsequenz der Deregulierung der Vollstreckung – so gut wie nicht (art. 1142–1144 C.c.), sodass der „huissier“ als Gläubigerbeauftragter hauptsächliches Vollstreckungsorgan war. Einwendungen gegen die Vollstreckung waren ebenso wie Drittrechte beim Tribunal de grande instance durch Nichtigkeits-, Aufhebungs- oder Distraktionsklage zu verfolgen, das regelmäßig im abgekürzten référé-Verfahren zu entscheiden hatte; es gab also keine fortdauernde Zuständigkeit des ursprünglich befassten Prozessgerichts („Desaisierungsprinzip“), vielmehr war eine spezielle vollstreckungsgerichtliche Zuständigkeit geschaffen. Gegen den Gerichtsvollzieher musste der Gläubiger Erfüllungsklage erheben. Die Wahl der Vollstreckungsarten stand dem Gläubiger frei (Ausnahme: Vorrang der Mobiliarvollstreckung bei Geschäftsunfähigen, art. 2092, 2206 C.c.). Der Code de procédure civile galt in Deutschland voll oder modifiziert für Rheinpreußen, Rheinhessen, Rheinbayern, Westfalen und das Großherzogtum Berg. Die neuen Prozessordnungen von Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lübeck, Baden, Württemberg und Bayern nahmen Parteidisposition, Dezentralisierung und Trennung von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren als Grundthemen moderner Vollstreckung teilweise auf.
3.21
Die Reichszivilprozessordnung von 1879 schuf auf der Basis verschiedener Entwürfe (hannoverscher, preußischer, norddeutscher Entwurf) dann ein Vollstreckungssystem, das französischen Neuerungen und gemeinrechtlicher Tradition gleichermaßen Rechnung trug. Die ZPO übernahm die Trennung von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren und ließ den mit Klausel versehenen Titel als Grundlage der Vollstreckung – ohne actio iudicati oder Exekutionsgesuch – genügen. Der Gläubiger hatte direkten Zugang zum Vollstreckungsorgan und freie Wahl der Vollstreckungsart. Neben dem Gerichtsvollzieher nach französischem Vorbild stellte die ZPO aber das Vollstreckungsgericht als gewichtiges Vollstreckungsorgan der Forderungspfändung und Immobiliarvollstreckung. Die Rechtsbehelfe wurden aufgeteilt: formelle Mängel zum Vollstreckungsgericht (französisches Vorbild), materielle Einwände zum Prozessgericht (gemeinrechtliches Vorbild). Die Vollstreckungsarten orientierten sich am gemeinen Vollstreckungsrecht, berücksichtigten aber anders als das französische System im Einklang mit dem materiellen Recht stärker den Grundsatz der Naturalvollstreckung; dabei war für Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung nach gemeinrechtlichem und preußischem Vorbild das Prozessgericht erster Instanz Vollstreckungsgericht. Nicht übernommen ist von der ZPO weiter das Gleichrangprinzip unter mehreren pfändenden Gläubigern (art. 656 c.p.c.), das sich in Frankreich vor allem auch aus der Beschränkung des Insolvenzverfahrens auf Kaufleute bzw. Gewerbetreibende erklärt (hierzu Rn. 59.7, 59.8, 59.11, ferner Bd. II Rn. 3.20, 39.1). So präsentiert sich das Vollstreckungsrecht der ZPO als eigenständiges Gebäude aus gemeinrechtlichen und französischen Bausteinen. Die neuen, ideologisch begründeten Anstöße kamen aber – ähnlich wie im Erkenntnisverfahren – aus Frankreich.