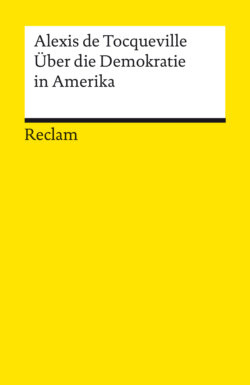Читать книгу Über die Demokratie in Amerika - Alexis de Tocqueville - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[9]Tocqueville und sein Werk
ОглавлениеTocquevilles Buch De la démocratie en Amérique (Über die Demokratie in Amerika) erschien im Jahre 1835. Drei Jahre vorher war sein Verfasser aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wo er fast ein Jahr geweilt hatte. Wie Montesquieu den Geist der Gesetze nur nach der Erfahrung der englischen Staatswirklichkeit schreiben konnte, so war auch für Tocqueville der Umgang mit der gelebten und erlebten Wirklichkeit der jungen amerikanischen Demokratie unerlässlich für die Konzeption seines Buches. Gemeinsam mit seinem Freund Gustave de Beaumont hatte er als Vorwand der Reise das Studium des amerikanischen Gefängniswesens gewählt; in der Tat veröffentlichten die beiden Reisegefährten im Jahre 1833 gemeinsam ein Buch Du Système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France. Sicherlich war jedoch der eigentliche Anlass der Reise, jedenfalls für Tocqueville, das Studium der amerikanischen Demokratie. Es handelte sich für ihn nicht nur um eine Beschreibung und Interpretation des amerikanischen Staates und der ihn tragenden Gesellschaftsordnung, sondern gleichzeitig um die Anwendung der dort zu findenden Tendenzen auf die staatliche und soziale Welt Frankreichs. Auf vielen Seiten des vollendeten Werkes findet der aufmerksame Leser die Bestätigung dieser zweifachen Blickrichtung.
Es erübrigt sich hier, auf die amerikanische Reise Tocquevilles näher einzugehen. George Wilson Pierson hat sie gleichsam Tag für Tag in seinem bahnbrechenden Buch Tocqueville and Beaumont in America (1938) restituiert. Hier interessiert uns vor allem das vollendete Produkt: das [10]Werk Über die Demokratie in Amerika, das wir dem Leser in einer, wie ich hoffe, gültigen Auswahl vorlegen. Dem ersten Bande vom Jahre 1835 folgte im Jahre 1840 ein Schlussband.
Der erste Band beschäftigt sich hauptsächlich mit der soziologischen Analyse des amerikanischen Staates: nicht nur mit der Struktur des amerikanischen Bundesstaates, sondern auch mit der Struktur der Einzelstaaten, wie sie aus ihren ethnisch-geographischen und historischen Voraussetzungen entstanden sind. Lange bevor das Wort Soziologie zur Mode geworden war, handhabte Tocqueville diese Wissenschaft mit klassischer Meisterschaft.
Nur auf einige zentrale Punkte sei hingewiesen: Der Abschnitt 9 unserer Auswahl untersucht die Omnipotenz der Mehrheit in den Vereinigten Staaten und deren Wirkungen. Niemand kann sich ihrem Einfluss entziehen. Ein wahres Entsetzen leuchtet durch die Schärfe und untrügliche Analyse des großen Staatsdenkers, der andererseits jedoch ganz überzeugt ist, dass die Majoritäts-Demokratie das Schicksal der europäischen Welt ist und ihre nahe und ferne Zukunft einschließt. Wie kann man ihre Allgewalt hemmen und einschränken? Die Beantwortung dieser Frage ist Tocquevilles Grundanliegen. Hier wendet sich sein Blick auf die englischen Staatstraditionen, die er, bevor er den ersten Band des Amerika-Werkes veröffentlicht hatte, an Ort und Stelle studierte. Tocqueville ist im Jahre 1833 nach England gefahren, sicherlich, weil ihm die britische Staats- und Sozialwirklichkeit für die Ausarbeitung seiner eigenen Staatssoziologie unerlässlich schien. Die Bedeutung der englischen Lokalverwaltung, die Unabhängigkeit des englischen Rechtswesens, die Offenheit der [11]englischen Aristokratie – vielleicht die bedeutendste Entdeckung der historischen Soziologie Tocquevilles – sind ihm hier aufgegangen. Tief schöpft er aus Blackstones Kommentaren und des Genfers De Lolme Buch über die englische Verfassung.2 Beide Werke sind für Tocqueville ebenso wichtig wie die lebendige Erfahrung der englischen staatlichen und gesellschaftlich-geschichtlichen Einrichtungen. Dem angloamerikanischen Rechtsgeist widmet er eine Darstellung, die für alle rechtssoziologischen Untersuchungen beispielgebend bleiben muss. Nichts lässt sich der Tocqueville’schen Analyse der soziologischen Bedeutung des Geschworenen-Kollegiums (jury) zur Seite stellen, selbst nicht das Beste in den rechtssoziologischen Arbeiten Max Webers, der überdies mit Tocqueville viel Gemeinsames hat.
Man sieht überall, wie Tocqueville, der durch die Schule der großen französischen Magistrate gegangen ist, den Rechtsgeist die staatlichen Einrichtungen durchdringen lässt. Er dringt bis zur Struktur der Dinge vor: älteste Traditionen werden lebendig und das Gegenwärtige weist in die Zukunft. So wächst der zweite Teil des ersten Bandes in eine Soziologie des amerikanischen politischen Geistes, wobei das Wort »politisch« im überparteilichen, allumfassenden Sinne der platonisch-aristotelischen Tradition verstanden werden muss. Plato, Aristoteles, Machiavelli, Bodin und immer wieder Montesquieu, der Tocqueville bis in den Stil bestimmt hat, bilden die Ahnenreihe des Amerika-Werkes.
Die Gegenwartsbedeutung der rechts- und [12]staatssoziologischen Einsichten Tocquevilles kann noch genauer aufgezeigt werden: Als die Richter des Obersten Bundes-Gerichtshofes durch ihre Entscheidung vom 24. Juli 1974 Richard Nixon zum Rücktritt zwangen, beriefen sie sich ausdrücklich auf die von Montesquieu festgelegte Grundregel, dass eine freie republikanische Regierung sich der juristischen Macht, die im Konflikt der Legislative mit der Exekutive unabhängig sein muss, zu beugen habe. Die obersten Bundesrichter zitierten in ihrer Urteilsbegründung Montesquieu unter Berufung auf einen der Gründungsväter der amerikanischen Verfassung: In der Tat hatte sich Madison im Federalist (Nr. 47) auf Montesquieu bezogen. Der Federalist ist eine der Hauptquellen Tocquevilles, und so ist es keineswegs zufällig, wenn Tocqueville in unserem Band schreibt: »Es gibt in den Vereinigten Staaten kaum ein politisches Problem, das nicht früher oder später zu einem rechtlichen Problem wird.« Wie oft ist dieser schwerwiegende Satz während des Verlaufes der Watergate-Angelegenheit zitiert worden!
Kaum war der erste Band veröffentlicht, machte sich Tocqueville an die Ausarbeitung des zweiten Bandes, der ihn fünf Jahre in Atem hielt. Sein Weltruhm war sichergestellt. Chateaubriand, mit dem ihn verwandtschaftliche Bande verknüpften, Royer-Collard, Sainte-Beuve begrüßten den Dreißigjährigen als »Montesquieu des 19. Jahrhunderts«. In England feierte ihn John Stuart Mill nicht anders. Das Werk wurde von F. A. Rüder 1836 ins Deutsche übertragen; die Geschichte seiner tiefen Wirkung auf den deutschen Frühliberalismus ist wichtig.
Im Jahre 1835 reiste Tocqueville erneut nach England. Dort traf er Mill, den bedeutenden Nationalökonomen [13]Nassau-Senior, mit dem er zeitlebens in regstem freundschaftlichem Austausch blieb; auch Henry Reeve, seinen treuen Übersetzer und Freund, und viele andere bedeutende Gestalten der damaligen englischen politischen Welt.
Zweifellos ist der zweite Band des Amerika-Werkes reifer, abgeklärter. Sainte-Beuve, der große französische Kritiker, so abwegig sonst sein Urteil über den Schlussband von Tocquevilles Werk ist, hat doch in einem recht: Amerika wird zum Vorwand, die zukünftigen Tendenzen der demokratischen Welt zu erfassen. Tocqueville fühlte die methodische Schwierigkeit des zweiten Bandes selbst, denn er schreibt in einem Briefe an John Stuart Mill vom 18. Dezember 1840: »Dieser zweite Teil der Demokratie war in Frankreich weniger populär als der erste […]. Ich bin daher sehr beschäftigt, in mir selbst den Fehler zu suchen, in den ich verfallen bin […]. Ich glaube, dass das Übel, das ich suche, sich in der Problemstellung des Buches selbst findet. Es schließt etwas Obskures und Problematisches ein, das die große Menge nicht ergreift. Als ich ausschließlich von der demokratischen Gesellschaft der Vereinigten Staaten sprach, verstand man das sofort. Wenn ich von unserer demokratischen Gesellschaft in Frankreich gesprochen hätte, so wie sie sich heute darstellt, hätte man das auch noch gut begriffen. Aber indem ich von Ideen ausging, die mir die amerikanische und französische Gesellschaft zur Verfügung stellten, wollte ich allgemeine Züge demokratischer Gesellschaften zeichnen, von denen noch kein vollständiges Modell existiert.«3 Tocqueville war wie Montaigne, Pascal und Montesquieu – und er gehört [14]durchaus in diese Klasse von Denkern – ein Meister der Selbstanalyse.
Der Leser muss sich diese Sätze scharf einprägen, bevor er an die Lektüre des zweiten Bandes geht: in der Tat, Amerika wird zum Vorwand, denn Tocquevilles Untersuchungen dringen an jeder Stelle zur universellen Problematik einer demokratischen Weltordnung vor, wie sie heute vor uns steht. Dies gibt dem Werk seine faszinierende Aktualität, die uns immer wieder in ihrem Bann hält.
Ein Kapitel wie das über »die Aristokratie der Industrie« oder »Weshalb die großen Revolutionen selten werden« illustrieren seine Überlegenheit selbst gegenüber seinen bedeutendsten Zeitgenossen; so z. B. Karl Marx. Während Marx das »Absterben« des Staates lehrte, zeigt uns Tocqueville, wie dessen Macht zum Leviathan wird, der uns heute, mehr als hundert Jahre nach der Veröffentlichung des zweiten Bandes des Amerika-Werkes, fast völlig verschlungen hat. Immerhin haben wir in Europa und in Amerika noch die Freiheit, Tocquevilles Warnungen zu veröffentlichen – und vielleicht sogar sie zu lesen und zu beachten.
Die gefahrdrohende Spannung zwischen Gleichheit und Freiheit, wie sie die historisch unvermeidliche Angleichung der Menschen zur Folge hat, ist von Marx übersehen worden. Dieser hatte seine Staatstheorie an Spinoza und Rousseau orientiert, und diese Letzteren hatten ihre politischen Philosophien am Kleinstaat ausgerichtet. Auch die Staatstheorie Hegels kennt die Problematik des modernen Massenstaats nicht. Montesquieu, der mit den gefährlichen Spannungen des Großstaates durch seine Studien über den Niedergang Roms tief vertraut war, hatte den stärksten [15]Einfluss auf Tocqueville, der dessen Geist der Gesetze gleichsam auswendig wusste. Viele Stellen des vorliegenden Buches belegen dies. Marx dagegen hat über die Großstaatsproblematik bei Montesquieu hinweggelesen.
Nur die administrative Dezentralisierung der staatlichen Zentralgewalt kann die menschliche Freiheit existentiell bewahren. Es ist möglich, dass Tocqueville die potentielle Kraft der englisch-amerikanischen lokalen Verwaltung überschätzt hat. Wahrscheinlich sind seine englischen und amerikanischen liberalen Freunde, die seine unermüdlichen Fragen beantwortet haben, zu optimistisch gewesen. Denn wir sehen heute, um nur von England zu sprechen, wie sich anonyme zentralistische Bürokratien auch in die Distrikte und Grafschaften eingenistet haben. Und trotzdem ist die Tocqueville’sche These von der Wichtigkeit der politischen Partizipation des Staatsbürgers im kleinsten kommunalen Bereich eines der grundlegenden Desiderata unserer krisengeschüttelten Gegenwart.
Der vierte Teil des zweiten Bandes ist ohne Zweifel eines der bleibenden Meisterwerke der soziologischen Weltliteratur. Erst unsere unmittelbare Gegenwart macht diese tiefschichtige Analyse völlig verständlich.
Die Seiten, mit denen Tocqueville sein Amerika-Werk beschließt, helfen uns, unseren geschichtlichen Standort zu verstehen und vielleicht sogar die Instrumente zu entwerfen, der Zukunft gewachsen zu sein. Hier fasst Tocqueville zehnjähriges Nachdenken und Erfahrung zusammen. »Ich denke«, so schreibt er, »dass in den demokratischen Jahrhunderten, die sich jetzt eröffnen, die individuelle Unabhängigkeit und die lokalen Freiheiten immer ein Produkt der Kunst sein werden. Die Zentralisation wird die [16]natürliche Regierung sein.« Er meint selbstredend mit dem Begriff »Kunst« die politische Kunst – die Politik.4
Alexis de Tocqueville, der, aus altem normannischem Adel stammend, 1805 in Paris geboren wurde, starb in Cannes im Jahre 1859. Er war in der Hochblüte des Zeitalters Louis Napoleons in seinem eignen Vaterland zum politischen Emigranten geworden. Er hat für die Zukunft geschrieben, die jetzt unsere Gegenwart ist.
J. P. Mayer