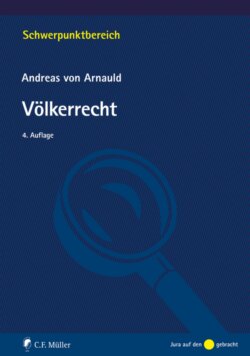Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 94
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Sicherheitsrat
Оглавление151
Der Sicherheitsrat besteht aus 15 (bis 1965: elf) Mitgliedern, darunter fünf ständige Mitglieder: die Volksrepublik China (seit 1971, zuvor die Republik China, das heutige Taiwan), Frankreich, Russland (seit 1991 für die frühere UdSSR), das Vereinigte Königreich und die USA (vgl. Art. 23 Abs. 1 UNCh). Die nichtständigen Mitglieder werden von der Generalversammlung auf zwei Jahre gewählt (Art. 23 Abs. 2 UNCh). Die Wahl orientiert sich an einem Regionalschlüssel: Von den zehn nichtständigen Mitgliedern stammen drei aus Afrika, zwei aus Asien, zwei aus Lateinamerika, eines aus Osteuropa und zwei aus Westeuropa oder der übrigen westlichen Welt (Kanada, Australien, Neuseeland). Die Bundesrepublik Deutschland ist 2019-20 zum sechsten Mal als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat vertreten (zuvor 1977-78, 1987-88, 1995-96, 2003-04 und 2011-12).
152
Der Sicherheitsrat fasst seine Beschlüsse mit der Zustimmung von mindestens neun (bis 1965: sieben) Mitgliedern. Die ständigen Mitglieder besitzen in allen Fragen, die nicht Verfahrensfragen sind, ein Vetorecht (Art. 27 Abs. 2 und 3 UNCh).[135] Zwar sieht die UN-Charta ihrem Wortlaut nach vor, dass in diesen Fragen alle ständigen Mitglieder zustimmen müssen; in der UN-Praxis hindert aber die Abwesenheit oder Stimmenthaltung eines ständigen Mitglieds das Zustandekommen des Beschlusses nicht.[136] Umstritten ist, ob diese Praxis als „kreative“ Vertragsinterpretation angesehen werden kann oder als derogierendes (d. h. die vertragliche Regelung abbedingendes) Gewohnheitsrecht einzustufen ist; hier geht es letztlich um die Frage einer Wortlautgrenze bei der Interpretation. Eine Pflicht zur Stimmenthaltung wegen Befangenheit sieht Art. 27 Abs. 3 nur bei Beschlüssen zur friedlichen Streitbeilegung im Rahmen von Kapitel VI und Art. 52 Abs. 3 UNCh vor, nicht bei Sanktionsbeschlüssen nach Kapitel VII. Dies verdeutlicht, dass der Sicherheitsrat ein politisches Organ ist, für das der Rechtsgrundsatz nemo judex in causa sua („niemand soll Richter in eigener Sache sein“) nicht gilt.
153
Einer Umgehung des Vetorechts durch ein Umdeklarieren von Sachfragen in Verfahrensfragen (für die kein Vetorecht gilt), scheitert an der Praxis des sog. doppelten Vetos: Ein Mitglied kann eine Abstimmung darüber verlangen, ob eine Frage tatsächlich eine Verfahrensfrage ist. Bei dieser Abstimmung kann ein Veto eingelegt werden, weil sie keinen (reinen) Verfahrenscharakter hat. Wird ein Veto eingelegt, gilt die ursprüngliche Frage als „sonstige Frage“, für die Art. 27 Abs. 3 UNCh die Zustimmung aller ständigen Mitglieder verlangt. Wird nun in der Sache abgestimmt, so besteht die Möglichkeit, mit einem weiteren Veto den Beschluss zu verhindern.
154
Fall: Überstimmt
Asparien, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, ist maßgeblich in einen Konflikt in Xylistan involviert. Die übrigen Mitglieder des Sicherheitsrates beabsichtigen, dies in einer Resolution zu verurteilen, was Asparien durch Veto blockieren könnte. Daher stellt Bitumien im Sicherheitsrat den Verfahrensantrag, wonach ein Mitglied, das selbst Partei eines Konflikts ist, von Abstimmungen in Bezug auf diesen Konflikt ausgeschlossen ist. Lässt sich das drohende Veto von Asparien auf diesem Wege umgehen?
Lösungshinweis:
Nein. Asparien kann den Antrag stellen abzustimmen, ob der Antrag Bitumiens eine Verfahrensfrage betrifft oder nicht. Diese Abstimmung hat selbst keinen reinen Verfahrenscharakter. Asparien kann nun mit seinem Veto verhindern, dass die Frage der Befangenheit zur Verfahrensfrage erklärt wird. Sollte der Antrag Bitumiens sodann als Nicht-Verfahrensfrage zur Abstimmung kommen, könnte Asparien erneut sein Veto einlegen und so verhindern, von der Abstimmung über die Resolution ausgeschlossen zu werden.
155
Der Sicherheitsrat hat gemäß Art. 24 UNCh die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit“. Diese nimmt er insbesondere nach den Kapiteln VI (friedliche Streitbeilegung), VII (Maßnahmen zur Friedenssicherung) und VIII (Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen) wahr (Rn. 441–443, 1054–1078).[137] Gemäß Art. 25 UNCh kann der Sicherheitsrat im Rahmen seiner Aufgaben gegenüber allen Mitgliedern verbindliche Beschlüsse fassen. Diese gehen als „Verpflichtungen aus der Charta“ gemäß Art. 103 UNCh allen übrigen völkerrechtlichen Pflichten der UN-Mitglieder vor. Die systematische Stellung von Art. 25 macht deutlich, dass diese Befugnis sich nicht allein auf Beschlüsse nach Kapitel VII beschränkt (dort sind Art. 48 und 49 UNCh leges speciales). Vielmehr ist durch Auslegung in jedem Fall zu ermitteln, ob der Sicherheitsrat eine verbindliche Anordnung bezweckt, wie er dies außerhalb von Kapitel VII z.B. im Zusammenhang mit rechtswidrigen Situationen und der Pflicht zu deren Nichtanerkennung wiederholt getan hat.[138] In Art. 25 UNCh liegt auch Potential zu einer dynamischen Erweiterung der Befugnisse des Sicherheitsrates, namentlich im Bereich des peacebuilding (Rn. 1064). Von Sicherheitsrat und Generalversammlung gemeinsam eingesetzt wurde im Dezember 2005 die UN Peacebuilding Commission, die v. a. den Sicherheitsrat in Fragen der Konfliktnachsorge beraten soll.[139]
Hinweis zum Aufbau von Sicherheitsratsresolutionen:[140] Resolutionen des Sicherheitsrates bestehen aus zwei Teilen: einer Präambel und einem operativen Teil. Die Präambel enthält Hintergrunderwägungen, die zu den Beschlüssen des Sicherheitsrates geführt haben. Sie ist selbst nicht rechtsverbindlich, kann aber einen Beitrag zur Auslegung des operativen Teils leisten. Der operative Teil enthält sodann die eigentlichen (durchnummerierten) Beschlüsse. Mit der häufig verwendeten Schlussformel, wonach er beschließt, „mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben“, macht der Sicherheitsrat deutlich, dass er das Heft des Handelns in der Hand behalten will. Dies hat Bedeutung für die Sperrwirkung des Art. 12 UNCh gegenüber der Generalversammlung, markiert aber auch Grenzen unilateraler Aktionen von Mitgliedstaaten.
156
Resolutionen, die der Sicherheitsrat unter Kapitel VII in Reaktion auf eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens oder auf eine Angriffshandlung treffen kann, zielen ihrem Wesen nach auf anlassbezogene Maßnahmen. So können gegen einen Friedensbrecher z. B. Wirtschaftssanktionen verhängt oder militärische Sanktionen autorisiert werden. Ist die Bedrohung für den Frieden gebannt oder erscheint es dem Sicherheitsrat aus anderen Gründen opportun, werden die Maßnahmen wieder beendet. Solche Maßnahme haben individuell- oder generell-konkreten Charakter, ähneln also dem Handeln einer „Weltexekutive“. Hiervon wich erstmals Resolution 1373 (2001) ab, in der der Sicherheitsrat in Reaktion auf die Terroranschläge in New York und Washington vom 11.9.2001 generell-abstrakte Pflichten der Staaten bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus formulierte.[141] Derartige Resolutionen werfen die Frage auf, ob der Sicherheitsrat durch die Charta überhaupt zum Erlass von Sekundärrecht ermächtigt, also gewissermaßen als Weltgesetzgeber eingesetzt ist. Sieht man einen solchen Rollenwechsel als von den implied powers noch gedeckt an, legt die Resolution anlassunabhängig allgemeine Staatenpflichten fest, wie sie sonst allenfalls durch einen völkerrechtlichen Vertrag auf konsensualer Basis vereinbart werden könnten. Sieht man darin jedoch ein Handeln des Sicherheitsrates ultra vires (= außerhalb seiner Kompetenzen oder Befugnisse), ist die Resolution nicht gemäß Art. 25 UNCh verbindlich.[142]
157
Damit sind die Grenzen der Sicherheitsratsbefugnisse angesprochen. Eine immanente Grenze errichtet, wie soeben gesehen, die Kompetenzordnung der UNCh: Der Sicherheitsrat ist ein chartabasiertes Organ, das nicht über die Charta hinaus tätig werden kann. Auch für den Sicherheitsrat gilt ferner gemäß Art. 2 Nr. 7 UNCh das Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten, soweit er nicht unter Kapitel VII tätig wird. Im Rahmen von Kapitel VII stehen ihm weitreichende Spielräume zu, die Lage einzuschätzen und die ihm geeignet erscheinenden Maßnahmen zu bestimmen. Hinsichtlich der Rechtsbindungen von Kapitel-VII-Maßnahmen jedoch besteht Streit. In der angelsächsischen Literatur wird oftmals der politische Charakter des Sicherheitsrates betont, der sich rechtlichen Maßstäben entziehe. In der Konsequenz soll der Sicherheitsrat frei sein zu entscheiden, wann eine Friedensbedrohung nach Art. 39 UNCh vorliegt, und ohne besondere Voraussetzungen selbst militärisch in einen Mitgliedstaat intervenieren können; er soll keinen menschenrechtlichen Bindungen unterliegen und auch die UN-Mitgliedstaaten von der Pflicht zur Beachtung von Menschenrechten befreien können; er soll keinerlei externer Kontrolle unterstehen. Zutreffender Ansicht nach ist der Sicherheitsrat jedoch nicht „legibus solutus“ („vom Recht befreit“).[143] Bei der Frage, wann welche Maßnahmen unter Kapitel VII zu ergreifen sind, wird man – außer in Fällen eklatanten Missbrauchs (vor dem v. a. die Vetorechte schützen dürften) – kaum greifbare rechtliche Maßstäbe finden können. An die Menschenrechte ist aber auch der Sicherheitsrat gebunden. Obgleich die Vereinten Nationen nicht Vertragspartei von Menschenrechtsabkommen sind, bekennen sie sich doch in Art. 1 und 55 f UNCh zu den Menschenrechten und nennen diese als ein Ziel der Arbeit der UNO. Eine Selbstbindung der Organisation, die alle Organe erfasst, dürfte insbesondere auch durch die AEMR eingetreten sein. Von den Staaten die Beachtung der Menschenrechte einzufordern, selbst aber zu deren Missachtung berechtigt zu sein, würde die Vereinten Nationen in einen unerträglichen Selbstwiderspruch verwickeln. Auch der Sicherheitsrat hat daher die gewohnheitsrechtlich geltenden Menschenrechte zu achten; eine inhaltliche Orientierung mögen die unter der Ägide der Vereinten Nationen entstandenen Abkommen bieten, v. a. der IPBPR und der IPWSKR. Ebenso wenig sind die Rechtsbindungen des Sicherheitsrates der gerichtlichen Kontrolle entzogen. Der IGH hat im Lockerbie-Fall zu Recht angedeutet, dass er aus Anlass eines konkreten Falls das Recht hat, Resolutionen des Sicherheitsrates zu überprüfen; dies folgt aus der materiellen Rechtsbindung des Sicherheitsrates und der Befugnis des IGH, ihm unterbreitete Rechtsfälle am Maßstab des Völkerrechts zu messen.[144] Mittelbar können Maßnahmen des Sicherheitsrates auch der Kontrolle durch staatliche oder regionale Gerichte (wie den EGMR oder den EuGH) unterliegen (Rn. 628–630).
158
Fall: Lockerbie (IGH 1992)[145]
Am 21.12.1988 explodierte über der schottischen Ortschaft Lockerbie ein Flugzeug der US-amerikanischen Fluggesellschaft „Pan Am“ infolge eines Bombenattentats. Die USA und Großbritannien ermittelten als Attentäter zwei mutmaßliche Angehörige des libyschen Geheimdienstes und verlangten von Libyen deren Auslieferung auf Grundlage des Montrealer Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt von 1971. Libyen lehnte die Auslieferung ab und berief sich darauf, dass es nach dem Übereinkommen berechtigt sei, gegen die beiden Tatverdächtigen auch selbst zu ermitteln. Mit der Resolution 731 (1992) forderte der UN-Sicherheitsrat Libyen dennoch zur Auslieferung auf (die Rechtsgrundlage blieb unklar). Als Libyen im März 1992 Klage beim IGH gegen das Auslieferungsverlangen erhob und den Erlass einstweiliger Maßnahmen beantragte, beschloss der Sicherheitsrat erneut – diesmal gestützt auf Kapitel VII UNCh – die Auslieferung der mutmaßlichen Attentäter (Resolution 748 [1992]).
Der IGH lehnte den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab und begründete dies mit dem Vorrang von Resolutionen nach Kapitel VII (Resolution 748) vor dem Montrealer Übereinkommen, vgl. Art. 102 UNCh. Indem der Gerichtshof in einer Sache entschied, in die sich der Sicherheitsrat bereits eingeschaltet hatte, machte er implizit deutlich, dass er zu einer Kontrolle des Sicherheitsrates berechtigt ist. Sondervoten einzelner Richter unterstrichen diesen Anspruch. Das Verfahren wurde in der Hauptsache nicht mehr entschieden. Auf Grundlage eines Kompromisses fand der Prozess schließlich vor einem schottischen Gericht auf dem Staatsgebiet der Niederlande statt und endete mit einer Verurteilung und einem Freispruch. Libyen zahlte eine Entschädigung an die Hinterbliebenen.