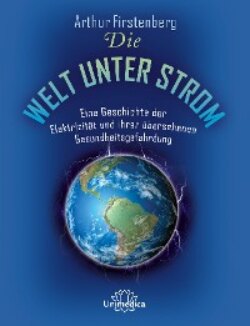Читать книгу Die Welt unter Strom - Arthur Firstenberg - Страница 18
KAPITEL 5 Chronisch krank durch Elektrizität
ОглавлениеIm Jahr 1859 machte die Stadt London eine erstaunliche Metamorphose durch. Die Straßen, Geschäfte und Wohndächer seiner zweieinhalb Millionen Einwohner wurden plötzlich an ein unübersehbares Gewirr von Elektrokabeln angeschlossen. Lassen wir einen der berühmtesten englischen Schriftsteller, der Augenzeuge war, die Geschichte einleiten:
„Vor ungefähr zwölf Jahren“, schrieb Charles Dickens, „nachdem es in den Tavernen üblich wurde, Bier und belegte Brote zu einem Festpreis anzubieten, führte der Besitzer eines kleinen Vorstadthauses diese Gewohnheit ad absurdum. Er bot nämlich ein Glas Bier und einen elektrischen Schlag für vier Pence an. Dass er mit dieser Kombination aus Wissenschaft und Getränk Geschäfte machen wollte, war natürlich mehr als fraglich. Als Wirtschaftsbesitzer war das Hauptziel seines ungewöhnlichen, wenn auch humorvollen Scharfsinns wohl, sein Geschäft anzukurbeln. Was immer auch der Grund für seinen etwas bizarren Unternehmergeist gewesen sein mag, es ist auf jeden Fall festzuhalten, dass der Wirt seiner Zeit weit voraus war.
Er war sich wahrscheinlich nicht einmal bewusst, dass sich seine ungewöhnliche Art, Geschäfte zu führen, innerhalb weniger Jahre zu einer ernsthaften Wissenschaft entwickeln würde. Waghalsige Possenreißer gehen ja oft humorvoll mit einem Thema um, von dem sie eigentlich nichts verstehen. Wir sind beispielsweise noch nicht so weit, dass die Leser von Bischof Wilkins berühmtem Diskurs über die Luftfahrt selbst zum Mond fliegen können. Aber die Stunde ist nahe, in der die erfindungsreiche Bekanntmachung des Bierladenbesitzers als selbstverständlich und ganz normal angesehen werden wird. Ein Glas Bier und ein elektrischer Schlag werden tatsächlich in Kürze für vier Pence verkauft werden – und der wissenschaftliche Teil des Geschäftes wird von größerem Nutzen sein als eine bloße Reizung der menschlichen Nerven. Hier geht es nämlich um einen elektrischen Schlag, der eine Nachricht durch ein Drahtgeflecht über die Hausdächer an eine der 120 Bezirkstelegrafenstationen senden wird, die zwischen den Ladenbesitzern in der ganzen Stadt verteilt werden sollen.
Die fleißigen Spinnen haben sich längst zu einer Handelsfirma namens London District Telegraph Company (Limited) zusammengeschlossen und ihr Handelsnetz lautlos, aber effektiv, gesponnen. Rund 250 Kilometer Draht sind jetzt entlang Brüstungen, durch Bäume, über Mansarden, um Schornsteinaufsätze und quer über Straßen auf der Südseite des Flusses angebracht. Die noch ausstehenden 190 Kilometer Draht auf der Nordseite werden bald in gleicher Weise gespannt. Die Arbeit geht immer schneller voran. Außerdem ist selbst der starrköpfigste Engländer bereit, das Dach seiner sprichwörtlichen Burg im Interesse der Wissenschaft und des Gemeinwohls aufzugeben, wenn er sieht, dass seine Nachbarn zu Hunderten hier bereits den Weg gewiesen haben.“
Die englischen Bürger begrüßten nicht unbedingt die Aussicht, dass elektrische Leitungen an ihren Häusern angebracht werden sollten. „Der britische Hausbesitzer hat noch nie eine voltaische Batterie eine Kuh töten sehen“, schrieb Dickens, „aber er hat gehört, dass so ein Kraftakt durchaus möglich sei. Der Telegraf wird in den meisten Fällen von einer starken voltaischen Batterie betrieben, und daher hält sich der britische Hausbesitzer, der generell Angst vor Blitzen hat, logischerweise von all diesen Maschinen fern.“ Laut Dickens gelang es Vertretern der London District Telegraph Company trotzdem, fast 3.500 Hausbesitzer zu überreden, ihre Dächer für die 450 Kilometer Draht zur Verfügung zu stellen. Ganz London war von ihnen übersät, und es sollte nun nicht mehr lange dauern, bis die Geschäfte von Lebensmittelhändlern, Apothekern und Wirten in der ganzen Stadt an das Netz angeschlossen wurden.1
Ein Jahr später, als die Universal Private Telegraph Company ihre Türen öffnete, wurde das Stromnetz über den Häusern von London noch dichter gewebt. Im Gegensatz zur ersten Firma, deren Stationen nur öffentliche Dienstleistungsunternehmen akzeptierten, vermietete Universal Telegrafenanlagen an Unternehmen und Einzelpersonen für den Privatgebrauch. Kabel mit jeweils bis zu 100 Drähten bildeten das Rückgrat des Systems. Jeder Draht verließ dabei das Gewirr der restlichen Drähte und zweigte sich ab, sobald er sich seinem Ziel näherte. Bis 1869 hatte diese zweite Firma mehr als 4.000 Kilometer Kabel und ein Vielfaches davon an Drähten über den Köpfen der Londoner gespannt und unter den Füßen verlegt.1.500 Abonnenten, verstreut über die die ganze Stadt, waren somit versorgt.
Eine ähnliche Transformation fand mehr oder weniger überall auf der Welt statt. Die Tragweite der Geschwindigkeit und der Intensität jedoch, mit der dies geschah, wird heute nicht richtig eingeschätzt.
Die systematische Elektrifizierung Europas hatte 1839 mit der Eröffnung des magnetischen Telegrafen auf der Great Western Railway zwischen West Drayton und London begonnen. Die Elektrifizierung Amerikas begann einige Jahre später: Samuel Morse errichtete 1844 entlang der Eisenbahnstrecke Baltimore–Ohio die erste Telegrafenlinie zwischen Baltimore und Washington. Davor wurden jedoch bereits Häuser, Büros und Hotels mit elektrischen Türklingeln und Meldern ausgestattet. Das erste vollständige System wurde im Jahr 1829 im Tremont House in Boston installiert, in dem alle 170 Gästezimmer über elektrische Leitungen mit einem Glockensystem im Hauptbüro verbunden waren.
Elektrische Alarmanlagen waren 1847 in England und bald darauf in den Vereinigten Staaten und in Deutschland erhältlich.
Im Jahr 1850 wurden auf allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis, Telegrafenleitungen aufgebaut. Über 35.000 Kilometer Draht wurden in den Vereinigten Staaten unter Strom gesetzt; fast 6.500 Kilometer rückten in Indien vor, wo sich „Affen und Schwärme großer Vögel“ auf ihnen niederließen.“2 1.600 Kilometer Draht breiteten sich in drei Richtungen von Mexiko-Stadt aus. Bis 1860 waren Australien, Java, Singapur und Indien miteinander durch Seekabel verbunden. Bis 1875 wurden die ozeanischen Kommunikationsbarrieren durch fast 50.000 Kilometer Unterseekabel aufgehoben. Jetzt hatten die unermüdlichen „Netzweber“ schon ein Kupfernetz von 1,1 Millionen Kilometer Länge auf der Erde unter Strom gesetzt – genug Draht, um den Globus fast 30 Mal zu umwickeln.
Der Stromverkehr nahm noch stärker zu als die reine Anzahl der Drähte. Zunächst das Duplexing, dann das Quadriplexing und später auch das automatische Keying ermöglichten es, dass der Strom jederzeit fließen konnte, nicht nur beim Senden von Nachrichten. Jetzt konnten auch mehrere Nachrichten gleichzeitig über denselben Draht geschickt werden – und das mit immer schnellerer Geschwindigkeit.
Fast von Anfang an war die Elektrizität im Leben eines durchschnittlichen Stadtbewohners präsent. Der Telegraf war dabei von Anfang an mehr als nur eine nebensächliche Ergänzung zu den Eisenbahnen und Zeitungen. Bevor es Telefone gab, wurden Telegrafenmaschinen zuerst in Feuerwehr- und Polizeistationen, dann an Börsen und in den Büros von Kurierdiensten und bald auch in Hotels, Privatunternehmen und Privathaushalten installiert. Das erste kommunale Telegrafensystem in New York City wurde 1855 von Henry Bentley gebaut und verband 15 Büros in Manhattan und Brooklyn. Die 1867 gegründete Gold and Stock Telegraph Company lieferte telegrafisch und unverzüglich Hunderten von Abonnenten Preisnotierungen von den Aktien-, Gold- und anderen Börsen. Im Jahr 1869 wurde die American Printing Telegraph Company gegründet, um Unternehmen und Privatpersonen private Telegrafenleitungen zur Verfügung zu stellen. Die Manhattan Telegraph Company wurde zwei Jahre später in Konkurrenz dazu aufgebaut. Bis 1877 hatte die Gold and Stock Telegraph Company beide Unternehmen erworben und bediente fast 2.000 Kilometer Draht. Bis 1885 verbanden die Netze der fleißigen Spinnen fast 30.000 Häuser und Geschäfte miteinander. Diese Netze über New York waren noch komplexer als die in London, die Dickens beschrieben hatte.
Im Verlauf dieser Transformation schrieb der Sohn eines schmächtigen, etwas schwerhörigen Geistlichen die ersten klinischen Aufzeichnungen einer bisher unbekannten Krankheit, die er in seiner neurologischen Praxis in New York City beobachtete. Obgleich Dr. George Miller Beard sein Studium an der medizinischen Fakultät erst vor drei Jahren beendet hatte, wurde seine Arbeit dennoch im Jahr 1869 von dem renommierten wissenschaftlichen Magazin Boston Medical and Surgical Journal – später umbenannt in New England Journal of Medicine – angenommen und veröffentlicht.
Beard war ein selbstbewusster junger Mann, der eine Gelassenheit und einen versteckten, charismatischen Sinn für Humor besaß. Er war ein scharfer Beobachter, der schon zu Beginn seiner Karriere keine Angst hatte, medizinisches Neuland zu betreten. Obwohl er manchmal von erfahreneren Medizinern wegen seiner neuartigen Ideen verspottet wurde, sagte einer seiner Kollegen viele Jahre nach seinem Tod, dass Beard „nie ein unfreundliches Wort gegen irgendjemanden geäußert hat“.3 Neben dieser neuartigen Krankheit spezialisierte er sich auch auf die Elektro- und Hypnotherapie. Er hatte maßgeblich daran teil, dass der gute Ruf beider Disziplinen ein halbes Jahrhundert nach dem Tod von Mesmer wiederhergestellt wurde. Darüber hinaus trug Beard zur Erkenntnis der Ursachen und Behandlung von Heuschnupfen und der Seekrankheit bei. Und im Jahr 1875 untersuchte er gemeinsam mit Thomas Edison die von Edison entdeckte „Ätherkraft“, die sich durch die Luft übertrug und ohne einen Kabelstromkreis Funken in nahe gelegenen Objekten erzeugte. Beard hatte richtig vermutet – ein Jahrzehnt vor Hertz und zwei Jahrzehnte vor Marconi –, dass es sich hier um Hochfrequenzstrom handelte, der eines Tages die Telegrafie revolutionieren sollte.4
Dr. George Miller Beard (1839–1883)
Was die neuartige Krankheit betrifft, die er 1869 beschrieb, so erahnte Beard ihre Ursache nicht. Er nahm einfach an, es sei eine Krankheit der modernen Zivilisation, die durch Stress verursacht wurde und bisher selten aufgetreten war. Der Name, den er ihr gab, „Neurasthenie“, bedeutet lediglich „schwache Nerven“. Obwohl einige der Symptome anderen Krankheiten ähnelten, schien die Neurasthenie wahl- und grundlos zuzuschlagen. Es war auch nicht zu erwarten, dass jemand daran sterben würde. Auf keinen Fall verband Beard die Krankheit mit der Elektrizität; sie war sogar seine bevorzugte Behandlungsweise für Neurasthenie – sofern der Patient dies tolerieren konnte. Als er 1883 starb, war die Ursache für Neurasthenie zu jedermanns Enttäuschung immer noch nicht bekannt. Aber in weiten Teilen der Welt, in denen der Begriff „Neurasthenie“ bei Ärzten nach wie vor üblich ist – und das ist fast überall außerhalb der Vereinigten Staaten der Fall – wird die Elektrizität heute als eine der Ursachen dafür anerkannt. Und die Elektrifizierung der Welt war zweifellos dafür verantwortlich, dass die Krankheit in den 1860er-Jahren aus dem Nichts erschien und sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer Pandemie entwickeln sollte.
Heute ziehen sich Millionen-Volt-Stromleitungen durch die Landschaft, 12.000-Volt-Leitungen zerteilen die Wohngegenden und 30-Ampere-Leistungsschalter wachen über jedes Haus – da fällt es leicht zu vergessen, wie sehr diese Situation eigentlich wider die Natur ist. Keiner von uns kann sich vorstellen, wie es sich anfühlen würde, auf einer nicht verdrahteten Erde zu leben. Seit der Präsidentschaft von James Polk (Anm. d. Verlags: 1845–1849) haben unsere Zellen, die in dieser Hinsicht wie Marionetten an unsichtbaren Fäden hängen, keine Sekunde Pause von den elektrischen Vibrationen gehabt. Der allmähliche Spannungsanstieg in den letzten anderthalb Jahrhunderten war nur graduell. Die schlagartige Überwältigung der Nährböden der Erde in den ersten Jahrzehnten dieser ungezügelten technologischen Entwicklung, an der sich alle beteiligten, hatte auf die Natur und den Charakter des Lebens drastische Auswirkungen.
Zu Beginn errichteten Telegrafenfirmen auf dem Land und in Städten ihre Leitungen mit nur einem Draht, wobei die Erde selbst den Stromkreis vervollständigte. Keiner der Rückströme floss entlang eines Drahtes, wie dies heute in elektrischen Systemen der Fall ist, sondern sie bewegten sich auf unberechenbaren Pfaden durch den Erdboden.
Siebeneinhalb Meter hohe Holzmasten stützten die Drähte auf ihren Wegen zwischen den Ortschaften. In Städten, in denen mehrere Telegrafenfirmen um Kunden konkurrierten und Platz Mangelware war, verhedderte sich ein Gewirr aus oberirdischen Drähten zwischen Hausdächern, Kirchtürmen und Kaminen, die sie wie Kletterpflanzen umschlungen. Und von diesen Kletterpflanzen breiteten sich elektrische Felder aus, die die Straßen, Seitenwege und Räume der Häuser, die sie umwickelten, durchdrangen.
Die historischen Zahlen geben einen Hinweis darauf, was da eigentlich passiert ist. Laut Electric Telegraph, George Prescotts Buch von 1860 über den elektrischen Telegrafen, lieferte eine typische Batterie, die in den Vereinigten Staaten für eine Drahtlänge von 160 Kilometern verwendet wurde, ein elektrisches Potenzial von ungefähr 80 Volt. Das entsprach „einer 12-Liter-Grove-Batterie“ bzw. einer 12-Liter-Nasszellenbatterie oder einem Stapel von 50 Paaren Zink- und Platinplatten.5 In den frühesten Systemen floss der Strom nur, wenn der Telegrafist die Sendetaste drückte. Es wurden fünf Buchstaben pro Wort angesetzt, und im Morse-Alphabet galten durchschnittlich drei Punkte oder Striche pro Buchstabe. Wenn der Telegrafist kompetent war, konnten im Durchschnitt 30 Wörter pro Minute gesendet und die Taste im Takt von 7,5 Anschlägen pro Sekunde gedrückt werden. Das entspricht fast der Grundresonanzfrequenz (7,8 Hz) der Biosphäre, auf die alle Lebewesen abgestimmt sind und deren durchschnittliche Stärke in den Lehrbüchern mit etwa einem Drittel eines Millivolt pro Meter angegeben wird. Wir werden das in Kapitel 9 näher beleuchten. Basierend auf dieser einfachen Annahme lässt sich leicht berechnen, dass die elektrischen Felder, die von den frühesten Telegrafendrähten ausgestrahlt wurden, bei dieser Frequenz bis zu 30-mal stärker waren als das natürliche elektrische Feld der Erde. In Wirklichkeit erzeugten die schnellen Unterbrechungen bei der Telegrafenverschlüsselung auch eine breite Palette von Hochfrequenzoberwellen, die sich ebenfalls entlang der Drähte bewegten und durch die Luft strahlten.
Die Magnetfelder können ebenfalls geschätzt werden. Basierend auf den von Samuel Morse selbst angegebenen Werten für den elektrischen Widerstand von Drähten und Isolatoren6 variierte die Strommenge eines typischen Fernkabels je nach Länge der Leitung und den Wetterverhältnissen zwischen etwa 0,015 Ampere und 0,1 Ampere. Da die Isolierung nicht perfekt war, floss etwas Strom an jedem Telegrafenmast in die Erde ab. Dieser Fluss war bei Regen sogar noch stärker. Nun lässt sich unter Verwendung des veröffentlichten Wertes von 10-8 Gauß für das Magnetfeld der Erde bei 8 Hz eine interessante Rechnung durchführen: Bei dieser Frequenz überschießt das Magnetfeld eines einzelnen frühen Telegrafendrahts das natürliche Magnetfeld der Erde um drei bis zu fast 20 Kilometer auf beiden Seiten der Linie. Und da die Erde nicht überall gleichmäßig geformt ist, sondern unterirdische Wasserläufe, Eisenerzablagerungen und andere leitende Pfade verbirgt, über die der Rückstrom floss, war die Exposition der Bevölkerung gegenüber diesen neuen Feldern dementsprechend unterschiedlich.
In Städten hatte jeder Draht etwa 0,02 Ampere und die Exposition war universell. Die London District Telegraph Company zum Beispiel hatte gewöhnlich Bündel von zehn Drähten, und die Universal Private Telegraph Company von bis zu 100 Drähten, die über die Straßen und Dächer eines Großteils der Stadt gespannt wurden.
Obgleich sich die von London District benutzten Geräte und auch das Alphabet von denen in Amerika unterschieden, waren die Schwankungen der Stromstärken in den Drähten sehr ähnlich – etwa 7,2 Schwingungen pro Sekunde, wenn der Telegrafist 30 Wörter pro Minute übertrug.7 Und der Zeigertelegraf von Universal war eine handgekurbelte magneto-elektrische Maschine, die tatsächlich Wechselstrom durch die Drähte schickte.
Ein unternehmerischer Wissenschaftler, John Trowbridge, Professor für Physik an der Harvard University, beschloss, seinen eigenen Standpunkt auf die Probe zu stellen. Er war sich nämlich sicher, dass Signale, die über an beiden Enden geerdete Telegrafendrähte gesendet werden, von ihren vorbestimmten Pfaden abweichen und leicht an entfernten Orten erkannt werden können. Sein Testsignal kam von der Uhr am Harvard Observatory, die Zeitsignale etwas mehr als sechs Kilometer per Draht von Cambridge nach Boston übertrug. Der Empfänger war ein neu erfundenes Gerät – ein Telefon – das an einen 150 Meter langen Draht angeschlossen und an beiden Enden geerdet war. Trowbridge stellte fest, dass er durch einen solchen Anschluss an die Erde das Ticken der Observatoriumsuhr bis zu 600 Meter vom Observatorium entfernt deutlich hören konnte. Und das an verschiedenen Punkten, die nicht einmal in Richtung Boston lagen! Daraus folgerte er, dass die Erde massiv mit Streustrom verseucht war. Seine Berechnungen, so Trowbridge, zeigten ihm, dass Strom, der aus den Telegrafensystemen Nordamerikas stammte, sogar auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans nachweisbar sei. Eine Person an der Küste Frankreichs sollte in der Lage sein, ein Morse-Signal zu hören, das über einen an beiden Enden geerdeten Draht von Nova Scotia nach Florida gesendet wurde. Voraussetzung dafür war, schrieb er, dass das Signal ausreichend stark war und gemäß seiner Methode mit der Erde verbunden wurde.
Eine Reihe von Medizinhistorikern, die nicht sehr tief gegraben haben, behaupten, dass Neurasthenie keine neuartige Krankheit sei. Es hätte sich ja nichts geändert, und die High Society des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts litt in Wirklichkeit an einer Art Massenhysterie.8
Eine Liste berühmter amerikanischer Neurastheniker liest sich wie das Who is Who der Literatur, der Künste und der Politik dieser Zeit. Dazu gehörten Frank Lloyd Wright, William, Alice und Henry James, Charlotte Perkins Gilman, Henry Brooks Adams, Kate Chopin, Frank Norris, Edith Wharton, Jack London, Theodore Dreiser, Emma Goldman, George Santayana, Samuel Clemens, Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson und eine Vielzahl anderer bekannter Persönlichkeiten.
Historiker, die glauben, die Neurasthenie bereits in alten Lehrbüchern gefunden zu haben, sind durch Änderungen in der medizinischen Terminologie verwirrt worden. Genau diese Änderungen sind auch dafür verantwortlich, dass wir nicht wissen, was sich vor 150 Jahren auf unserer Erde abspielte. Zum Beispiel wurde der Begriff „nervös“ seit Jahrhunderten ohne die Freud‘schen Konnotationen verwendet. Im damaligen Sprachgebrauch bedeutete es einfach „neurologisch“. George Cheyne verwendete in seinem Buch The English Malady von 1733 den Begriff „Nervenstörung“ für Epilepsie, Lähmungen, Zittern, Krämpfe, Kontraktionen, Sensibilitätsverlust, geschwächten Intellekt, Komplikationen bei Malaria und Alkoholismus. Robert Whytts Abhandlung von 1764 über „nervöse Störungen“ ist ein klassisches Werk zur Neurologie. Wenn Gicht, Tetanus, Hydrophobie und Formen von Blind- und Taubheit als „nervöse Störungen“ bezeichnet werden, mutet das zunächst etwas verwirrend an. Aber wenn man in Betracht zieht, dass in der klinischen Medizin der Begriff „neurologisch“ erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Ausdruck „nervös“ ersetzte, wird alles verständlich. Die damalige „Neurologie“ bedeutet heute „Neuroanatomie“.
Eine weitere Quelle der Verwirrung für heutige Leser ist die alte Verwendung der Begriffe „hysterisch“ und „hypochondrisch“ zur Beschreibung neurologischer Zustände des Körpers, nicht des Geistes. Die „Hypochondrien“ bezeichneten die Bauchregionen und „Hystera“ bedeuteten auf Griechisch die Gebärmutter. Wie Whytt in seiner Abhandlung erklärte, waren hysterische und hypochondrische Störungen jene neurologischen Erkrankungen, von denen angenommen wurde, dass sie ihren Ursprung in den inneren Organen haben, wobei „hysterisch“ traditionell bei Frauenkrankheiten und „hypochondrisch“ bei Männern angewendet wurde. Wenn Magen, Darm und Verdauung betroffen waren, wurde die Krankheit je nach Geschlecht des Patienten als hypochondrisch oder hysterisch bezeichnet. Wenn der Patient Anfälle, Ohnmachten, Zittern oder Herzklopfen hatte, die inneren Organe jedoch nicht betroffen waren, wurde die Krankheit einfach als „nervös“ bezeichnet.
Die drakonischen Behandlungen, die bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die übliche medizinische Praxis waren und selbst oft schwerwiegende neurologische Probleme verursachten, verwirrten die Sachlage noch mehr. Diese basierten auf der Viersäfte- oder Humorallehre der Medizin, die Hippokrates im 5. Jahrhundert v. Chr. aufgestellt hatte. Er postulierte, dass jede Krankheit durch ein Ungleichgewicht der „Säfte“ – wobei die vier Körpersäfte Weißschleim, Gelbgalle, Schwarzgalle und Blut sind – verursacht wurde. Demzufolge war das Ziel der medizinischen Behandlung, den defizienten Körpersaft aufzubauen und diejenigen, die im Übermaß vorhanden waren, abzuleiten. Daher wurden alle größeren und kleineren medizinischen Beschwerden durch eine Kombination aus Entschlackung, Erbrechen, Schwitzen, Aderlass, Medikamenten und Diätvorschriften behandelt. Es bestand allerdings die Gefahr, dass die verschriebenen Medikamente neurotoxisch waren, da sie häufig schwermetallhaltige Präparate wie Antimon, Blei und Quecksilber enthielten.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellten einige Ärzte die Humorallehre infrage, aber der Begriff „Neurologie“ hatte seine moderne Bedeutung noch nicht erlangt. Die Erkenntnis, dass viele Krankheiten immer noch als „hysterisch“ und „hypochondrisch“ bezeichnet wurden, auch wenn die Gebärmutter oder inneren Organe nicht betroffen waren, führte eine Reihe von Ärzten dazu, neue Namen für Erkrankungen des Nervensystems zu etablieren. Im 18. Jahrhundert gehörten Krämpfe, Zuckungen, Erbrechen und Schwindelgefühl zu Pierre Pommes „dampfförmigen Zuständen“. Einige dieser Patienten litten an einer Blasenentleerungsstörung, Blutspucken, Fieber, Pocken, Schlaganfällen und anderen Krankheiten, die sie in manchen Fällen das Leben kosteten. Häufig war nicht einmal die Krankheit selbst, sondern der oft dafür verschriebene Aderlass die Todesursache. Thomas Trotters Buch A View of the Nervous Temperament aus dem Jahr 1807 nahm Bezug auf Fälle von Wurmbefall, Chorea, Zittern, Gicht, Anämie, Menstruationsstörungen, Schwermetallvergiftungen, Fieber und Krämpfen, die zum Tod führten. Später verwendete eine Reihe französischer Ärzte spekulativ Begriffe wie „Polyneuropathie“, „nervöse Übererregbarkeit“ und „der nervöse Zustand“. Claude Sandras Traité Pratique des Maladies Nerveuses von 1851 ist ein konventionelles Lehrbuch über die Neurologie. Eugène Bouchuts Buch über „l’état nervux“ („der nervöse Zustand“) aus dem Jahr 1860 enthielt viele Fallbeispiele von Patienten, die unter den Auswirkungen von Aderlass, tertiärer Syphilis, Typhus, Fehlgeburten, Anämie, Paraplegie und anderen akuten und chronischen Erkrankungen aufgrund von bekannten Ursachen litten – einige davon verliefen tödlich. Beards Neurasthenie ist jedoch nirgends zu finden.
Tatsächlich ist die erste Beschreibung der Krankheit, auf die Beard die Aufmerksamkeit der Welt gelenkt hatte, in Austin Flints Lehrbuch für Medizin zu finden, das 1866 in New York veröffentlicht wurde. Als Professor am Bellevue Hospital Medical College widmete Flint ihr zwei kurze Seiten und gab ihr fast den gleichen Namen, der durch Beard drei Jahre später bekannt werden sollte. Patienten mit „nervöser Asthenie“, wie er es nannte, „klagen über Trägheit, Mattigkeit, Antriebsschwäche, Schmerzen in den Gliedmaßen und psychische Depressionen. Sie können nachts nicht schlafen und beginnen ihr Tagewerk mit einem Gefühl der Müdigkeit“.9 Diese Patienten litten nicht an Anämie und hatten keinerlei andere Anzeichen einer organischen Erkrankung. Sie starben auch nicht an ihrer Krankheit; im Gegenteil, wie Beard und andere später ebenfalls bemerkten, schienen sie vor alltäglichen, akuten Krankheiten geschützt zu sein und lebten im Durchschnitt länger als andere.
Diese ersten Veröffentlichungen setzten eine Lawine in Gang. „Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde mehr über Neurasthenie geschrieben“, schrieb Georges Gilles de la Tourette 1889, „als beispielsweise über Epilepsie oder Hysterie im gesamten letzten Jahrhundert.“10
Die beste Weise, den Leser mit der Krankheit und ihrer Ursache vertraut zu machen, ist es, eine prominente New Yorker Ärztin vorzustellen, die selbst daran litt. Als die Ärztin über ihren Zustand berichtete, hatte die amerikanische Ärzteschaft schon seit fast einem halben Jahrhundert erfolglos versucht, die Ursache für Neurasthenie zu finden, und war schließlich zu dem Schluss gekommen, dass die Krankheit psychosomatisch war.
Dr. Margaret Abigail Cleaves (1848–1917)
Die in Wisconsin geborene Dr. Margaret Abigail Cleaves hatte 1879 ihr Medizinstudium abgeschlossen. Sie arbeitete zunächst im staatlichen Krankenhaus für Geisteskranke in Mt. Pleasant in Iowa. Von 1880 bis 1883 war sie Chefärztin für Patientinnen des Pennsylvania State Lunatic Hospital. Im Jahr 1890 zog sie in die Großstadt, wo sie eine Privatpraxis für Gynäkologie und Psychiatrie eröffnete. Erst 1894, im Alter von 46 Jahren, wurde bei ihr Neurasthenie diagnostiziert. Neu war in ihrem Fall ihre starke Exposition gegenüber Elektrizität: Sie hatte begonnen, sich auf Elektrotherapie zu spezialisieren. Dann eröffnete sie 1895 eine elektrotherapeutische Klinik mit Labor und Apotheke, die New York Electro-Therapeutic Clinic, Laboratory und Dispensary. Innerhalb von ein paar Monaten erlitt sie, was sie selbst als ihren „vollständigen Zusammenbruch“ beschrieb.
Die Details, die im Laufe der Zeit in ihrer Autobiography of a Neurasthene niedergeschrieben wurden, erläutern das klassische Syndrom, das Beard fast ein halbes Jahrhundert zuvor dargelegt hatte. „Ich fand Tag und Nacht weder Frieden noch Trost“, schrieb sie. „Allerdings verblieben die gewöhnlichen Schmerzen von Nervenstämmen oder peripheren Nervenenden, die hohe Körperempfindlichkeit, die Unfähigkeit, eine Berührung zu ertragen, die stärker ist als das Gestreiftwerden durch einen Schmetterlingsflügel, die Schlaflosigkeit, der Mangel an Kraft, die wiederkehrende Depression des Geistes, die Unfähigkeit, mein Gehirn beim Lernen und Schreiben so einzusetzen, wie ich es wünschte.“
„Es bereitete mir sogar die größten Schwierigkeiten“, schrieb sie bei einer anderen Gelegenheit, „Messer und Gabel am Tisch zu benutzen, wobei das einfache Zerschneiden praktisch unmöglich war.“
Cleaves litt an chronischer Müdigkeit, schlechter Verdauung, Kopfschmerzen, Herzklopfen und Tinnitus. Sie fand den Stadtlärm unerträglich. Sie roch und schmeckte „Phosphor“. Sie wurde so sonnenempfindlich, dass sie in dunklen Räumen lebte und nur nachts ins Freie gehen konnte. Sie verlor allmählich ihr Hörvermögen auf einem Ohr. Der Einfluss atmosphärischer Elektrizität war so groß auf sie, dass sie aufgrund ihres Ischias, ihrer Gesichtsschmerzen, ihrer intensiven Unruhe, ihres Angstgefühls und des Eindrucks „eines erdrückenden Gewichts, das mich zur Erde beugt“, mit Sicherheit eine Wetterveränderung 24 bis 72 Stunden im Voraus vorhersagen konnte. „Unter dem Einfluss aufkommender elektrischer Stürme“, schrieb sie, „funktioniert mein Gehirn nicht.“11
Und doch widmete sie sich durchgehend bis zum Ende ihres Lebens ihrem Beruf und setzte sich Tag für Tag der Elektrizität und Strahlung in ihren verschiedenen Formen aus. Sie war ein Gründungsmitglied und eine sehr aktive Mitarbeiterin der American Electro-Therapeutic Association. Ihr Lehrbuch über Lichtenergie gab Anleitung zur therapeutischen Verwendung von Sonnenlicht, Bogenlicht, Glühlicht, fluoreszierendem Licht, Röntgenstrahlen und radioaktiven Elementen. Und sie war die erste Ärztin, die Radium zur Behandlung von Krebs verwendete.
Wie konnte sie es nicht gewusst haben? Und doch war das durchaus erklärlich. Damals wie heute verursacht die Elektrizität keine eigentliche Krankheit, und die Ursache der Neurasthenie – so hatte man endgültig entschieden – war im Geist und in den Emotionen zu finden.
Andere verwandte Krankheiten wurden im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert beschrieben. Hier handelte es sich um Berufskrankheiten bei Personen, die in der Nähe von Elektrizität arbeiteten. Der „Telegrafistenkrampf“ zum Beispiel, der von den Franzosen spezifischer „mal télégraphique“ („telegrafische Krankheit“) genannt wurde, weil seine Auswirkungen nicht nur auf die Handmuskeln des Telegrafisten beschränkt waren. Ernest Onimus beschrieb die Krankheit in Paris in den 1870er-Jahren. Diese Patienten litten an Herzklopfen, Schwindel, Schlaflosigkeit, geschwächtem Sehvermögen und dem Gefühl, „als würde ihr Hinterkopf in eine Schraubzwinge genommen“. Sie litten unter Erschöpfung, Depressionen und Gedächtnisverlust, und nach ein paar Jahren Arbeit verfielen einige dem Wahnsinn. Dr. E. Cronbach gab im Jahr 1903 in Berlin Fallbeispiele für 17 seiner Patienten, die Telegrafisten waren. Sechs litten entweder an übermäßigem Schwitzen oder extremer Trockenheit an Händen, Füßen oder Körper. Fünf andere klagten über Schlaflosigkeit. Bei fünf weiteren verschlechterte sich das Sehvermögen und wiederum fünf andere litten an einer zittrigen Zunge. Vier hatten ein gewisses Maß an Gehörverlust, drei einen unregelmäßigen Herzschlag und zehn waren sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause nervös und gereizt. „Unsere Nerven sind kaputt“, schrieb ein anonymer Telegrafenarbeiter 1905, „und das Gefühl robuster Gesundheit ist einer kränklichen Schwäche, einer mentalen Depression, einer bleiernen Erschöpfung gewichen … Wir hängen immer zwischen Krankheit und Gesundheit und sind nicht mehr ganze, sondern nur noch halbe Menschen. Obwohl wir jung sind, fühlen wir uns bereits wie abgenutzte alte Leute, für die das Leben zur Last geworden ist … unsere Kraft ist vorzeitig erschöpft, unsere Sinne und unser Gedächtnis getrübt, unser Enthusiasmus gedrosselt.“ Diese Menschen wussten, was die Ursache ihrer Krankheit war. „Hat das Erwecken der elektrischen Energie aus ihrem Schlummer“, so fragte der anonyme Arbeiter, „eine Gefahr für die Gesundheit der Menschheit geschaffen?“12 Im Jahr 1882 nahm Edmund Robinson bei seinen Telegrafistenpatienten vom General Post Office in Leeds etwas Ähnliches wahr. Denn als er vorschlug, sie mit Elektrizität zu behandeln, „lehnten sie eine Behandlung dieser Art rigoros ab“.
Schon lange vor diesem Ereignis hätte eine Anekdote von Dickens als Warnung dienen können. Er hatte das St. Luke’s Hospital for Lunatics, eine Anstalt für Geisteskranke, besucht. „Wir kamen an einem Mann mit Gehörlosigkeit vorbei“, schrieb er, „der jetzt von unheilbarem Wahnsinn geplagt ist.“ Dickens fragte, was die Beschäftigung des Manns gewesen sei. „Ja“, sagt Dr. Sutherland, „das ist das Bemerkenswerteste dabei, Mr. Dickens. Seine Aufgabe war die Übermittlung von elektrischen Telegrafennachrichten“. Man schrieb den 15. Januar 1858.13
Auch Telefonisten erlitten häufig bleibende Gesundheitsschäden. Ernst Beyer schrieb, dass von 35 Telefonisten, die er während eines Zeitraums von fünf Jahren behandelt hatte, keine einzige Person zur Arbeit zurückkehren konnte. Hermann Engel hatte 119 solcher Patienten. P. Bernhardt hatte über 200. Deutsche Ärzte haben diese Krankheit gewohnheitsgemäß der Elektrizität zugeschrieben. Und nachdem Karl Schilling Dutzende solcher Publikationen überprüft hatte, veröffentlichte er 1915 eine klinische Beschreibung der Diagnose, Prognose und Behandlung von Krankheiten, die durch chronische Exposition gegenüber Elektrizität verursacht wurden. Diese Patienten hatten typischerweise Kopfschmerzen und Schwindelgefühle, Tinnitus und bewegliche Flecken in den Augen, die das Sichtfeld beeinträchtigten, einen rasenden Puls, Schmerzen im Bereich des Herzens und Herzklopfen. Sie fühlten sich schwach und erschöpft und konnten sich nicht konzentrieren. Sie konnten nicht schlafen. Sie waren depressiv und hatten Panikattacken. Sie zitterten. Ihre Reflexe waren erhöht und ihre Sinne hyperakut. Manchmal war ihre Schilddrüse hyperaktiv. Gelegentlich, nach langer Krankheit, war ihr Herz vergrößert. Ähnliche Beschreibungen kamen im Laufe des 20. Jahrhunderts von Ärzten aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Österreich, Italien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Kanada.14 Im Jahr 1956 berichteten Louis Le Guillant und seine Kollegen, dass es in Paris „keinen einzigen Telefonisten gibt, der diese nervöse Müdigkeit nicht mehr oder weniger stark verspürt. Sie beschrieben Patienten mit Erinnerungslücken, die weder ein Gespräch führen noch ein Buch lesen konnten, die ohne Grund mit ihren Männern stritten und ihre Kinder anschrien, die Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Druck auf der Brust, Ohrengeräusche, Sehstörungen und Gewichtsverlust hatten. Ein Drittel ihrer Patienten war depressiv oder selbstmörderisch, fast alle litten an Angstzuständen und über die Hälfte an Schlafstörungen.
Noch im Jahr 1989 berichtete Annalee Yassi von weitverbreiteten „psychogenen Erkrankungen“ bei Telefonisten in Winnipeg, Manitoba und St. Catharines in Ontario. In Montreal teilte Bell Canada mit, dass 47 Prozent der Vermittlungsmitarbeiter in Verbindung mit der Arbeit über Kopfschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen klagten.
Dann gab es das „Eisenbahnrückgrat“, eine falsch benannte Krankheit, die bereits 1862 von einer Kommission untersucht wurde, die von der britischen medizinischen Fachzeitschrift Lancet berufen wurde. Laut der Kommissionsmitglieder waren Vibrationen, Lärm, Fahrgeschwindigkeit, schlechte Luft und pure Angst an der Krankheit schuld. Alle diese Faktoren waren vorhanden und trugen zweifellos ihren Anteil dazu bei. Allerdings gab es noch etwas anderes, das sie nicht berücksichtigten. Denn bis 1862 verlief jede Eisenbahnstrecke zwischen einer oder mehreren Telegrafenleitungen über ihr. Der Rückstrom aus diesen Drähten schoss nach unten, und ein Teil dieses Stroms floss entlang der Metallschienen, auf denen die die Passagierwaggons rollten. Fahrgäste und Zugpersonal litten häufig unter denselben Beschwerden, über die später Telegrafisten und Telefonisten berichteten: Müdigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, chronisches Schwindelgefühl, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Tinnitus, Schwäche und Taubheit. Sie litten an schnellem Herzschlag, unregelmäßigem Puls, Gesichtsrötung, Schmerzen in der Brust, Depressionen und sexueller Dysfunktion. Einige wurden stark übergewichtig. Manche bluteten aus der Nase oder spuckten Blut. In ihren Augen verspürten sie einen „ziehenden“ Schmerz, als würden sie tief in ihre Sockel gesogen. Ihr Sehvermögen und ihr Gehör verschlechterten sich und einige wurden sogar allmählich gelähmt. Ein Jahrzehnt später wurde bei ihnen Neurasthenie diagnostiziert – so wie es später bei vielen Eisenbahnangestellten der Fall war.
Die Beobachtungen von Beard und der medizinischen Gemeinschaft des späten 19. Jahrhunderts über Neurasthenie, die am meisten ins Auge springen, sind folgende:
Sie breitete sich entlang der Eisenbahnstrecken und Telegrafenlinien aus.
Sie betraf sowohl Männer als auch Frauen, Reiche und Arme, Intellektuelle und Bauern.
Die Betroffenen waren oft wetterempfindlich.
Sie ähnelte manchmal der Erkältung oder Influenza.
Sie kam gehäuft in Familien vor.
Sie griff am häufigsten Menschen in der Blütezeit ihres Lebens an: Menschen im Alter von 15 bis 45 Jahren nach Beard, von 15 bis 50 Jahren nach Cleaves, von 20 bis 40 Jahren nach H. E. Desrosiers,15 von 20 bis 50 Jahren nach Charles Dana.
Sie senkte die Toleranz gegenüber Alkohol und Medikamenten.
Sie machte die Menschen anfälliger für Allergien und Diabetes.
Neurastheniker lebten im Durchschnitt länger als andere Menschen.
Und manchmal – ein Zeichen, dessen Bedeutung in Kapitel 10 erörtert wird – war der Urin der an Neurasthenie Leidenden rötlich oder dunkelbraun.
Schließlich entdeckte der deutsche Arzt Rudolf Arndt die Verbindung zwischen Neurasthenie und Elektrizität. Seine Patienten, die Elektrizität nicht tolerieren konnten, faszinierten ihn. „Selbst den schwächsten galvanischen Strom“, schrieb er, „so schwach, dass er die Nadel eines Galvanometers kaum bewegte und von anderen Menschen nicht im Geringsten wahrgenommen wurde, empfanden sie als höchst unangenehm.“ Er schlug 1885 vor, dass „Elektrosensibilität charakteristisch für hochgradige Neurasthenie ist“. Er prophezeite auch, dass die Elektrosensibilität „nicht unwesentlich zur Aufklärung von Phänomenen beitragen kann, die jetzt noch rätselhaft und unerklärlich erscheinen“.
Er schrieb dies inmitten einer intensiven, unerbittlichen Eile, die ganze Welt verdrahten zu wollen, angetrieben von einer Akzeptanz – ja, sogar einer Art Verherrlichung – der Elektrizität, die diese nicht infrage stellte. Er schrieb, als wüsste er, dass er damit seinen Ruf aufs Spiel setzen würde. Seiner Meinung nach scheiterte das sachgerechte Studium der Neurasthenie zum Großteil daran, dass Menschen, die weniger empfindlich auf Elektrizität reagierten, ihre Auswirkungen überhaupt nicht ernst nahmen: Stattdessen verbannten sie diese in das Reich des Aberglaubens und warfen somit „die Hellseherei, vermischt mit Gedankenlesen und Medialität, in einen Topf“.16
Diesem Hemmschuh für den Fortschritt begegnen wir sogar heute noch.