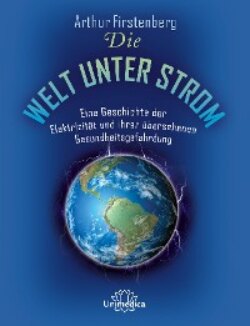Читать книгу Die Welt unter Strom - Arthur Firstenberg - Страница 9
KAPITEL 1 In einer Flasche eingefangen
ОглавлениеDas Leidener Experiment war eine Idee mit immenser und weitreichender Auswirkung: Überall wurde man gefragt, ob man die Effekte des Experiments schon erlebt hätte. Es war das Jahr 1746. Der Ort eine beliebige Stadt in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Italien. Ein paar Jahre später auch in Amerika. Die Elektrizität war eingetroffen und wie bei einem Wunderkind, das sein Debüt gab, stellte sich die ganze westliche Welt ein, um sich ihre Aufführung anzusehen.
Ihre Hebammen – Kleist, Cunaeus, Allamand und Musschenbroek – warnten, sie hätten geholfen, ein Enfant terrible zur Welt zu bringen, dessen Schläge den Menschen den Atem rauben, ihr Blut kochen und sie lähmen könnte. Die Öffentlichkeit hätte besser zuhören und vorsichtiger sein sollen. Aber wie man sich denken kann, ermutigten die farbenfrohen Berichte dieser Wissenschaftler die Menschenmengen nur noch mehr.
Pieter van Musschenbroek, Professor für Physik an der Universität Leiden, hatte seine übliche Reibungsmaschine benutzt. Diese bestand aus einer Glaskugel, die er schnell um ihre Achse drehte, während er sie mit den Händen rieb, um das „elektrische Fluidum“ zu erzeugen, das wir heute als statische Elektrizität kennen. Ein eiserner Gewehrlauf, der den Globus fast berührte, hing an Seidenschnüren von der Decke. Er wurde als „Hauptleiter“ bezeichnet und normalerweise dazu verwendet, Funken statischer Elektrizität aus der geriebenen, rotierenden Glaskugel zu erzeugen.
In jenen frühen Tagen war die Elektrizität jedoch nur von begrenztem Nutzen, da sie immer vor Ort produziert werden musste und es keine Möglichkeit gab, sie zu speichern. Also dachten sich Musschenbroek und seine Mitarbeiter ein geniales Experiment aus – ein Experiment, das die Welt für immer verändern sollte: Sie befestigten einen Draht am anderen Ende des Hauptleiters und steckten ihn in eine kleine Glasflasche, die teilweise mit Wasser gefüllt war. Sie wollten sehen, ob das elektrische Fluidum in einem Glas gespeichert werden konnte. Und der Versuch übertraf ihre kühnsten Erwartungen.
„Ich werde Ihnen von einem neuen, aber schrecklichen Experiment erzählen“, schrieb Musschenbroek an einen Freund in Paris, „von dem ich Euch rate, es nie selber auszuprobieren, noch würde ich, der dies einmal durch Gottes Gnade er- und überlebt habe, es für alles Geld der Welt nochmals durchführen.“ Er hielt die Flasche in der rechten Hand und versuchte mit der anderen, Funken aus dem Gewehrlauf zu erzeugen. „Plötzlich wurde meine rechte Hand mit solcher Kraft getroffen, dass mein ganzer Körper zitterte, als wäre er vom Blitz getroffen. Obwohl das Glas dünn war, zerbrach es nicht. Meine Hand wurde zwar nicht abgerissen, aber mein Arm und mein ganzer Körper waren sehr viel schlimmer betroffen, als ich es in Worte fassen kann. Kurzum, ich dachte, das sei mein Ende.“1 Als sein Kompagnon in Sachen Erfindungen, der Biologe Jean Nicolas Sébastien Allamand, das Experiment durchführte, spürte er einen „gewaltigen Schlag“. „Ich war so fassungslos“, sagte er, „dass ich für einige Momente nicht atmen konnte.“ Aufgrund der Stärke des Schmerzes an seinem rechten Arm befürchtete er sogar, eine dauerhafte Verletzung davongetragen zu haben.2
Liniengravur in Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Tafel 1, S. 23, 1746
Aber nur die Hälfte der Nachricht erreichte die Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass Menschen durch diese Experimente vorübergehend oder, wie wir sehen werden, dauerhaft verletzt oder sogar getötet werden könnten, ging in der allgemeinen Aufregung, die auf diese Zeit folgte, verloren. Nicht nur verloren, sie wurden auch bald schon verspottet, bezweifelt und schließlich vergessen. Damals wie heute war es gesellschaftlich nicht akzeptiert, Elektrizität als gefährlich hinzustellen. Nur zwei Jahrzehnte später schrieb Joseph Priestley, der englische Wissenschaftler, der durch seine Entdeckung von Sauerstoff berühmt wurde, seine Geschichte der Elektrizität, in der er den „feigen Professor“ Musschenbroek und die „übertriebenen Berichte“ der ersten Experimentatoren ins Lächerliche zog.3
Die Erfinder waren nicht die Einzigen, die versuchten, die Öffentlichkeit zu warnen. Johann Heinrich Winkler, Professor für Griechisch und Latein in Leipzig, versuchte das Experiment durchzuführen, als er davon hörte. „Ich erlitt große Krämpfe in meinem Körper“, schrieb er an einen Freund in London. „Es hat mein Blut in große Aufregung versetzt, so dass ich Angst vor einem brennenden Fieber hatte und kühlende Medikamente verwenden musste. Ich fühlte eine Schwere in meinem Kopf, als hätte ich einen Stein darauf liegen. Zweimal verursachte es bei mir eine Nasenblutung, zu der ich ansonsten nicht geneigt bin. Meine Frau, die den elektrischen Blitz nur zweimal erhalten hatte, war danach so schwach, dass sie kaum noch laufen konnte. Eine Woche später erhielt sie nur einen elektrischen Blitz; ein paar Minuten später blutete sie aus der Nase.“
Aus den Erfahrungen zog Winkler die Lehre, dass Lebewesen keine Elektrizität zugefügt werden sollte. Und so verwandelte er seine Maschine in ein großes Warnsignal. „Ich habe in den Berliner Zeitungen gelesen“, schrieb er, „dass sie solche elektrischen Blitze an einem Vogel ausprobiert haben und er dadurch sehr große Schmerzen erlitten hat. Ich habe dieses Experiment nicht wiederholt; denn ich halte es für falsch, Lebewesen einen solchen Schmerz zuzufügen.“ Er wickelte deshalb eine Eisenkette um die Flasche, die zu einem Stück Metall unter dem Gewehrlauf führte. „Wenn dann die Elektrifizierung stattfindet“, fuhr er fort, „sind die Funken, die vom Rohr auf das Metall fliegen, so groß und so stark, dass sie (sogar tagsüber) in einer Entfernung von 50 Metern gesehen und gehört werden können. Sie stellen einen Blitzstrahl dar, eine klare und kompakte Feuerlinie; und sie machen ein Geräusch, das alle Leute, die es hören, erschreckt.“
Die breite Öffentlichkeit reagierte jedoch nicht wie erwartet. Nachdem sie Berichte wie die von Musschenbroek in den Protokollen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Frankreich, der Académie Royale des Sciences, und seine eigenen in den Philosophical Transactions der Royal Society of London gelesen hatte, stellten sich neugierig gewordene Männer und Frauen zu Tausenden in ganz Europa an, um den Reiz der Elektrizität in Experimenten selbst zu erleben.
Abbé Jean-Antoine Nollet, ein Theologe, der zum Physiker wurde, führte die Magie der Leidener Flasche in Frankreich ein. Er versuchte die unersättlichen Forderungen der Öffentlichkeit zu befriedigen, indem er Dutzende, Hunderte von Menschen gleichzeitig elektrisierte. Dazu forderte er sie alle zum Händehalten auf, um eine Menschenkette in Form eines großen Kreises zu bilden, dessen Enden nahe beieinanderlagen. Er stellte sich an ein Ende, während die Person, die das letzte Glied darstellte, die Flasche ergriff. Plötzlich vervollständigte der gelehrte Abt mit seiner Hand den Schaltkreis durch das Berühren des in die Flasche eingeführten Metalldrahtes. Der Stromschlag wurde sofort entlang der gesamten Kette gleichzeitig verspürt. Elektrizität war kurzerhand zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden; die Welt war, wie einige Beobachter es nannten, von „Elektromanie“ besessen.
Die Tatsache, dass Nollet mehrere Fische und einen Spatz mit derselben Ausrüstung durch einen Stromschlag getötet hatte, schreckte die Menge nicht im Geringsten ab. In Versailles elektrisierte er in Gegenwart des Königs eine Kompanie von 240 Soldaten der französischen Garde, die sich an den Händen hielten. Er elektrisierte Mönche im Kartäuserkloster in Paris, die sich in einem Kreis von mehr als einem Kilometer Umfang aufgestellt hatten und über Eisendrähte mit ihrem jeweiligen Nachbarn verbunden waren.
Das Erlebnis gewann zunehmend an Popularität. Bald beklagte sich die Öffentlichkeit darüber, dass der Reiz eines Stromschlags immer mit Schlangestehen oder einer Arztkonsultation verbunden war. Der Bedarf nach tragbaren Geräten wurde geweckt, die jeder zu einem vernünftigen Preis kaufen und nach Belieben genießen konnte. Und so wurde die „Ingenhousz-Flasche“ erfunden. In einem elegant aussehenden Etui befand sich eine kleine Leidener Flasche, die mit einem lackierten Seidenband und einer Kaninchenhaut verbunden war, mit der der Lack gerieben und die Flasche aufgeladen werden konnte.4
Elektrische Gehstöcke wurden zu einem erschwinglichen Preis „für jeden Geldbeutel“5 verkauft. Dabei handelte es sich um Leidener Flaschen, die geschickt als Spazierstöcke getarnt waren. Man konnte sie heimlich aufladen und ahnungslose Freunde und Bekannte zum Berühren derselben verführen.
Dann gab es den „elektrischen Kuss“, ein Freizeitvergnügen, das sogar der Erfindung der Leidener Flasche vorausging, danach aber viel aufregender wurde. Der Physiologe Albrecht von Haller an der Universität Göttingen erklärte ungläubig, dass solche Gesellschaftsspiele „die Quadrille ersetzt haben“ (Anm. d. Verlags: zur damaligen Zeit ein beliebter Tanz in Frankreich). „Ist es zu glauben“, schrieb er, „dass der Finger einer Dame, ihr Fischbein-Petticoat, wahre Blitzstrahle aussenden und so charmante Lippen ein Haus in Brand setzen könnten?“
Sie war ein „Engel“, schrieb der deutsche Physiker Georg Matthias Bose, mit „weißem Schwanenhals“ und „blutgekrönten Brüsten“, der „Ihr Herz mit einem einzigen Blick stiehlt“, dem Sie sich aber auf eigene Gefahr nähern. Er nannte sie „Venus Electrificata“ in einem Gedicht, das in Latein, Französisch und Deutsch veröffentlicht und in ganz Europa berühmt wurde:
Wenn ein Sterblicher nur ihre Hand berührt,
Von solch einem göttlichen Kind sogar nur ihr Kleid,
Brennen die Funken doch genauso durch alle Glieder.
So schmerzhaft es auch ist, begehrt er es erneut.
Sogar Benjamin Franklin fühlte sich gezwungen, Anweisungen zu geben: „A und B sollen auf Wachs stehen; oder A auf Wachs und B auf dem Boden; geben Sie einem von ihnen die elektrifizierte Phiole in die Hand, der andere soll den Draht ergreifen; es wird einen kleinen Funken geben; aber wenn sich ihre Lippen nähern, fühlen sie den Stromschlag und werden geschockt.“6
Wohlhabende Damen veranstalteten solche Formen der Unterhaltung in ihren Häusern. Sie beauftragten Instrumentenbauer, große, kunstvolle elektrische Maschinen herzustellen, die sie wie Klaviere zur Schau stellten. Personen mit bescheideneren Mitteln kauften Standardmodelle, die in verschiedenen Größen, Stilen und Preisen erhältlich waren.
Liniengravur ca. 1750, reproduziert in Jürgen Teichmann, Vom Bernstein zum Elektron, Deutsches Museum 1982
Abgesehen vom Unterhaltungswert wurde Elektrizität – von der angenommen wurde, dass sie mit der Lebenskraft zusammenhänge oder mit dieser identisch sei – hauptsächlich wegen ihrer medizinischen Wirkungen verwendet. Sowohl elektrische Maschinen als auch Leidener Flaschen fanden ihren Weg in Krankenhäuser und in die Praxen von Ärzten, die mit der Zeit Schritt halten wollten. Eine noch größere Anzahl von „Elektrikern“, die nicht medizinisch ausgebildet waren, richteten eine Praxis zur Behandlung von Patienten ein. Quellen zufolge wurde medizinische Elektrizität in den 1740er- und 1750er-Jahren von Praktizierenden in Paris, Montpellier, Genf, Venedig, Turin, Bologna, Leipzig, London, Dorchester, Edinburgh, Shrewsbury, Worcester, Newcastle-upon-Tyne, Uppsala, Stockholm, Riga, Wien, Böhmen und Den Haag verwendet.
Der berühmte französische Revolutionär und Arzt Jean-Paul Marat, ebenfalls ein Elektropraktiker, schrieb darüber ein Buch mit dem Titel Mémoire sur l’électricité médicale.
Franklin behandelte Patienten in Philadelphia mit Elektrizität – und zwar so viele, dass Behandlungen mit statischer Elektrizität später im neunzehnten Jahrhundert unter dem Begriff „Franklinisierung“ bekannt wurden.
John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, veröffentlichte 1759 eine 72-seitige Abhandlung mit dem Titel Desideratum; or, Electricity Made Plain and Useful. Er nannte die Elektrizität „die edelste Medizin, die bisher auf der Welt bekannt ist“, die bei Erkrankungen des Nervensystems, der Haut, des Blutes, der Atemwege und der Nieren eingesetzt werden sollte. „Eine Person, die auf dem Boden steht“, fühlte er sich verpflichtet hinzuzufügen, „kann eine elektrifizierte Person, die auf dem Harz steht, nicht ohne Weiteres küssen.“7 Wesley selbst elektrisierte Tausende von Menschen im Hauptquartier der methodistischen Bewegung und an anderen Orten in London.
Und es waren nicht nur Prominente, die damit ein Geschäft eröffneten. So viele nichtmedizinische Menschen kauften und mieteten Maschinen für medizinische Zwecke, dass der Londoner Arzt James Graham im Jahr 1779 schrieb: „Ich zittere vor Sorge um meine Mitmenschen, wenn ich in fast jeder Straße dieser großen Metropole einen Friseur, einen Chirurgen, einen Zähnezieher, einen Apotheker oder einen gewöhnlichen Mechaniker sehe, dessen Fachgebiet jetzt auch die Elektrizität einschließt.“8
Da Elektrizität Kontraktionen der Gebärmutter auslösen konnte, wurde sie stillschweigend als Abtreibungsmethode verstanden. Francis Lowndes war zum Beispiel ein Londoner Elektropraktiker mit einer umfangreichen Praxis, der damit Werbung machte, mittellose Frauen kostenlos „wegen Amenorrhö“ zu behandeln.9
Sogar Landwirte fingen an, die Wirkung von Elektrizität auf ihre Ernte zu testen und sie als Mittel zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion vorzuschlagen, wie wir in Kapitel 6 sehen werden.
Die Anwendung von Elektrizität auf Lebewesen im 18. Jahrhundert war in Europa und Amerika so weit verbreitet, dass eine Fülle wertvoller Erkenntnisse über ihre Auswirkungen auf Menschen, Pflanzen und Tiere gesammelt wurde. Dieses Wissen ist völlig in Vergessenheit geraten, obgleich es weitaus umfangreicher und ausführlicher ist als das, was den Ärzten von heute darüber bekannt ist. Sie sehen zwar tagtäglich die Auswirkungen auf ihre Patienten, verstehen jedoch die Ursachen dafür nicht. Sie sind sich noch nicht einmal bewusst, dass dieses Wissen überhaupt existierte. Die Informationen hierüber sind sowohl formell als auch informell – Briefe von Personen, die ihre Erfahrungen beschreiben, Berichte in Zeitungen und Zeitschriften, medizinische Bücher und Abhandlungen, Vorträge auf Treffen wissenschaftlicher Gesellschaften und Artikel, die in neu gegründeten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
Bereits in den 1740er-Jahren bezogen sich zehn Prozent aller in den Philosophical Transactions veröffentlichten Artikel auf Elektrizität. Und während des letzten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts hatten gut 70 Prozent aller Artikel über Elektrizität in der renommierten lateinischen Zeitschrift Commentarii de rebus in scientis naturali et medicina gestis mit ihrer medizinischen Verwendung und ihren Auswirkungen auf Tiere und Menschen zu tun.10
Trotz aller möglicher Bedenken: Die Schleusen standen weit offen und die Flut der Begeisterung für Elektrizität strömte ungehindert weiter – und sollte dies auch in den kommenden Jahrhunderten tun. Dabei fegte man kurzerhand alle Vorbehalte zur Seite und machte aus Gefahrenschildern sprichwörtlich Kleinholz. So wurden ganze Wissensgebiete zerstört und auf bloße Fußnoten in der Geschichte der Erfindung reduziert.