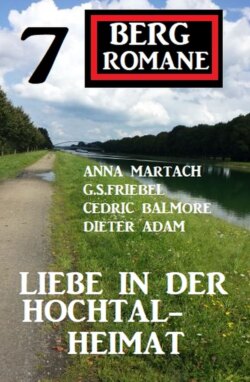Читать книгу Liebe in der Hochtal-Heimat: 7 Bergromane - Cedric Balmore - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
23
ОглавлениеWo Tasso nur so lange bleibt, denkt Peer. Ich muss ihm das stundenlange Herumstreunen verbieten. Eines Tages wird ihn mir ein Jäger abschießen. Wahrscheinlich ist er wieder den Maultieren entgegengelaufen.
Peer blickt aus dem Fenster. Es ist neblig, ein leichter Regen erfüllt die Luft. Peer wartet auf die Träger zum Trafon-Kamm hinauf, mit ihren Maultieren und Traglasten, um die meteorologische Station für den kommenden, langen Winter zu verproviantieren. Mehl, Konserven, Kohle, hunderterlei Dinge müssen für die monatelange Einsamkeit des Beobachters hinaufgebracht werden, der dann von aller Welt abgeschnitten ist.
Peer freut sich auf diese Zeit. Er hat es hier oben verlernt, mit den Menschen umzugehen. Sie bringen ihm nur Unruhe.
Peer geht wieder an seinen Arbeitstisch und beginnt in den Tabellen nachzurechnen. Um sechs Uhr abends wird er zum letzten Mal vom Tal aus angeläutet, dann muss er seine Ablesungen durchgeben. Er weiß, dass Sturm aufkommen wird, Föhnsturm. Und dass seine Meldungen heute für die Flughäfen wichtig sein werden.
Nachdem Peer fertig ist, kehrt er den Boden, reinigt das Geschirr und überzieht sein Bett mit frischer Wäsche, wie zu jedem Wochenende. Dann beginnt er seine Mahlzeit zu kochen. Dies ist nun schon zwei Jahre sein Tagesablauf. Bis Mitternacht kann er schlafen. Dann muss er mit der Taschenlampe auf den Turm gehen und die Instrumente ablesen. Was unten in der Welt vorgeht, kümmert ihn längst nicht mehr. Er könnte durch den Draht öfters mit Menschen sprechen. Mit dem Postmeister in Korins oder mit dem Stationsvorsteher in Körtschach. Der muss nämlich für die Eisenbahnverwaltung täglich nach dem Wetterbericht fragen. Es ist schon ein Jahr her, dass Peer außer seinen Berichten ein einziges Wort mit diesen beiden Menschen gesprochen hat. Dem meteorologischen Institut werden die Berichte in Zahlen chiffriert durchgesprochen. Nach einem sinnreichen System. Kein einziges Wort wird dabei gesprochen, nicht einmal ein Gruß.
„Ende der Durchgabe“, heißt es zum Schluss. Dann kommt das Glockensignal. Das ist alles. Menschen gibt es für Peer keine mehr.
Bis auf Veit, der alle Monate einmal kommt, wenn er am Larennjoch auf einer Alm zu tun hat. Im Herbst haben auch seine Besuche ein Ende.
Und Dina!
Ohne frische Milch und Butter, die Dina ihm vom Mai bis September bringt, würde Peer krank werden. In der übrigen Zeit nimmt er Vitamine in Pillenform ein. An Dina hat sich Peer gewöhnt. Aber über die Menschen – über die große Welt dort draußen spricht er auch mit Dina nicht. Bis auf das eine Mal.
Heute ist Peer missgestimmt. Schweres Wetter ist in Aussicht. Das Barometer ist gefallen, der Feuchtigkeitsmesser beschreibt eine steile Kurve, die Halbkugeln des Windmessers bewegen sie von Stunde zu Stunde immer schneller.
Das bedeutet Sturm. Im Südwesten ballt sich schwarzes Gewölk zusammen. Peer weiß, dass es heute eine schlaflose Nacht werden wird, in der er auf die Anrufsignale warten muss. In solchen Sturmnächten rufen die großen Flughäfen des Flachlandes an, die Wetterstationen im Süden, welche die Warnungen an die vielen Verkehrsflugzeuge weitergeben, die Nacht für Nacht unterwegs sind mit ihren schlafenden Passagieren in den geheizten Luxuskabinen.
Endlich hört Peer das laute Bellen des Hundes. Er öffnet die Tür. Der Telefondraht, der vom Turm ins Tal führt, schwirrt im Sturm, die Stahltrossen der Hüttenverspannung dröhnen wie eine Orgel. Peer darf das Haus nicht verlassen, jede Sekunde kann ein Glockensignal vom Apparat kommen, das er nicht überhören darf.
Vom Hang unter dem Telefondraht kommen drei Menschen gegen die Hütte zu. Peer sieht den Hund, der diese Menschen immer wieder umkreist.
Erst als sie näherkommen, erkennt Peer Dina. Sie stützt Veit, an dessen anderer Seite ein großer, breitschultriger Mann geht. Nun nähert sich der seltsame Zug der Hütte. Tasso kommt angerannt und springt an Peer hinauf, mit hängenden Ohren, schuldbewusst mit dem Schweif um Verzeihung für sein langes Ausbleiben wedelnd.
„Was ist geschehen?“, ruft Peer den dreien entgegen. Er sieht Veits verbundenen Arm.
„Veit ist verletzt, angeschossen.“
„Was ist mit ihm geschehen?“
„Der Förster schickt morgen früh zwei Männer mit einer Tragbahre. Sein Arm ist verletzt.“ Dina stockt. Mit sichtlicher Überwindung gibt sie die zögernde Antwort.
„Er braucht wohl Hilfe, ärztliche Hilfe …“
Während Nagiller Veit in das Innere der Hütte führt, bleibt Dina bei Peer im Türstock stehen. Sie ahnt die dunkle Sorge, die in Peer erwacht ist.
„Der Arm ist abgebunden. Ich weiß, dass dies nicht lange sein darf. Kannst du ihn retten?“
„Wie kannst du so etwas auch nur fragen?“ Peer ist verstimmt. Zwei kurze Sätze bohren sich in sein Denken: Ich werde meine Pflicht als Arzt erfüllen. Und: Veit wird seine Pflicht als Bürgermeister erfüllen.
„Führe ihn in die geheizte Arbeitsstube“, befiehlt er dann Nagiller.
„Was bedeutet das alles?“, fragt Peer leise Dina. „Du bist erregt und dabei erschöpft zum Umfallen!“ Peer legt den Arm um Dina und führt sie in den Vorraum.
„Ich werde dir später alles erzählen“, wehrt sie ab. „Ich war gefangen – in der Malosa-Höhle gefangen.“
„Wie kamst du in die Höhle?“ Peers Augen weiten sich vor Schreck.
„Ich habe den Wildbach aufgestaut. Und Androts Heroinlager vernichtet. Dann sperrten mich Androts Leute ein.“
„Du? Das ist – das ist ungeheuerlich!“ Peer atmet tief auf. „Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren.“ Er gibt Dina frei. „Du musst mir jetzt helfen. Es war recht, dass du Veit gebracht hast.“
Peer geht in die Stube, wo Nagiller eben dabei ist, Veit aus den nassen Kleidern zu schälen. Peer ist ihm dabei behilflich.
„Wo bist du getroffen worden?“, fragt er Veit, während er ihn aus dem Hemd schält.
„Oberarm – bei der Achsel, mehr innen. Der Förster hat mir den Arm abgebunden. Willst du es nicht lassen, bis sie mich morgen zum Arzt bringen? Die Schmerzen lassen bereits nach. Es wäre mir lieber, wenn du nicht …“
„Nein!“ Mit einem Ruck richtet sich Peer vor dem Verletzten auf. „Ich bin selbst Arzt. Bis morgen darf der Arm nicht abgebunden bleiben. Sonst würdest du ihn verlieren!“ Peer öffnet den Schrank mit den ärztlichen Instrumenten. Dann klopft er um die Herzgrube des Veit.
Er saugt sich mit der Membran der kleinen Trommel, von der aus die dünnen Schläuche den Ton in die Ohren tragen, in der Herzgrube fest. Er horcht eine halbe Ewigkeit, dann wandert er damit höher zur Aorta, zu der Lungenschlagader und auf der erschauernden Haut zu den geheimnisvollen Adersträngen.
Endlich untersucht er die Wunde selbst und führt eine Sonde ein.
Veit presst die Zähne vor Schmerz in die Lippen.
„Lass es, Hannes“, bittet er mit heiserer Stimme, nachdem Peer die Sonde herausgezogen hat. „Ich will nicht. Es genügt wohl ein Notverband.“
Peer blickt Veit durchdringend an. „Dein Gesicht sieht nicht danach aus, als ob es ein Geheimnis der Güte berge: Was willst du damit sagen?“
„Dass ich jetzt ahne, wer du bist. Wir haben einmal so ein Fahndungsblatt bekommen, nach einem Arzt, der hier in der Gegend gesehen worden sein soll.“
„Du darfst nicht so viel sprechen, Veit. Dieser Arzt bin ich. Alles andere interessiert uns nicht. Jetzt stehen wir vor einem anderen Befund als jenem, der in deinem Amtskasten liegt: Die Kugel ist durch den Oberarm gegangen! Sie hat den Knochen gestreift und einen Splitter abgerissen. Dieser Knochensplitter hat das arterielle Hauptgefäß des Armes verletzt. Ich muss es daher nähen.“
„Was ist das für ein Gefäß?“
„Die Hauptschlagader des Armes. Sie muss genäht werden, verstehst du?“
„Nein, Hannes. Ich will es nicht. Verbinde mich. Ich werde morgen in Korins zum Arzt gehen.“
„Das ist unsinnig! Das darf ich als Arzt nicht zulassen. Du würdest deinen Arm durch die Nekrose verlieren, die sich entwickeln wird, wenn er bis morgen so bleibt.“
Veit senkt den Kopf. Es würgt ihn in der Kehle.
„Hannes – weißt du, was du tust? Weißt du auch, dass du nicht auf meine Dankbarkeit rechnen darfst? Ich habe meinen Amtseid geschworen. Die Behörden vertrauen mir. Ich habe meine Hände stets sauber gehalten …“
„Erspare dir jedes weitere Wort“, unterbricht ihn Peer mit harter Stimme. „Ich verstehe dich, und ich rechne nicht auf Dankbarkeit, soweit sie eine Pflicht verletzen soll, die du geschworen hast. Bring mir das große weiße Leinentuch, Dina! Ja – dort links. Fass es vorsichtig an. Breite es über den Tisch, dann ziehe dort die Lade aus dem Kasten, die unterste. Du findest eine rote, schmale Schachtel, ja, das ist sie! Reiche mir eine Glasampulle heraus.“
Peer füllt eine Ampulle in seine Injektionsspritze.
„Du bekommst jetzt eine Injektion“, erklärt Peer dem Verletzten. „Gegen eine Thrombose, falls sich ein Blutpfropfen bilden sollte. Nur eine Sekunde halte still.“
Peer füllt noch einmal die Spritze. „Jetzt noch eine schmerzstillende Injektion. Dann haben wir genug gespritzt. Du brauchst keine Angst zu haben. Meine Arbeit wird bald getan sein. Deine hat vorderhand noch zwei Tage Zeit, mein Lieber!“
Peer wirft einen Blick auf Dina, die ihm die Blechbüchse mit den sterilisierten Nadeln reicht.
Peer ergreift mit der Pinzette eine Nadel. Alle Wunder einer hervorragenden Technik entwickeln sich jetzt vor Dina. Peer vergießt keinen unnötigen Blutstropfen. Sein Wesen, seine Haltung, sein Blick scheinen merkwürdig verändert, wie er jetzt die Nadel in der Hand hält. Mit knappen, ruhigen Worten oder Bewegungen weist er Dina an, ihm die eine oder andere Pinzette zu reichen. Eine unheimliche Stille herrscht in dem Raum der Hütte, in den nur von außen her das Heulen des Sturmes dringt.
Wie ich Hannes liebe, denkt Dina. Ihn, den Mann, der sich selbst opfert für sein Gewissen, für seine ärztliche Pflicht. Es quillt Dina feucht aus den Augen, wie sie sich jetzt zu Peer niedergebeugt und ihm mit einer Pinzette die Tupfer aus der Schachtel reicht.
Peer sieht einen Augenblick lang auf Dina, ein ernster, etwas unwilliger Blick trifft sie. „Es darf keine Träne auf diese Tupfer fallen“, sagt er ärgerlich. „Wir sind nun soweit. Das Gefäß habe ich freigelegt, der verdammte Knochensplitter ist entfernt. Jetzt vereinige ich die Enden der Arterie mit den Fäden. Nicht anders wie ein Schneider, nicht wahr?“
Peer hebt etwas den Kopf und lächelt. Dina steht dicht neben ihm, sie hält Veits Arm fest, dabei berührt ihre Schulter Peers Schulter. Sie fühlt die Wärme seines Blutes, sie strömt in ihren eigenen Arm.
„Du kannst schon die Gummibinde loslassen“, befiehlt ihr Peer. Dina lässt die elastische Binde los, die sie mit der Linken zusammengepresst gehalten hatte.
Nun vernäht Peer noch die Hautwunde. Dina wundert sich, wie flink die einzelnen Nähte gelegt werden. Es geht so schnell, dass sie kaum zusehen kann.
„Tut es weh?“, fragt er Veit. Dieser schüttelt den Kopf.
Dina beobachtet immer noch Peers Hände, die in Gummihandschuhen stecken und jetzt die Nadel weglegen. Ein ganzer Haufen von Nadeln, blutbefleckten Pinzetten, Nadelhaltern und Scheren liegt auf dem Tisch.
„Das Verbandszeug bitte!“ Peer zeigt auf den Tisch. „Dort die Binden!“
„Feines Werkzeug für einen Meteorologen, nicht wahr?“, spottet Peer, als er Veits Blick auf diesem Haufen ruhen fühlt. „Ihr könnt es gleich abräumen und einpacken. Beweismaterial für die löbliche Gendarmerie!“
Wie bitter dieser Spott klingt, denkt Dina, in deren Augen Tränen stehen.
Eine Zeitlang verharrt sie noch schweigend neben Peer. Nagiller sitzt in einer Ecke und glotzt stumpfsinnig vor sich hin. Seine Stirne ist rot vor Zorn und Wut, und er kann nichts dafür, dass sich diese gegen die unschuldige Ursache dieses Zornes richten, gegen Veit!
Endlich ist Peer mit seiner Arbeit fertig. In dem Raum riecht es nach Blut, Verbandsstoff und Säuren. Veit sitzt bleich und müde in dem einzigen bequemen Stuhl, den es in der Station gibt und schließt die Augen.
„Die Sache wird bald in Ordnung kommen“, sagt Peer zu Dina. „Du brauchst keine Angst um Veit zu haben. Einige Tage Schonung. Er hat viel Blut verloren. Kennst du deine Blutgruppe?“, wendet er sich dann an Veit.
„Nein.“
„Schade. Jedermann sollte seine eigene Blutgruppe kennen. So hätte ich dir vielleicht von meinem Blut abgeben können. Eine Transfusion ist bald gemacht. Aber es muss unbedingt dieselbe Blutgruppe sein, sonst heimst der Tod seine Ernte ein. Es wäre doch ganz nett, wenn wenigstens ein kleiner Teil meines Blutes sich der Freiheit der Berge erfreuen könnte, nicht?“
Peer treibt Dina mit der Zwiespältigkeit seines Wesens zur Verzweiflung. Sie findet nicht die Kraft zu einer Entgegnung, und Veit lässt alle Reden widerstandslos und ohne Erwiderung über sich ergehen.
„Am besten, wir legen jetzt Veit drüben in mein Bett“, meint Peer, als er fertig ist. „Ich habe es gerade heute frisch überzogen. Nagiller wird im Kasten ein Hemd finden. In der Nacht wird es bitter kalt. Und wir beide müssen es uns auf der Ofenbank bequem machen, Dina. Ich werde Decken bringen und Seegraspolster. Sehr komfortabel ist mein Hotel hier nicht eingerichtet. Mein Arbeitszimmer ist ja auch Speisezimmer und Küche zugleich! Jetzt muss du schon das Hüttenweibchen spielen! Für Veit gibt es eine Zitronenlimonade mit recht viel Zucker und für euch Tee mit Rum!“
Veit richtet sich mühsam auf. Während ihn Nagiller stützt, geht er auf Peer zu und reicht ihm die Hand. Sie liegt matt und müde in Peers kräftigen Fingern.
„Ich darf wohl jetzt in deine Kammer?“, fragt Veit leise. „Ich will über die Sache nachdenken, Hannes. Lange und gründlich nachdenken. Da ich verletzt bin, werde ich meine Stellung als Bürgermeister morgen früh niederlegen …“
Peer versteht, was Veit meint. „Es wird besser sein, du schläfst dich ordentlich aus, mein Lieber; Später komme ich zu dir, und du bekommst noch eine Injektion.“
„Ich danke dir für alles.“
Veit geht langsam durch die Stube in den abgeteilten Nebenraum. An der Tür wendet er sich nochmals um. „Nagiller – du läufst jetzt hinab nach Korins. Du meldest dem Patscheider, was geschehen ist. Und dass es Androt war, der Dinas Tod beschlossen hatte, damit nicht Androt alles auf den Korbik schiebt, der ebenso ein armer Teufel ist wie alle anderen. Korbik hat Dina nur festhalten wollen, bis Androt kam! Und dass Blust tot ist!“
„Es ist recht“, sagt Nagiller. Seine Augen blicken fragend auf Peer. „Damit ihr es aber alle wisst“, stammelt er unbeholfen. Meinetwegen – weil ich das alles mitangesehen habe – meinetwegen braucht ihr den Peer nicht anzuzeigen, Herr Trenkwalder! Wir Schmuggler, denen dieser Mann schon oft geholfen hat in leiblicher Not, wir wissen zu schweigen. Bis über das Grab hinaus!“
„Es ist gut“, wehrt Peer ab und lächelt bitter. „Mit dem Grab hat es seine Weile. Sage dem Förster, dass die Männer mit der Tragbahre schon bei Tagesanbruch kommen sollen. Und dass es Veit gut gehe. Sage dies auch Gertrud! Wenn es nicht so steil bergab ginge, würde ich Veit sogar zu Fuß gehen lassen, damit sich Gertrud nicht ängstigt. Ich glaube, dass wir alle sie vergessen haben, bei dem, was wir jetzt vor uns haben!“
Nagiller versteht nicht, was Peer meint. Er macht eine unbeholfene Bewegung mit dem Oberkörper und verschwindet, im innersten Herzen froh, aus dieser ungemütlichen Beklommenheit herauszukommen, die über den drei Menschen in der Trafon-Hütte liegt. Zwei Männer und ein Mädchen!
Als er die Tür öffnet, fährt ein Windstoß in das Innere. Auf das blechbeschlagene Dach der Hütte trommelt der Regen.
Peer begleitet Nagiller bis zur äußeren Tür. Dann schließt er sie hinter dem Scheidenden mit dem doppelten, schweren Schloss.
„Geh auf deinen Platz“, befiehlt er dem Hund, der an den Wänden herumschnuppert.
Als Peer zurück in die Wohnstube kommt, ist es still. Veit liegt in der kleinen Kammer, Peer hört seine regelmäßigen Atemzüge. Dina sitzt auf der Bank neben dem Ofen.
„Was wird nun werden?“, fragt sie und blickt ihn aus ihren traurigen Augen flehend an.
„Was werden wird?“ Peer senkt den Kopf. „Schöner, als ich es hier hatte, wird es wohl für mich nicht werden. Weißt du, gelernt habe ich viel in meinem mühsamen Leben. Aber denken, das Denken habe ich erst hier oben in dieser Einsamkeit gelernt. Hier bin ich erst weise geworden. Umlernen will ich nun nicht mehr. Was kommen wird, schreckt mich nicht. Aber Ordnung will ich in mein Leben bringen. Du darfst Veit nicht zürnen, Dina. Früher oder später hätte das kommen müssen. Wäre es nicht Veit, wäre es ein anderer gewesen. Es hätte sich nichts geändert!“
„Doch, Hannes. Jetzt bin doch ich da!“
„Ja, Dina. jetzt bist du da. Du warst immer da, auch wenn ich allein in diesen vier Wänden war. Da warst du immer! Und künftig wirst du noch mehr bei mir sein, da, wo ich ganz allein sein werde.“
Peer lehnt sich an die hölzerne Wand zurück, er ist auf einmal so müde. Er schließt die Augen, wie von Ferne hört er das Jammern des Windes. Peer fühlt die Wärme des Mädchens neben sich.Endlich übermannt ihn der Schlaf.