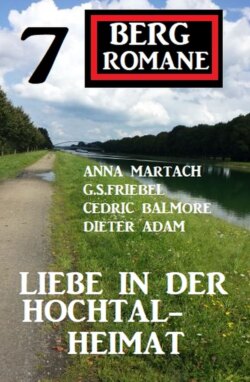Читать книгу Liebe in der Hochtal-Heimat: 7 Bergromane - Cedric Balmore - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеHannes Peer, der Beobachter auf der Trafon-Station, legt das Hörrohr des Fernsprechers wieder in die Gabel. Seine Wettermeldung ist durchgegeben. Nun hat er bis fünf Uhr nachmittags Ruhe. Sonntagsruhe sozusagen!
Es ist keine schwere Arbeit, die Hannes Peer Tag für Tag auszuführen hat. Sie erfordert nur stets Wachbereitschaft und gewissenhafte Genauigkeit. Und die Fähigkeit, hier oben ein einsames Leben zu verbringen.
Alle vier Stunden müssen die Instrumente abgelesen werden, Tag und Nacht, Woche für Woche. Die Menge des gefallenen Regens oder Schnees muss in Tabellen eingetragen werden, die Geschwindigkeit des Windes, der hier auf dem Trafon-Kamm meist vom Süden her weht, die Temperatur und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft.
Die Trafon-Station ist keine sehr hochgelegene Wetterwarte, wie es solche auf Berggipfeln gibt. Aber die Wissenschaftler in der Stadt schätzen sie ob ihrer günstigen Lage an einer Wetterscheide, die ob ihrer Föhneinbrüche bekannt und gefürchtet ist.
Peer verfolgt die Wolken mit seinen dunklen Augen. Seine Gedanken aber sind woanders, sie wandern immer wieder in die Vergangenheit zurück. Sind zwei Jahre, zwei Jahre in dieser Einsamkeit so lang, dass er auch alles vergessen konnte, was hinter ihm liegt? Bitter quillt es in seinem Herzen. Nun wendet sich Peer vom Fenster ab. Er will nicht denken, er will auch keiner Erinnerung nachhängen. Er hat sich ein neues Leben geschaffen, und es muss ihm gelingen, weil er es will.
Einige Augenblicke horcht er nach oben. Vom Turm hört er das surrende Geräusch des Windmessers. Ohne Absicht blickt Peer noch einmal aus dem Fenster. Da sieht er Dina den Hang entlang kommen, Dina, die sich entschlossen hat, nun doch den Peer um Rat zu fragen. Peer merkt zum ersten Male, dass ihm das Herz bei ihrem Anblick schneller pocht. Weil er diese Entdeckung nicht wahr haben will, macht er sich in seinem Ärger an dem Barometer zu schaffen. Als ob erst jetzt bemerkt hätte, dass die Tinte in der winzigen Registriernadel blass geworden ist. Aber mit wachem Ohr hört er Dinas Schritte näherkommen. Als das Mädchen die Stationshütte erreicht, steht Peer im Gang, dessen Tür geöffnet ist.
„Kein schönes Sonntagswetter für die Partie“, ruft er ihr zu.
Dina hat Peer nicht im Gang vermutet und zuckt bei seinem Anruf zusammen. Die Röte schießt ihr in die Wangen.
„Ich wollte dir nur diesen Korb mit Erdbeeren bringen.“ Dina geht hinter Peer in die Wohnstube, unruhig und befangen.
„Ich werde Teewasser hinstellen“, erklärt Peer und legt ein Stück Holz in den Ofen.
„Es ist lange, dass du nicht gekommen bist“, meint er plötzlich und dreht sich um.
Dina schlägt das Herz bis zum Hals hinauf.
„Du weißt doch, vormittags die Feldarbeit – wir haben schon das erste Heu herinnen. Und von zwölf Uhr an arbeite ich in der Spinnerei!“
Ein Windstoß lässt den Rauch zurück in die Stube schlagen. Peer wendet sich wieder dem Ofen zu und schürt die Glut.
„Damit ich es dir noch erzähle“, sagt Dina, „wir haben zwei Schafe verkauft. Und die Tiere habe ich vorher geschoren und die Wolle in der Spinnerei verkauft.“
„Hoffentlich hast du gut gewogen!“, Peer nickt Dina zu. „Wo du doch selbst die Wolle übernimmst?“
Dina lächelte nicht über seinen Witz. „Du kommst auf einen wunden Punkt, Hannes. Gestern hat mir Androt die Zumutung gestellt, dass ich schlechter wiegen soll.“
Peer blickt erstaunt auf „Und du? Was hast du geantwortet?“
Dina neigt den Kopf. „Was soll eine Angestellte da antworten? Ich habe seinen Auftrag entgegengenommen. Da gibt es nichts zu reden.“
„Das ist aber doch nicht möglich. Du kannst nicht die armen Bergbauern betrügen. Denke daran, wie viel Schafe sie auf den Berghängen verlieren. Wie viele abstürzen! Und immer wieder die Seuchen. Da kommt es ja auf jede Handvoll Wolle an.“
„Ich wollte es Veit sagen“, meint Dina nach kurzem Nachdenken.
„Dem Trenkwalder?“ Peer steht vor dem Mädchen, den Teeseiher in der Hand. „Der junge Herr Bürgermeister? Der wird ebenso wenig etwas gegen Androt ausrichten wie der alte Vinatzer.“
„Veit ist durch und durch anständig“, widerspricht Dina heftiger, als sie es gewollt hat. Peer blickt sie unangenehm berührt an.
„Zugegeben. Alles recht schön und gut. Schließlich ist dein Veit doch nur ein kleines Dorfbürgermeisterlein. Viele Köpfe hat er nicht hinter sich. Androt braucht nur etwas Geld für den Straßenbau herzugeben oder eine Brücke richten lassen, dann fällt die Hälfte der Gemeinderäte um. Das Leben ist hart hier heroben in den Bergen. Und eine Brücke ist mehr wert als das bisschen Wolle.“
„Androt hat mir eine Stellung angeboten. Als Einkaufsleiterin. Mit fixem Gehalt.“
„Sieh an, sieh an!“ Peer stößt einen leisen Pfiff aus. „Recht klug von ihm. Du hast natürlich angenommen?“
Dina wird bleich. Sie hält sich zurück mit der Antwort.
„Ich habe es nicht leicht“, sagt sie dann. „Meine Tante hat mich zu sich genommen, aus Barmherzigkeit. Sie hat es selber hart. Wenn ich nicht etwas dazu verdienen würde …“
Peer schweigt eine Weile und blickt sinnend in die Wolken hinaus.
„Weiß ich, Dina, weiß ich alles. Ich selbst stand einmal vor dieser Wahl. Ich habe eine blinde Mutter zu erhalten. Ich hätte mich auch mit den Menschen dort unten herumraufen müssen – auf Tod und Leben. Und ich vermochte es nicht. Tu also, was du tun musst.“
Peer unterbricht sich mitten im Wort. Er hat sein halb abgewandtes Gesicht wieder zu Dina gedreht. Sie ist erschrocken über das graue, traurige Antlitz, aus dem alle Ruhe gewichen ist. Seine Augen liegen tiefer in den Höhlen als sonst, das Gesicht kommt Dina gealtert vor, seitdem sie Peer zum letzten Male gesehen.
„Bist du gerne hier heroben?“, fragt Dina nach einer Weile. „Du hast mir noch nie etwas von dir erzählt.“
Peer fühlt, wie warm ihre Frage klingt, so gar nicht nach Neugierde. Es kommt ihm eigentlich gar nicht zum Bewusstsein, dass seine Freundschaft mit Dina immer tiefer geworden ist, obwohl sie sich so selten sehen. Das im Gebirge unter allen Menschen gebräuchliche „Du“ hat dieses Gefühl früher in Peer kaum aufkommen lassen.
„Bist du glücklich in dieser Einsamkeit?“, setzt Dina hinzu.
„Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Und ich bin auch nicht unglücklich. Mein Herz ist leer, und es wird wohl nie mehr empfinden, was es heißt, glücklich zu sein. Du darfst aber nicht glauben, dass ich so schicksalsergeben bin, wie es den Anschein hat. Man muss eben verzichten.“
„Hat man dir ein Unrecht zugefügt?“, fragt Dina beklommen.
Peer schüttelt den Kopf. „Nein, kein Unrecht. Ich werde dir vielleicht einmal Rede und Antwort stehen. Dina. Heute nicht. Das sind keine heiteren Gespräche.“
Liebe, kleine, tapfere Dina, denkt Peer. Wenn ich nur deine Lebensbejahung und deinen jugendlichen Mut hätte! Es ist ihm, als wachse aus seinem Herzen eine neue Zuversicht empor.
Dina ist traurig. Sie fühlt bei Peer überall Dunkel, überall Unklarheiten. Sie weiß noch nichts von der Liebe, aber sie denkt, dass ein wahres Gefühl groß und ungeteilt sein soll und tiefstes Vertrauen zwischen Mann und Frau herrschen muss.
Ihr ist es peinlich, wie sie jetzt mit Peer so allein ist und keiner von ihnen mehr etwas zu sagen weiß. Sie möchte am liebsten aufbrechen, will ihn aber nicht kränken. Peer steht am Herd und bereitet ein Omelette in der flachen Pfanne über dem prasselnden Feuer. Er ist verlegen und ein wenig steif, und da auch Dina nichts sagt, will ein Gespräch zwischen ihnen nicht aufkommen. Nur der Wind, der um die Hütte weht, wird stärker, der am Turm sich immer rascher drehende Windmesser lässt ein gleichmäßiges Surren und Summen ertönen.
Dina steht auf, sie nimmt Gläser und wäscht sie aus. Peer hört das Klappern der Gläser, er sieht, wie sie das Wasser in den Kübel schüttet. Dann geht sie hinaus und leert den Kübel vor der Hütte aus.
Als Dina zurückkommt, überfällt sie der Gedanke, dass sie Peer nur die halbe Wahrheit gesagt hat. Und nichts von dem, was zwischen Androt und ihr vorgefallen war! Während Peer sie forschend ansieht, glaubt Dina, er müsse ihr die Gedanken von der Stirne ablesen können. Diese Angst stößt ihr wie ein Messer ins Herz. Sie zittert und fühlt sich so müde, dass sie schwankt. Peer greift nach ihrem Arm und hält sie fest.
„Dina, bist du krank? Fehlt dir etwas?“
Sie erwacht langsam, wie aus einer Betäubung, und entwindet sich vorsichtig seiner Hand. „Es ist nur – ich mache mir Gedanken über Androt. Gertrud erzählte mir, dass ihr Vater einen Verdacht hat. Gegen Androt. Was es ist, weiß sie nicht.“
„Einen Verdacht? Und dich, dich würde es stärken, wenn es wahr wäre?“
„Ich habe Angst“, kommt es fast unhörbar aus ihrer Kehle. „Angst vor Androt.“ Dinas Augen gleiten unsicher herab an Peers großer, kräftiger Gestalt, die sich jetzt in wildem Zorn strafft. Dina wagt kaum, den Kopf zu heben und seinen zornigen Augen zu begegnen. Das Weinen steht ihr näher.
„Ja, ich habe Angst“, gesteht sie nochmals vor seinen prüfenden Augen. „Er wurde zudringlich. Und er ist der Brotherr.“
„Das meintest du also vorhin? Als du von der neuen Stellung sprachst?“
Nun hat er es gesagt. Dina spürt es wie einen eisernen Reifen um die Brust. Was sie spricht, klingt nach einem Notschrei.
„Ich darf meine Arbeit nicht verlieren. Und für das andere … dazu will ich mich nicht hergeben!“
Plötzlich schreit Dina auf. Von dem eisernen Draht des Blitzableiters am Turm stehen blaue Flammen nach allen Seiten.
Mit einem Male ist die Wohnstube in ein rotblaues Feuer getaucht. Ein Donnerschlag zerreißt krachend die Stille. Die Nebel scheinen unter der Hütte zu stehen, kein Tropfen fällt aus dem dunklen Grau.
Dann ist das Wetter endlich da. „Immer wächst es auf dem Trafon“, erklärt Peer dem verängstigten Mädchen. „Jetzt kannst du nicht hinunter. Es schlägt unterhalb des Grates in die Felsplatten.“
Peer zieht Dina neben sich auf die Ofenbank.
„Keine Angst!“ Peer tröstet das zitternde Mädchen. „Die Stationshütte steht sicher auf festem Fels. Außerdem ist sie mit Drahtseilen nach allen Windrichtungen befestigt. Bis die Ströme aus den Rinnen verebbt sind, begleite ich dich bis zum Larennjoch.“
Angstvoll, mit dunkel umschatteten Augen blickt Dina in das Toben hinaus. Sie merkt gar nicht, dass Peer ihre Hand ergriffen hat und fest umschlossen hält.
„Um diesen Androt mache dir keine Sorgen“, sagte er dann. „Was der Förster über ihn weiß, kann ich nur ahnen. Ein Wilddieb ist der Androt natürlich nicht. Mit kleinen Dingen gibt sich der nicht ab. Das freilich nicht.“
„Du weißt, was es ist?“
„Ich sehe und ahne viel hier oben an der Landesgrenze!“
Peer neigt sich zu dem Mädchen. „Wenn mich nicht alles trügt, so ist Androt der Mann, der hinter allem steht – hinter dem Schmugglerring, der kühner und waghalsiger arbeitet als die kleinen, armseligen Pascher mit ihren Rucksäcken und ihrem geschmuggelten Tabak. Bei Androt geht es nicht um Hunderte und Tausende, sondern um Zehn- und Hunderttausende! Medikamente, Seide, Gold, Platin, Dukaten aller Prägungen! An Arbeitslose und entlassene Sträflinge pirscht sich Androt heran, an Kleinbauern, die einmal in einer Notlage ein Darlehen von ihm bekamen und die sonst Haus und Hof verlieren! Eine ganze Schar unglücklicher, in Not geratener Menschen gehen für Androt über die Grenze! Irgendwo unter dem Larennjoch muss er sein Warendepot haben. Gefährliche Burschen sind es, die in seinem Sold stehen. Wilddiebe, die aus den Gefängnissen entlassen wurden, sichere Schützen, die jeden Kampf mit den Grenzern aufnehmen.“
Mit heißem Atem verfolgt Dina, was Peer ihr berichtet, seine Worte peitschen ihr das Blut durch die Adern bis in die Schläfen und schaffen ihr eine unerträgliche Beklemmung.
„Und du, Hannes?“, fragt sie, als er zu Ende ist. „Du weißt es und schweigst?“
Peer neigt den Kopf. „Ich habe keine Beweise! Ab und zu stahl sich ein verletzter, verfolgter Schmuggler zu mir herauf in meine Hütte, dem ich Hilfe leistete. Keiner von ihnen sprach jemals selbst mit Androt. Ihre Befehle bekommen sie von Mittelsleuten. Niemals zeigt sich Androt seinen Gesellen. Und dann …“
Dina erschrickt. „Und dann?“
Würde sie jetzt das Geheimnis erfahren, ein Geheimnis, das um Peers Einsamkeit wob wie ein dunkler, grauer Nebel?“
„Dann könnte ich auch nicht sprechen“, erwidert er mit heiserer Stimme. „Ich lebe ja gar nicht mehr, Dina. Ich bin von den Lebenden ausgelöscht. Ich bin eine Maschine, eine lebende Rechenmaschine. Und mein Herz … das ist wie die blaue Flamme vorhin auf dem stählernen Seil: leuchtend und brennend und doch kalt und erloschen.“
Peer zieht Dinas Hand an seine Brust. Die beiden Menschen sehen einander an. So sehr presst er ihre Hand zusammen, dass sie leise fragt: „Hannes, was tust du?“
Da gibt er Dina frei. Er kommt sich vor wie einer, der seine Hand nach etwas Verbotenem ausgestreckt hat.