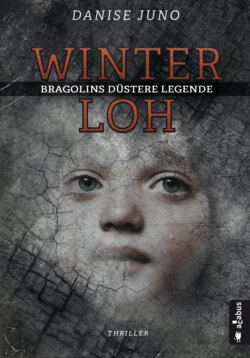Читать книгу Winterloh. Bragolins düstere Legende - Danise Juno - Страница 13
ОглавлениеKapitel 9
Remagen, 2008
Helene Ockenfels saß im Wintergarten in einem gemütlich wirkenden Schaukelstuhl. Eine braun gemusterte Decke lag auf ihrem Schoß, eine Tasse dampfender Tee in den runzligen Händen. Neben ihr ein mosaikbelegter Beistelltisch. Ihr Blick war hinaus über die Terrasse gerichtet, über den Rhein hinweg ins weit entfernte Siebengebirge. Die Szene hatte etwas Malerisches und man hätte glauben können, dass sie jeden Moment zu mir hochsehen und lächeln würde.
Was sie natürlich nicht tat. Sie ignorierte mich einfach. Hielt ihr eisernes Schweigen aufrecht. Natürlich hatte sie mich bemerkt, dessen war ich mir sicher, denn ihr Gehör war ausgezeichnet. Das wusste ich bereits. Dennoch räusperte ich mich, um vielleicht eine winzige Regung hervorzurufen, doch den Gefallen tat sie mir nicht.
Erst als mein Magen überlaut knurrte, da ich bisher noch nicht gefrühstückt hatte, senkte sie die Tasse auf den Unterteller und reichte sie in meine Richtung, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Offenbar sollte ich sie ihr abnehmen. Ich schüttelte leicht den Kopf und für einen Sekundenbruchteil dachte ich daran, sie meinerseits ebenfalls zu ignorieren, doch dann nahm ich ihr die nun leere Tasse ab und stellte sie auf den kleinen Beistelltisch.
Einige Minuten verstrichen, in denen ich einfach dastand und wartete, bis sie schließlich sagte: »Nun, Fräulein Abel, Sie sind also noch da.«
Es war keine Frage. Eine pure Feststellung, die allerdings auch keine Überraschung ausdrückte. Ich zog es vor, zu schweigen.
Als sie merkte, dass sie von mir keine Entgegnung zu erwarten hatte, wandte sie den Kopf und musterte mich. »Was stehen Sie da rum? Haben Sie nicht irgendetwas zu erledigen? Essen zum Beispiel?«
Ich schüttelte abermals den Kopf, allerdings nicht wegen ihres Benehmens, sondern um ihr zu zeigen, dass sie mir wichtiger war als mein knurrender Magen. »Das hat Zeit«, sagte ich und setzte zögernd hinzu: »Ich wollte zuerst nach Ihnen sehen und Sie fragen, ob Sie etwas brauchen.«
Die Alte schnaubte amüsiert. »Hat Ilona Ihnen gesagt, Sie sollen sich anbiedern?«
»Bitte?«
Helene hob eine Braue. »Na, anbiedern, Schönwetter machen, um mich herumscharwenzeln.«
»Ich weiß, was anbiedern bedeutet«, sagte ich schlicht.
»Und?«
»Was?«
»Sollen Sie?«
»Die Frage meinen Sie tatsächlich ernst?«, fragte ich.
Ihre Augen funkelten mich an, dann wandte sie sich wieder dem Ausblick zu. »Bringen Sie mir noch eine Tasse Tee und einen frischen Löffel.« Sie nickte in Richtung einer Bodenvase vor dem Ausgang des Wintergartens. »Der alte liegt da drüben. Nehmen sie den mit.«
Damit war ich offenbar entlassen. Ich hob den Löffel vom Boden auf, ohne zu fragen, wie der da wohl hingekommen sei; ich dachte mir meinen Teil. Die leere Tasse nahm ich vom Tisch und verließ den Wintergarten auf der Suche nach der Küche.
Selbstverständlich lief ich Frau Beck über den Weg, die es jedoch irgendwie eilig zu haben schien und lediglich knapp nickte. Da ich keinen Anhaltspunkt außer dem Esszimmer hatte, ging ich zuerst dort hinein und sah mich um. Ich meinte mich zu erinnern, dass Frau Beck am Vorabend aus einer Seitentür gekommen war, bevor sie das Essen aufgetragen hatte, also wandte ich mich in diese Richtung, ging durch eine schmale Tür und stand in einer Art Vorratsraum. Längs an der Wand zwischen den beiden Ausgängen stand eine Anrichte, auf der ein Tablett bereitgestellt worden war. Darauf ein kleiner Brotkorb mit kalten Toastscheiben, Marmeladengläschen, Butter, einem Teller mit Aufschnitt, abgedeckt mit Frischhaltefolie. Ich erkannte, dass dies wohl mein Frühstück hätte sein sollen, wäre ich rechtzeitig im Esszimmer gewesen. Es hätte sogar ein Ei dazu gegeben, ebenfalls kalt. Wieder knurrte mein Magen, doch ich rührte das Tablett nicht an.
Jetzt verstand ich, warum Frau Beck verärgert geklungen hatte. Sofort fühlte ich mich unbehaglich. Es war schlicht meine Schuld gewesen, dass sie mir auf diese Art begegnet war. Ja, ich war mit den Abläufen in Haus Ockenfels noch nicht vertraut, schließlich war dies mein erster offizieller Arbeitstag. Hätte ich mir denken können, dass ich hier sogar bedient werden würde? Nein. Im Leben nicht. Mich hatte noch nie irgendjemand bedient, geschweige denn mir auch nur eine Tasse Kaffee gemacht. Extra für mich. Durch mein Verhalten hatte die Haushälterin erkannt, dass ich weder zur Upper Class gehörte, noch den Umgang mit solchen Menschen gewohnt war. Ich war nicht einmal in der Lage, der alten Helene auf intellektuelle Weise die Stirn zu bieten. Fazit: Ich passte nicht hierher.
In diesem Moment begann ich zu ahnen, wie anders mein Leben hier sein würde, sollte es mir gelingen, mich anzupassen. Augenblicklich begann ich an mir selbst zu zweifeln, wie so oft. Vielleicht hatte Frau Beck Recht mit ihrer Einschätzung, und ich passte wirklich nicht hierher.
Ein Gefühl der Minderwertigkeit durchströmte mich, das mir nur zu vertraut war. Aber was sagt die Herkunft über einen Menschen aus?, fragte ich mich. Spielt sie wirklich eine Rolle? Braucht nicht jeder irgendwann einfach einen Punkt im Leben, an dem er sich beweisen kann? Wir alle müssen uns doch ständig beweisen; zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, unabhängig von Rang und Namen.
Und ich erinnerte mich daran, wie ich früher gewesen war, bevor ich Dennis begegnet war. Selbstbewusst, stark und alles andere als dumm. Obendrein gab es eine Person in diesem Haus, die wollte, dass ich blieb. Ilona Wilms glaubte an mich, auch wenn sie dies lediglich aus purer Verzweiflung tat. Aber sie sah etwas in mir, das sie hoffen ließ und das baute mich auf.
Noch während ich durch die Tür in den nächsten Raum trat, wusste ich, was zu tun war. Mit zwei Dingen würde ich anfangen. Erstens: Ich musste mich bei Frau Beck entschuldigen, sobald sich mir die Gelegenheit dazu bot. Und zweitens: In Zukunft würde ich zu allen Mahlzeiten pünktlich sein.
Wie angewurzelt blieb ich stehen. Ich hatte die Küche gefunden und augenblicklich verschlug es mir den Atem. Eine solch große und reichhaltig ausgestattete Küche hatte ich noch nie gesehen. Maßanfertigung, kein Zweifel. Die hellgrauen Schränke und Vitrinen reichten bis zur Decke, das Waschbecken war übergroß, aus schwarzem Granit, die Arbeitsplatte aus Echtholz. Diverse Einbaugeräte, vom Steinofen über die Mikrowelle zum Backofen; hier gab es alles. In der Mitte des Raums stand ein Küchenblock mit Theke und zwei Hockern. In die Arbeitsfläche war ein Induktionskochfeld eingelassen, das keine Wünsche mehr offenließ. Darüber war eine großzügig gestaltete Dunstabzugshaube mit Messingreling angebracht, an der zwei Paar Ofenhandschuhe baumelten. Daneben hing ein Gestell von der Decke herab, an dem messingfarbene Töpfe und Pfannen aufgehängt waren und auf dem diverse Siebe und Metallschüsseln standen. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass man in dieser Küche vom Apfelschäler bis zur Zitronenpresse alles finden würde.
Mit der leeren Tasse in der Hand fühlte ich mich in diesem Raum wie verloren. Tee. Wo finde ich jetzt den Tee? Gab es hier Beutel, wie ich sie kannte, oder musste ich nach einer Metalldose und einem Teeei suchen? Wenigstens den Wasserkocher sah ich auf Anhieb. Aber alles andere?
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte eine dunkle Stimme zu meiner Linken.
Erschrocken fuhr ich herum, die Tasse in meinen Händen klirrte. Der Löffel rutschte vom Rand des Untertellers und fiel metallisch klirrend auf den grau marmorierten Steinboden.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken«, sagte der Mann und erhob sich von einer Sitzecke.
Ich war von dieser überwältigenden Küche derart abgelenkt gewesen, dass ich die Nische nicht gesehen hatte. Der Fremde hob den Löffel vom Boden auf und hielt ihn mir entgegen. Da erkannte ich, dass er der Mann war, den ich am Morgen vom Fenster aus zusammen mit Frau Beck gesehen hatte.
»Marcel Beck«, stellte er sich vor und legte den Kopf leicht schräg.
Ich nahm den Löffel entgegen und bemerkte, dass meine Finger leicht bebten.
»Und Sie sind?«, fragte er.
»Hannah … Hannah Abel.«
»Guten Tag, Hannah Abel«, sagte er und streckte seine Hand aus.
Zögernd legte ich meine Hand in seine, ließ aber sofort wieder los, als hätte ich mich daran verbrannt.
Sein offener Blick verriet keine Regung. Er sah mich an, schien in meinem Gesicht zu forschen. Augenblicklich überkam mich das Gefühl, als könne er in mir lesen wie in einem offenen Buch.
Die Sekunden verstrichen, schließlich sagte er: »Also, Hannah Abel, wie kann ich Ihnen helfen? Sie sehen etwas verloren aus.«
»Ich …«, setzte ich an, wandte mich wieder der Küche zu und musterte zweifelnd die zahlreichen Schränke und Schubladen. »Eigentlich wollte ich Frau Ockenfels eine Tasse Tee machen, aber …«
»Verstehe.« Er ging an mir vorbei zum Wasserkocher und reichte ihn mir. »Dann fangen wir mal damit an.«
Während ich ihn an der Spüle füllte, beobachtete ich, wie er eine Schranktür öffnete.
»Hier befindet sich Tee aus aller Herren Länder. Soweit ich weiß, bevorzugt die alte Helene vormittags den guten alten Gabalong«, sagte er und nahm eine bunte Metalldose heraus, die mit Druckbuchstaben beschriftet war. Auf dem Etikett war zu lesen: GRÜN, Gabalong. Dann holte er ein kleines Holzkästchen heraus, öffnete es und legte es neben die Dose. Darin sah ich ein kleines Thermometer auf einem blauen Satinkissen liegen. Anschließend öffnete er eine Schublade und entnahm ihr einen kleinen Löffel und ein Teeei.
Ich begann zu ahnen, dass es sich hier um eine halbe Wissenschaft handelte und gestand mir ein, dass ich ohne Marcels Hilfe vermutlich gleich in das nächste Fettnäpfchen gestolpert wäre. Ich stellte den Kocher auf den Kontaktsockel. »Ok«, sagte ich und legte den Schalter um. »Und was jetzt?«
Er öffnete einen weiteren Schrank und nahm eine frische Tasse heraus. Lächelnd hebelte er den Deckel von der Dose. »Ein Löffel auf eine Tasse«, sagte er und füllte den Tee um. »Wenn es eine Kanne sein soll, etwa ein Liter, dann nehmen Sie vier bis fünf.«
Neben das Waschbecken deutend, gab er an: »Die Spülmaschine ist dort.« Also ging ich und verstaute Helenes schmutzige Tasse darin.
Während wir warteten, bis das Wasser aufgekocht war, begann er ein lockeres Gespräch, das mir zwar wie ein kleines Verhör vorkam, aber nicht unangenehm war. Mir war, als zeige er echtes Interesse an mir. Ich beantwortete ihm seine Frage nach meiner Herkunft, wie meine Anreise war und wann ich hier eingetroffen sei. Erst als er wissen wollte, was mich an dieser Anstellung hier reize, zögerte ich. Was sollte ich sagen? Ich konnte nicht über meine Vergangenheit sprechen. Erst recht nicht mit einem Fremden, einem Mann. Mir war nicht entgangen, dass er den Abstand bemerkt hatte, den ich tunlichst aufrechterhielt. Mindestens eine Armlänge. Alles andere war mir zu nah. Er hatte nichts gesagt, auch nicht versucht, ihn zu verringern. Im Gegenteil. Vielleicht wunderte er sich darüber, möglich, aber er schien das zu respektieren. Er stand da, eine Hand auf der Ablage, mir zugewandt und sah mich fragend an.
Das Klicken des Kochers rettete mich. Ohne zu antworten, deutete ich darauf und sagte stattdessen: »Das Wasser ist fertig.«
Sein Zögern war kaum merklich, doch es entging mir nicht. Er wandte sich ab und öffnete den Deckel des Kochers. Dann nahm er das Thermometer zur Hand und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Für den Gabalong brauchen wir etwa achtzig bis neunzig Grad«, erklärte er. »Nach dem Kochen sind es zwischen fünfundneunzig bis hundert. Das nimmt man für schwarzen Tee. Ungefähr eine Minute später haben wir Grüntee-Temperatur.« Als es so weit war, nickte er, maß mit dem Thermometer nach, zählte stumm einige Sekunden und goss schließlich das Wasser in die Tasse. Erneut warf er einen Blick auf seine Uhr.
Exakt zwei Minuten später zog er das Teeei heraus und legte es auf eine bereitgelegte Serviette. »Fertig.«
»Woher wissen Sie so viel über Tee?«, fragte ich ihn und nahm die mir gereichte Tasse mitsamt Unterteller entgegen.
»Von meiner Mutter«, antwortete er knapp, räumte alle Gegenstände an ihren Platz und ging dann hinüber zur Sitzecke.
Demnach war Marcel Beck also der Sohn der Haushälterin. Ich schätzte ihn auf etwa Ende zwanzig, vielleicht Anfang dreißig, jedoch keinesfalls älter. »Sie arbeiten auch hier?«, fragte ich weiter.
Ohne zu antworten, nahm er seinen Parka von der Stuhllehne und zog ihn über.
Stirnrunzelnd sah ich ihm zu. Seiner Kleidung nach zu urteilen könnte er … »Der Gärtner?«
Marcel Beck raffte die Zeitung vom Tisch, in der er zuvor gelesen hatte, rollte sie zusammen und steckte sie in die Innentasche. Als er sich zu mir umgedreht hatte, huschte ein undefinierbares Lächeln über seine Lippen. »Na dann«, sagte er einfach. »Bis bald, geheimnisvolle Hannah Abel.« Ohne auch nur im Ansatz auf meine Fragen eingegangen zu sein, wandte er sich ab und ging hinaus.
Verwirrt stand ich da mit Helenes Tasse Tee in der Hand, deren Inhalt bereits begann, kalt zu werden. Was war denn das? Warum hat er meine Fragen ignoriert?, sann ich über die Situation nach und setzte mich in Bewegung. Noch während ich zurück zum Wintergarten ging, wirbelten die Gedanken in mir wild umher. Und überhaupt, was soll das heißen: geheimnisvolle Hannah Abel? Wieso geheimnisvoll? Er hat nicht gemerkt, dass ich ihm ausgewichen bin. Ich schüttelte den Kopf. Doch, das hat er auf jeden Fall gemerkt. Der Mann scheint mir sehr aufmerksam zu sein. Natürlich hat er es gemerkt. Und deshalb hat er nicht geantwortet. Weil ich auch nicht geantwortet habe. Ich schnaubte. Aber was geht ihn das an? Ich muss das nicht erzählen. Ich kenne ihn doch gar nicht …
Abrupt blieb ich stehen. Ich war inzwischen an meinem Ziel angelangt. Der Wintergarten war lichtdurchflutet, der Schaukelstuhl stand an seinem Platz, der Beistelltisch daneben, aber Helene – die alte Dame war fort.
Im Hintergrund hörte ich das leise Quietschen der Salontür. Ilona Wilms steuerte auf mich zu und lächelte. »Hannah«, sagte sie und ihre Stimme klang erfreut. »Hast du doch noch gut geschlafen? Ich habe mir gedacht, es tut dir wohl, wenn ich dich heute ausschlafen lasse.«
»Ja, danke«, sagte ich und setzte zögernd hinzu: »Ich fürchte nur, Frau Beck war nicht so glücklich darüber. Sie sah verärgert aus.«
»Ach was«, sagte Ilona und winkte ab. Verschwörerisch zwinkerte sie mir zu und sagte in gesenktem Tonfall: »Sie bekommt sich schon wieder ein. Sie ist ohnehin immer leicht verdrießlich. Lohnt sich nicht, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.« Sie senkte ihren Blick und deutete auf den Tee in meiner Hand, dann schmunzelte sie. »Sieht nach dem guten alten Bring-mir-noch-einen-Tee-Trick aus.«
»Trick?« Verdutzt sah ich sie an. War ich schon wieder auf Helene reingefallen?
Ilona schnaubte amüsiert. »Meine Großmutter weiß genau, dass sie nur eine Tasse Gabalong bekommt. Der senkt den Blutdruck. Eine Tasse ist gesund, zwei nicht. Nicht für sie jedenfalls. Also wenn du möchtest, darfst du ihn gerne trinken.«
Kopfschüttelnd musterte ich die sanft grünlich schimmernde Flüssigkeit, hob dann die Tasse an meine Lippen und probierte einen Schluck. Der Geschmack war weich und wider Erwarten überhaupt nicht bitter. Der Unterschied zu Tee aus dem Beutel, wie ich ihn kannte, hätte größer nicht sein können. Erstaunlich.
Ilona hatte mich beobachtet und lächelte immer noch, als ich sie schließlich nach Helene fragte. »Wo ist sie jetzt?«
»Oh, zurück in ihrem Zimmer.« Ilona drehte das Handgelenk und sah auf ihre Uhr. »Ich habe sie eben hochgebracht. Für gewöhnlich sitzt sie jetzt an ihrem Sekretär und schreibt Briefe oder Tagebuch. Je nach dem, was ihr gerade in den Sinn kommt. Gegen zwölf Uhr dreißig wird ihr das Mittagessen serviert. Sie wird davon essen wie ein Spatz und wenn wir Glück haben, dann lässt sie den Rest auf dem Tisch stehen, bis es abgeräumt wird.«
»Und wenn wir Pech haben?«
Ilona lachte. »Dann wirst du eine verdrießlich dreinblickende Frau Beck sehen, die Putzutensilien nach oben trägt. Du tust gut daran, ihr dann aus dem Weg zu gehen.«
»Zählt so was denn nicht in Zukunft zu meinen Aufgaben?«
Ilona runzelte die Stirn. »Deine Vorgängerinnen haben das nicht getan, aber wenn du das übernehmen möchtest …«
Ich nickte, auch wenn der Gedanke daran mich schaudern ließ, da ich vermutlich Helenes Zorn ausgesetzt sein würde. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir jedoch, dass ich mir vielleicht auf diese Art den Respekt der alten Dame verdienen würde. Davon abgesehen könnte es mir eventuell helfen, auch mit der Haushälterin gut auszukommen. Also sagte ich: »Es scheint mir nur fair zu sein, Frau Beck zu entlasten.«
»Gut«, sagte Ilona und klang erfreut. »Dann wäre das geklärt.« Ilona wandte sich um und strich ein Kissen glatt, bevor sie sich auf der überdimensionierten Ledercouch niederließ. Sie deutete auf einen bequem wirkenden Sessel zu ihrer Rechten zum Zeichen, dass ich mich ebenfalls setzen sollte. Dann fuhr sie fort: »Mal sehen, was haben wir noch …« Sie spielte nachdenklich mit ihrer feingliedrigen Halskette.
»Gegen zwei wird Großmutter etwa eine Stunde schlafen. Ich empfehle dir, kurz vorher nach ihr zu sehen und nachzufragen, ob sie noch etwas wünscht. Zweifellos wird sie das verneinen, wie ich sie kenne.«
»Alles gut durchgeplant«, stellte ich fest, setzte mich und stellte die Teetasse auf den Salontisch. »So läuft jeder Tag?«
Ilona nickte. »Jeder, ohne Ausnahme.«
»Auch sonntags?«, hakte ich nach.
»Du spielst auf den Kirchgang an?«
Ich nickte.
»Hm, wie soll ich sagen? Meine Großmutter hält nicht viel von solcherlei Institutionen, seit sie sich in den sechziger Jahren mit dem damaligen Pfarrer angelegt hat. Stell dir vor, sie hat ihn am Ende des Hauses verwiesen und ihm verboten, je wieder einen Fuß auf dieses Grundstück zu setzen. Und ich betone: Seine zukünftigen Nachfolger schloss sie eindeutig mit ein. Als vor zwei Jahren der derzeitige Pastor vorsprach, bekam sie einen Tobsuchtsanfall und schüttete ihm kurzerhand einen Eimer schmutziges Putzwasser über den Clergyman. Ihre Schimpftirade konnte man bis Remagen hören, das schwöre ich.«
»Sie waren dabei?«
Ilona Wilms nickte lachend und sagte: »Es war ein Fest. Sie hätten das Gesicht des armen Teufels sehen sollen.«
Interessante Wortwahl, dachte ich. Einen Pfarrer als Teufel zu bezeichnen zeigte deutlich, wie Frau Wilms zu dem Thema stand. Zumindest wusste ich nun, worüber ich mich möglichst nicht unterhalten sollte. Gut, das fiel mir nicht sonderlich schwer, da ich selbst den Religionen dieser Welt nur wenig Interesse entgegenbrachte.
Wir unterhielten uns noch eine ganze Weile über die Gepflogenheiten in Haus Ockenfels, was mich wirklich brennend interessierte. Alles würde ich mir nicht merken können, aber sobald ich in meinem Zimmer war, würde ich mir Notizen machen. Abläufe, die Helene betrafen. Zeiten, an denen das Essen serviert wurde, Teezeiten. Ich war fest entschlossen, das hier durchzuziehen. Egal wie.