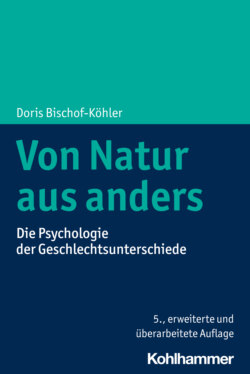Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Androgynie
ОглавлениеAuch in den ersten Versuchen, Geschlechtsunterschieden wissenschaftlich durch Fragebogenerhebungen auf die Spur zu kommen1, war man davon ausgegangen, dass maskuline und feminine Merkmale bipolar auf einer einzigen Dimension liegen und sich daher gegenseitig ausschließen ( Abb. 1.1). Je weniger weibliche Eigenschaften eine Person aufweist, umso mehr männliche sollte sie auf sich vereinen und umgekehrt.
Diese Position wurde aber auf die Dauer unhaltbar. Es fanden sich zwar Merkmale, die ein Großteil der Frauen als typisch für sich reklamierte; die Männer fühlten sich dann aber keineswegs durch das Gegenteil dieser Eigenschaft adäquat charakterisiert, sondern besetzten mehr oder minder unbefangen die gesamte Bandbreite von »trifft auf mich genau zu« bis »trifft überhaupt nicht zu«, mit einer natürlichen Häufung im Bereich mittlerer Ausprägung. Entsprechendes galt für typisch männliche Merkmale.
Abb. 1.1: Eindimensionale Skala
Daraus ließ sich nur der Schluss ziehen, dass Maskulinität und Femininität unabhängige Merkmalsgruppen sind, die sich nicht strikt widersprechen, sondern kombiniert werden können. Statt einer einzigen hat man demnach zwei Achsen zu unterscheiden, deren eine durch die Pole »männlich-unmännlich«, die andere durch »weiblich-unweiblich« zu charakterisieren sind. Ursprünglich wurde angenommen, dass diese Achsen völlig unabhängig voneinander sind, was dann graphisch durch ihre orthogonale Anordnung auszudrücken wäre. Inzwischen hat sich gezeigt, dass zwar keine Identität, aber wohl doch eine gewisse Verwandtschaft zwischen weiblich und unmännlich einerseits, männlich und unweiblich andererseits besteht, so dass die Achsen heute meist in obliquer Anordnung dargestellt werden ( Abb. 1.2; Reinisch et al., 1991).
Abb. 1.2: Zweidimensionale Skala
Auch in diesem Falle hat man statt einer bipolaren eine Vier-Felder-Anordnung. Personen rangieren nur noch dann als »feminin«, wenn sie viele feminine Merkmale und zugleich niedrige Werte in Maskulinität aufweisen. Entsprechendes gilt spiegelbildlich für die Zuweisung zur Gruppe »maskulin«. Zusätzlich gibt es nun noch Personen, die sich in Bezug auf sowohl Maskulinität als auch Femininität unternormal einschätzen. Diese werden meist, nicht sehr treffend, als »undifferenziert« bezeichnet; niemand interessiert sich sonderlich für sie. Das Gegenteil gilt für die letzte Gruppe, die laut Selbstbeurteilung sowohl typisch männliche als auch typisch weibliche Merkmale in sich vereint. Diese wird nach einem Vorschlag von Sandra Bem als »androgyn« bezeichnet (Bem, 1974) und in sie wurde anfangs die Hoffnung gelegt, zukünftig als Standard psychischer Gesundheit zu gelten. Um nicht neue Geschlechterrollen zu entwerfen, ging Bem bald einen Schritt weiter und postulierte, das Ideal der Androgynie sei nicht auf einzelne Individuen, sondern auf die ganze Gesellschaft anzuwenden (Bem, 1981). Nur so könne sie vom Diktat der Geschlechterrollen befreit werden.
Bem arbeitete mit einem Geschlechtsrolleninventar, das jeweils 20 eher männliche, eher weibliche und eher geschlechtsneutrale Merkmale enthielt ( Tab. 1.2). Die Probanden hatten sich selbst auf einer siebenstufigen Skala einzuschätzen, die von »nicht oder nahezu nie zutreffend« bis zu »immer oder fast immer zutreffend« reichte.
Tab. 1.2: Beispiele aus dem Geschlechtsrolleninventar von Bem
eher zu Männern passendzu beiden Geschlechtern passendeher zu Frauen passend
Spence (Spence et al., 1974) konzipierte ungefähr um die gleiche Zeit ebenfalls einen ähnlichen Fragebogen zur Messung geschlechtsspezifischer Merkmale. Sie unterschied nur zwei Skalen, die sie mit den Symbolen F und M belegte. Zusätzlich versuchte sie die beiden Klassen auch noch inhaltlich zu identifizieren, und zwar die maskuline Skala durch das Stichwort »Instrumentalität«, die feminine durch »Expressivität«. Diese Charakterisierung entspricht aber wohl mehr dem Bedürfnis, eine einigermaßen politisch korrekte, d. h. wertfreie, Etikettierung zu finden, als dass sie wirklich als inhaltlich adäquat überzeugt.
Tab. 1.3: Beispiele aus dem Geschlechtsrolleninventar von Spence
M-Skala (Instrumentalität)F-Skala (Expressivität)
Die Bedeutung dieser Studien wird vornehmlich darin gesehen, dass sie durch einen eleganten Kunstgriff erlauben, den Kuchen gleichsam zu essen und zu behalten: Auf der einen Seite wird die im Volksmund unausrottbar verwurzelte Unterscheidung »typisch weiblicher« von »typisch männlichen« Eigenschaften aufgegriffen und beibehalten, auf der anderen aber von der schicksalhaften Bindung an das biologische Geschlecht gelöst. Wenn eine Person von Genetik und Anatomie her eine Frau ist, braucht sie deshalb noch längst nicht auch psychologisch feminin zu sein; ihr steht das ganze allgemeinmenschliche Wertspektrum offen. Wieso jene Merkmale aber überhaupt noch als »feminin« und »maskulin« apostrophiert werden, wieso man nicht wirklich konsequent nur noch etwa von »Instrumentalität« und »Expressivität« spricht, entzieht sich dann leicht der weiteren Reflexion.