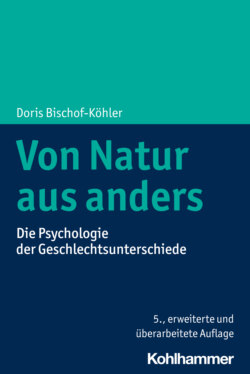Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.7 Ein Perspektivenwechsel
ОглавлениеDie Kontroverse hatte danach noch ein bedenkenswertes Nachspiel. In einer Buchveröffentlichung von 1998 hat sich Eleanor Maccoby, inzwischen emeritiert, noch einmal ausführlich mit dem Thema befasst und ihre Annahmen von 1974 erheblich revidiert. Von ihrer damals vertretenen Ansicht, die Geschlechter würden sich nur unwesentlich unterscheiden, ist dabei nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen befasst sie sich nun eingehend mit den Unterschieden, die sie vor allem in der Gruppenstruktur, in den Interaktionsmustern, in Konfliktbewältigungsstrategien und im Spielverhalten lokalisiert. Sie sieht in ihnen die Erklärung für die durchgängig beobachtbare und im frühen Alter bereits einsetzende Geschlechtertrennung, einem Phänomen, dem sie weite Partien ihres Buches widmet (Maccoby, 2000). Was die Ursachenanalyse betrifft, so problematisiert sie die Annahme einer ausschließlichen Sozialisiertheit von Geschlechtsunterschieden und zieht neben kognitiven Faktoren auch eine biologische Mitverursachung ernsthaft in Erwägung, wobei man allerdings ihrer Diktion anmerkt, wie schwer ihr dieser Schritt fällt. Umso bemerkenswerter sind ihr Versuch eines Neuzugangs und die Erweiterung ihrer Perspektive.
Mit diesem Perspektivenwechsel steht Maccoby übrigens nicht allein. Auch andere, zum Teil durchaus feministisch orientierte Forschende, die ursprünglich davon ausgegangen waren, die Annahme geschlechtstypischer Verhaltensunterschiede hätte keine reale Basis, haben inzwischen ihre Einstellung revidiert. Alice Eagly, eine der prominentesten amerikanischen Genderforscherinnen, kennzeichnet 1995 die in den 70er Jahren auf feministischer Seite dominierende Überzeugung, Geschlechtsunterschiede seien so unbedeutsam, dass man sie vergessen könne, als unzutreffend und kontraproduktiv (Eagly, 1995). John Williams und Deborah Best, deren Forschungsabsicht es ursprünglich gewesen war, die Nicht-Existenz von Geschlechtsunterschieden nachzuweisen, gelangten aufgrund einer kulturvergleichenden Studie über Geschlechtsstereotype zu der Einsicht, dass diese nicht wegzuleugnen seien, und diskutieren in diesem Zusammenhang durchaus auch biologische Ursachen (Williams & Best, 1990; s. auch Lippa, 2010). Diane Halpern, die davon ausgegangen war, dass kognitive Geschlechtsunterschiede nicht existierten und diesbezügliche Berichte auf Untersuchungsartefakten, Fehlern und Vorurteilen beruhten, kam nach Sichtung der gesamten einschlägigen Literatur zu dem Ergebnis,
»es gibt tatsächlich und in manchen Fällen sogar erhebliche Geschlechtsunterschiede in einigen kognitiven Fähigkeiten. Sozialisationspraktiken sind dafür zweifelsohne wichtig, aber es gibt auch gute Hinweise, dass biologische Geschlechtsunterschiede eine Rolle spielen.« (Halpern, 2012, S. 87; Halpern et al., 2007)
Solche Einsichten haben inzwischen in Form populärer Bestseller auch die breite Öffentlichkeit erreicht und um Erkenntnisse des Kalibers bereichert, Frauen »könnten nicht einparken« und Männer seien »vom Mars«. Nun erweisen sich diese Elaborate in ihrer kruden und wenig fundierten Argumentation aber als ausgesprochen kontraproduktiv. Dies nicht nur, weil sie unzutreffende Vorstellungen über Ausmaß und Ursachen von Geschlechtsunterschieden in ihrer Leserschaft hervorrufen, sondern vor allem auch, weil sie durch undifferenzierte und einseitige Annahmen über die Wirkung der Veranlagung antibiologischen Vorurteilen erneut Nahrung geben. So beklagt Sylvia Jahnke-Klein in einem Artikel im Handbuch zur Mädchenpädagogik, in dem es um Mädchen und Naturwissenschaften geht, dass »biologische Begründungsansätze « in der öffentlichen Diskussion immer wieder viel Aufmerksamkeit erfahren. Und dann führt sie als einziges Beispiel eben das Buch des Ehepaares Pease an (»Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«), das sie offensichtlich als repräsentativ für den biologischen Ansatz erachtet, denn sie kommt ohne Umschweife zur einer pauschalen Aburteilung: »Wissenschaftlich haltbar ist meines Erachtens keiner dieser biologischen Erklärungsansätze« (Jahnke-Klein, 2010, S. 248) (man beachte die Mehrzahl!). Wenn sie anschließend den »biologischen Begründungsmuster[n]« einen »gravierenden Denkfehler« unterstellt, weil es der überlappenden Verteilung von Fähigkeitskurven zwischen den Geschlechtern angeblich nicht Rechnung trage, dann besteht der gravierende Denkfehler vielmehr darin, sich wohl nie ernsthaft mit seriösen biologischen Ansätzen befasst zu haben. Aber auch Versuche einer differenzierteren Replik wie die von Claudia Quaiser-Pohl und Kirsten Jordan (»Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken – und Männer ihnen dabei Recht geben«) beschäftigen sich weniger mit einem biologischen Ansatz und mehr mit dessen populärwissenschaftlichen Karikatur (Quaiser-Pohl & Jordan, 2004). Dass die Autorinnen zudem selbst voreilige Schlüsse ziehen, zeigt schon der Titel des Buchs: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keine Untersuchung darüber, wie es um die Fähigkeiten zum Einparken bei Frauen und Männer bestellt ist.
Bei dieser Grundstimmung verwundert es nicht, dass das Pendel neuerdings wieder in die andere Richtung ausschlägt. Eine Studie von Janet Hyde trägt denn auch den bezeichnenden Titel »Die Hypothese der Geschlechterähnlichkeit« (Hyde, 2005). Hydes Zusammenstellung von 46 Übersichtsarbeiten zu verschiedenen psychologischen Bereichen läuft auf die These hinaus, dass die meisten in der Populärliteratur behaupteten Geschlechtsunterschiede keine oder nur eine schwache empirische Basis hätten. So haben vor ihrem kritischen Blick lediglich Unterschiede in der Aggression, der Sexualität und der Motorik Bestand. Wenn man ihre Übersichtstabellen allerdings genauer anschaut, stellt man fest, dass dort noch etliche weitere Unterschiede wie beispielsweise in Fürsorglichkeit, Durchsetzungsorientiertheit und räumlichem Vorstellungsvermögen angeführt sind, auf die dann aber in der zusammenfassenden Diskussion nicht Bezug genommen wird, obwohl sie ebenfalls ein statistisches Gewicht aufweisen. Hyde hat Untersuchungen mit eindeutigen Unterschieden bei ihrer Bilanz offensichtlich nicht berücksichtigt, wenn nicht sämtliche Studien in diesem Bereich zu einem vergleichbaren Ergebnis kamen. Dies trägt der Tatsache nicht genügend Rechnung, dass Ergebnisse je nach der verwendeten Methodik variieren können. Es macht zum Beispiel einen erheblichen Unterschied, ob ein Befund durch direkte Beobachtung oder aber nur über eine Befragung erhoben wurde, und durch den Einsatz bestimmter Tests können unterschiedliche Aspekte einer Fähigkeit angesprochen werden. In solchen Fällen ergibt die Mittelung der Ergebnisse wenig Sinn, aber man kann dadurch natürlich Geschlechtsunterschiede zum Verschwinden bringen (kritisch zu Hyde s. auch Guimond, 2008).
Die Autorengruppe um Ethan Zell hat sich der Hypothese der Geschlechterähnlichkeit ebenfalls angenommen und alle Meta-Analysen (s. Kasten »Meta-Analyse«) zum Thema Geschlechtsunterschiede zusammengefasst. Sie kommt zum Ergebnis, dass über alle Bereiche hinweg durchaus Geschlechtsunterschiede vorhanden sind (Zell et al., 2015). In neueren Arbeiten erkennt Hyde auch an, dass die Bereiche in denen Geschlechtsunterschiede auftreten doch zahlreicher sind, als sie anfangs angenommen hat,
»Die Hypothese der Geschlechterähnlichkeit lässt Ausnahmen zu der generellen Regel zu: Diese Ausnahmen sind […] mentale Rotation, die Persönlichkeitsdimension Liebenswürdigkeit/Tender Mindedness, Sensation Seeking, Interesse an Dingen und Menschen, körperliche Aggression, einige Bereiche der Sexualität (Masturbation und Konsum von Pornographie) und Einstellung zu unverbindlichem Sex.« (Hyde, 2014, S. 392)
Da Hyde weitere Bereiche ausspart, in denen Geschlechtsunterschiede bekannt sind, beispielsweise beim kindlichen Spiel ( Kap. 8), wird die Liste der vermeintlichen Ausnahmen in Zukunft wohl noch länger werden.