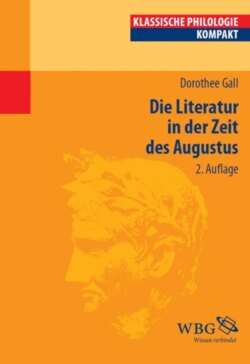Читать книгу Die Literatur in der Zeit des Augustus - Dorothee Gall - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX. Historiographie
ОглавлениеDie römische Geschichtsschreibung hat ein ähnliches Schicksal erfahren wie die römische Tragödie: Von ihrer reichen Produktion in den Jahrhunderten der Republik sind zahlreiche Werktitel, Autorennamen und Fragmente überliefert, aber nur wenige Werke besitzen wir ganz oder in auch nur annähernd repräsentativen Auszügen.
Annalistik
Die Anfänge römischer Historiographie sind geprägt von der annalistischen Struktur der Priesterchroniken, fortlaufenden Jahresberichten, in denen einige Angaben wie die Jahreszahl, die Namen der Konsuln und Militärtribunen, der wichtigsten Beamten und Priester verbindlich wiederkehren. Annalistik mit literarischem Anspruch setzt in Rom mit dem in griechischer Sprache schreibenden Fabius Pictor gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. ein, wird aber auch in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. noch praktiziert. Die Intention der Historiker liegt nicht zuletzt in der politischen Propaganda: Sie rechtfertigen Roms Expansion, indem sie die militärische und moralische Überlegenheit der Römer hervorkehren und Rom eine weltpolitische Aufgabe zuweisen.
Zeitgeschichte und historische Monographie
Die alternative Form der Zeitgeschichte (historia), die nicht die gesamte Spanne römischer Geschichte umfasst, sondern nur einen abgeschlossenen Zeitraum thematisiert, ist zuerst für die Zeit nach Sulla bezeugt: Coelius Antipater (geboren um 175) beschränkt sich auf die Zeit des Zweiten Punischen Krieges, Sempronius Asellio (etwa 160–90 v. Chr.) schreibt mindestens 14 Bücher Res gestae oder Historiae nur über seine eigene Lebenszeit. Das früheste erhaltene Werk dieser Gattung sind Sallusts Historiae. Hier ist wohl auch das Bellum Punicum des L. Arruntius einzuordnen, von dem nur spärliche Fragmente erhalten sind.
Die historische Monographie, die ganz auf die Form der Annalistik bzw. Chronik verzichtet und ihr Thema in einer Person oder einem Ereignis findet, ist ebenfalls in zwei sallustischen Schriften, De coniuratione Catilinae („Über die Verschwörung Catilinas“) und Bellum Iugurthinum („Der Krieg gegen Iugurtha“), erhalten. Diese Untergattung sucht aus der Fülle der Ereignisse die bedeutenden und repräsentativen aus und entwickelt ihre Genese; sie stellt die Motive und Charaktere der handelnden Personen dar; sie strebt nach literarisch anspruchsvoller Form und Sprache und setzt sehr bewusst rhetorische Mittel wie Bilder, Vergleiche, Allegorien und symbolische Motive ein.
Römische und universale Geschichtsschreibung
Am Niedergang der Geschichtsschreibung in augusteischer Zeit trug nach dem Urteil der Historiker Tacitus (hist. 1,1) und Dio Cassius (53,19,1–5) die politische Unterdrückung die Schuld, die keine Orientierung an der Wahrheit mehr erlaubte. Eine wichtige Rolle spielte aber sicherlich auch die neue politische Struktur des römischen Großreiches, die die traditionelle an der Stadt Rom orientierte Geschichtsschreibung zu einer antiquierten Form machte. Dieser Entwicklung trugen die Historiae Philippicae des Pompeius Trogus Rechnung, eine 44 Bücher umfassende Geschichte des nichtrömischen Raumes, deren Schwerpunkt der Autor im Makedonenreich ansiedelt. Sein Werk ist in der Spätphase augusteischer Herrschaft oder schon unter Tiberius entstanden; es bietet ganz bewusst eine Ergänzung zu der auf die römische Geschichte konzentrierten Historiographie des Livius. Erhalten ist es nur in einem bedeutend verkürzenden Auszug, dessen Autor den Namen Iustinus trägt.
Geschichte der Bürgerkriege
T. Labienus, der auch als hochbegabter Redner galt, verfasste ein Geschichtswerk, das wegen seiner politischen Tendenz – Labienus gab sich offen als Pompeianer zu erkennen – verbrannt wurde. Asinius Pollio, der im Bürgerkrieg Feldherr Caesars und Marc Antons gewesen war, zog sich nach der Niederlage von Actium ins Privatleben zurück und verfasste neben Tragödien eine Geschichte der Bürgerkriege der Jahre 60 bis mindestens 42 (Schlacht bei Philippi). All diese Werke sind uns bestenfalls in einigen Zitaten oder Auszügen bekannt; im 1. Jahrhundert n. Chr. und auch später noch wurden sie aber viel gelesen und benutzt.
Livius
Auch das umfangreiche Geschichtswerk des Livius ist nur in Teilen überliefert. Ab urbe condita, „Von der Gründung der Stadt“ bis in seine eigene Zeit zeichnet er die Geschichte Roms nach. In Sprache und Stil konservativ, steht Livius in der inhaltlichen Erfassung und Wertung auf der Höhe seiner Zeit: Ab urbe condita deutet die römische Geschichte im Sinne augusteischer Teleologie – als einen von Rückschlägen bedrohten, durch persönliches Versagen wiederholt verzögerten und zurückgeworfenen, aber von den tapferen und tugendhaften Patrioten der Vergangenheit immer wieder neu angetriebenen Entwicklungsprozess, der seinem Zielpunkt entgegenstrebt, der augusteischen Herrschaft.