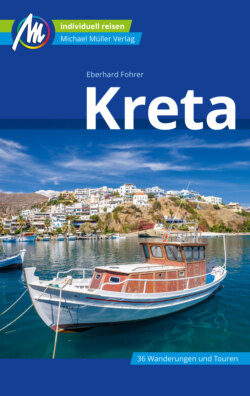Читать книгу Kreta Reiseführer Michael Müller Verlag - Eberhard Fohrer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеÖstlich von Iráklion
Durch unattraktive Außenbezirke und im weiten Bogen vorbei am Flughafen und einem großen Militärgelände kommt man auf der Old Road zu den Badestränden Karterós und Amnissós. Sie gehen fast ineinander über und sind nur durch ein felsiges Kap getrennt, wo man eine bedeutende Ausgrabung gemacht hat (→ Kasten).
Von der Stadt sieht und hört man hier nichts mehr, ein Felsrücken und der Flugplatz liegen dazwischen. Dafür sind die Silhouetten der einschwebenden Urlauberjets samt dazugehöriger Geräuschkulisse „eindrucksvoll“. Landschaftlich bietet die Region wenig - eine teils landwirtschaftlich genutzte Ebene ohne Flair, zwei Durchgangsstraßen, felsige Phrygana- und Distelöde. Einen Ort im eigentlichen Sinn gibt es nicht.
Insel Día: Naturreservat und antike Fundstätte
Die Iráklion vorgelagerte, kahle und unbewohnte Felseninsel ist mit 5 km Länge und 3 km Breite nach Gávdos die zweitgrößte der Inseln um Kreta. Sie ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen, aber auch archäologische Schutzzone, seit der französische Ozeanforscher Jacques-Yves Cousteau in der großen Bucht Ágios Geórgios im Südwesten minoische Hafenanlagen und versunkene Schiffe entdeckt hat. Im 10. Jh. n. Chr. nutzten die Byzantiner Ágios Geórgios als Hafen, um von hier aus die Rückeroberung Kretas von den Sarazenen zu beginnen. Ob Schiffsausflüge angeboten werden, ändert sich von Jahr zu Jahr. Mögliche Abfahrtshäfen sind Iráklion, Goúves und Liménas Chersonísou.
Strand von Karterós
Relativ wenig besuchter Strand, der nur punktuell gepflegt wird. Ein kleiner Fluss mündet am westlichen Strandbeginn ins Meer. Ein Stückchen weiter liegt der „Akti Beach Club“, das Strandbad von Iráklion. Bus Nr. 7 hält vor der Tür.
Kirche der Heiligen Ioánnis und Níkonos: Von Iráklion kommend passiert man an der Old Road gleich am Strandbeginn dieses selten schöne Kirchlein. Unter einem überhängenden Felsdach ist sie in den Berg getrieben und mit eleganten Bögen den Formen des Berghangs angepasst. Hohe Eukalyptusbäume überschatten das Ganze, abends ist die Front erleuchtet, im dämmrigen Inneren fungiert das rohe Felsgestein als Decke.
Die beiden Namenspatrone sind Johannes der Täufer und ein christlicher Märtyrer, der während der frühen Christianisierung Kretas von den Römern enthauptet wurde. Doch eigentlich erbaut wurde die Kapelle, um an eine tragische Episode aus dem kretischen Freiheitskampf zu erinnern. Nicht weit von hier hatten sich Ende des 19. Jh. 200 kretische Männer, Frauen und Kinder in einer abgelegenen Höhle vor den Türken versteckt. Sie wurden entdeckt und an Ort und Stelle ermordet. Die Bedeutung des Platzes erkennt man daran, dass sich viele Vorbeifahrende bekreuzigen.
Das Heiligtum des Zeus in Amnissós
Strand von Amnissós
Dieser Sandstrand schließt sich östlich des Kaps von Paleochóra an, wo Ruinen der Hafenstadt Amnissós gefunden wurden (→ Kasten).
Beherrschend ist das große Minoa Palace Hotel, an mehreren Stellen werden Wassersportmöglichkeiten, Liegestühle und Sonnenschirme angeboten, am Ostende gibt es eine bekannte Fischtaverne.
Anfahrt/Verbindungen Eigenes Fahrzeug, die Old Road führt meist nahe an der Küste entlang, Beginn am Venezianischen Hafen von Iráklion. Wer es eilig hat, nimmt die weiter landeinwärts verlaufende New Road Richtung Ágios Nikólaos und kann an mehreren Abfahrten zum Meer abzweigen. Westlich von Goúrnes treffen Old und New Road zusammen.
Bus, Linie 7 fährt ab Eleftherias-Platz zu den Stränden, Haltestelle beim Kiosk gegenüber vom Hotel Astoria Capsis. Im Strandbereich gibt es mehrere Haltestellen, man muss von der Old Road allerdings noch ein Stück hinunterlaufen.
Übernachten **** Minoa Palace, weitläufiger Bau direkt am Strand von Amnissós. Geschmackvoll ausgestattet, kühle Halle mit Marmor, großer Infinity Pool mit Poolbar. Über viele Reiseveranstalter, auch all inclusive. Tel. 2810-380404, www.akshotels.com.
** Prince of Lillies, einfaches, familiengeführtes Hotel am Strand von Kárteros, 10 Autominuten vom Flugplatz, von den Flugzeugen hört man aber nur wenig. 38 Zimmer, gute Taverne, schöner Garten mit Pool, Kinderspielgeräte. Strand in der Nähe, Busstation ebenfalls. Geeignet, wenn man einen frühen Flieger erreichen will. DZ ca. 40-70 €. Tel. 2810-381645, www.princeoflillies.gr.
Essen & Trinken Parasiris, alteingesessene Fischtaverne am östlichen Strandende von Amnissós, große Terrasse mit lichtblauen Stühlen und Vorbau direkt am Strand. Bezüglich Qualität gemischte Leserkommentare. Tägl. 12-24 Uhr. Tel. 2810-380151.
Grotte der Eileithýia (Spílio Eileithýia): Die Höhle liegt links unterhalb der Straße nach Episkopí, etwa 1,5 km landeinwärts der Old Road, kurz hinter einer scharfen Kurve (beschildert). Sie gilt als eins der ältesten bekannten Heiligtümer auf Kreta. Bereits seit der Jungsteinzeit wurde sie über 3000 Jahre lang (!) von den verschiedensten Religionen als Kultstätte genutzt. Der Höhlenschlund ist etwa 10 m lang und besitzt eine tief nach unten gewölbte Decke. Vielleicht wegen ihrer gebärmutterartigen Form verehrten die Minoer hier die große Muttergöttin, in mykenischer Zeit war sie der Eileithyía geweiht, der Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Geburtshilfe. Zahllose schwangere Frauen kamen hierher, um Beistand für die Geburt zu erflehen. Heute ist die Höhle verschlossen.
Das antike Amnissós
„In der gefährlichen Bucht von Amnissós entkam er dem Sturm kaum und ankerte dort bei der Grotte der Eileithýia ...“ Schon Homer hat die windgeschüttelte Bucht gekannt, wie diese Zeilen aus der Odyssee zeigen. Aber Amnissós war bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt, wahrscheinlich wegen eben jener berühmten Grotte, die wenige Kilometer landeinwärts an der Straße nach Episkopí liegt (siehe unten).
In minoischer Zeit war Amnissós der Hafen von Knossós. Hier erreichten die Athener Jünglinge und Mädchen Kreta, die dem Minotauros alle neun Jahren geopfert wurden (→ Geschichte), und auch sein Bezwinger Theseus soll hier an Land gegangen sein. Erst in späteren Zeiten lief Iráklion Amnissós den Rang ab, die alten Anlagen verfielen und verschlammten. Reste der Hafenstadt hat man auf dem Felsenkap Paleochóra in der Mitte zwischen den beiden Stränden Karterós und Amnissós ausgegraben (Schild „Amnissos Antiquities“). Außer überwucherten Grundmauern verschiedener Epochen ist aber nichts zu sehen, jedoch hat man einen schönen Blick auf beide Strandhälften. Westlich vor dem Kap liegt das eingezäunte Heiligtum des Zeus Thenátas, erhalten sind außerdem die ebenfalls eingezäunten Ruinen der minoischen Villa Épauli tou krínou (Villa der Lilien) östlich unterhalb des Kaps. Hier fand man zwei Lilienfresken, die zu den bedeutendsten Beispielen minoischer Malkunst gezählt werden.
Von Amnissós zur Bucht von Mália
Zersiedelte Küstenlandschaft ohne Höhepunkte. Ein Hotel nach dem anderen, bis einschließlich Mália fest in der Hand des internationalen Pauschaltourismus. Zwar wurden kilometerlange Uferstraßen mit Fußgängerpromenaden neu angelegt, doch besonders reizvoll ist das Spazierengehen nicht. Interessanter ist das Hinterland mit der Höhle von Skotinó und der Schlucht Aposelémis.
Anfahrt/Verbindungen Die Old Road zieht sich z. T. nah am Meer entlang, z. T. einige Kilometer landeinwärts, dort führen Stichstraßen zum Meer. Busse von Iráklion nach Mália fahren ab Busbahnhof alle 15 Min. von 6-22.45 Uhr, danach noch um 23, 24 und 1 Uhr (→ Mália).
Von Amnissós nach Goúrnes
Zunächst auf etwa 2 km Länge schroffe, schwarze Klippenküste ohne Bebauung. Anschließend der etwa 600 m lange und recht breite Strand von Vathianós Kámpos. Im ersten Teil beliebte Badezone, danach die große All-inclusive-Anlage „Arina Beach Resort“ (Tel. 2815-308800, www.arinabeach.gr).
Etwas weiter östlich folgt das Straßendorf Vathianós Kámpos, fast zusammengewachsen mit Kokkíni Cháni. Hier schrumpft der Strand zu kleineren Sand- und Kiespassagen, unterbrochen von längeren Klippenpartien. An der Durchgangsstraße ballen sich Autovermieter, Bars, Tavernen, Apartments und Hotels.
Mitten in dieser touristischen Zone liegen unter einem Kunststoffdach direkt an der Straße die Ausgrabungen des Mégaron Nírou, einer weitläufigen minoischen Villa aus der Jüngeren Palastzeit (1700-1450 v. Chr.), die im Aufbau den großen minoischen Palästen ähnelt. In der Villa wurden viele Kultgegenstände gefunden, darunter drei riesige Doppeläxte, die im Archäologischen Museum von Iráklion ausgestellt sind. Gegenüber liegt unterhalb der Straße ein ruhiger Strand.
Das große Spaßbad „Water City“ mit zahlreichen Rutschen, mehreren Pools, Wellenbad, Jacuzzi und zahlreichen weiteren Attraktionen liegt einige Kilometer landeinwärts bei Anópolis.
Öffnungszeiten Mégaron Nírou, nur nach telefonischer Vereinbarung Mi-Mo 8.30-15 Uhr, Di geschl., Eintritt frei. Tel. 2810-762761.
Water City, Juni bis Aug. tägl. 10-18.30, Mai u. Sept. bis 18 Uhr, Okt. bis 17.30 Uhr, Erw. 27 €, Kind 18,50 € (Online-Ermäßigung). Tel. 2810781317, www.watercity.gr).
Essen & Trinken O Manousos, Manousos und seine deutsche Ehefrau bieten in Kokkíni Cháni angenehme Atmosphäre und beste Qualität, sowohl bei den mezédes als auch bei den Menüs. Tel. 2810-762350.
To Kyma & Tzo, zwei Tavernen mit Meerblick, genau gegenüber vom Mégaron Nírou.
Goúrnes
Von der Durchgangsstraße führen Stichstraßen zur ausgedehnten Hotelzone am Meer, wo auch der einzige Campingplatz bei Iráklion liegt. Vor dem zentralen Bereich der Promenade wurde Sand aufgeschüttet, Verleih von Sonnenschirmen und Liegestühlen. Der einzige natürliche, allerdings ungepflegte Strand erstreckt sich einige hundert Meter weiter westlich vor einer ehemaligen Militärbasis der US-Air-Force. Ein großer Anziehungspunkt ist dort das große Meeresaquarium (→ Kasten).
Übernachten *** Erato, an der Old Road, 900 m vom Meer. Familiär und freundlich geführt, 32 modern eingerichtete Zimmer. gutes griechisches Essen, sauberer Pool, Busstopp vor der Tür. DZ/F ca. 40-70 €. Tel. 2810-761277, www.hotelerato.gr.
Camping Creta, der einzige Zeltplatz in der Nähe von Iráklion liegt neben dem einstigen US-Militärgelände (heute Meeresaquarium) und gehört offiziell schon zum Nachbarort Káto Goúves. Ausgedehnter, ebener Platz mit dünner Grasnarbe, Tamarisken und Mattendächern. Sanitäranlagen okay, Market, Bar und Self-Service-Restaurant. Auch kleine Bungalows werden vermietet. An der Uferstraße vor dem Gelände eine Strandbar (in der Saison Musik bis nach Mitternacht). Der Platz liegt in der Einflugschneise des Flughafens, es kann laut werden. Mai bis Sept. Tel. 28970-41400, www.cretacamping.com.
Von Goúrnes nach Liménas Chersonísou
Östlich der verlassenen US-Base kann man der neu angelegten Uferstraße folgen. Obwohl es hier nur vereinzelt schöne Strandbereiche gibt, ist ein einziger Wildwuchs von Hotels, Apartmentanlagen und „Rooms to Rent“ entstanden, der sich über Káto Goúves bis Análipsi zieht.
Análipsi: Der Touristenort zeigt sich als Miniaturausgabe von Mália (→ Link).
Cretaquarium Thalassokosmos
2005 wurde auf dem ehemaligen amerikanischen Militärgelände nah am Meer dieses moderne Meeresaquarium eröffnet, angeblich das größte im östlichen Mittelmeer. Insgesamt sind in den 60 kleinen und großen Wasserbecken mit original Meeresambiente über 2500 Fische und andere Tiere aus dem östlichen Mittelmeer zu bewundern. Die Namen der verschiedenen Spezies sind zu großen Teilen in vier Sprachen angegeben, so sieht man viele Brassen- und Barscharten, Seezungen, Seepferdchen, Seepapagei und Meerespfau, den schwarzen Schlangenstern, prachtvolle Muränen, Nashorn-, Adler- und Kaiserfisch, das giftige Petermännchen sowie verschiedene Krebsarten und sogar zwei ausgewachsene Sandtigerhaie. Ein eigenes Aquarium widmet sich der Welt der Quallen und für Seesterne gibt es sogar einen „Streichelzoo“. Besonders hervorgehoben wird die Wanderbewegung tropischer Fische vom Roten Meer durch den Suezkanal (sog. Lessepssche Migration). Fürs leibliche Wohl gibt es ein Snack-Café und ein Restaurant. Hinweis: Das Aquarium ist stark klimatisiert, warme Kleidung mitbringen!
Anfahrt Auf der Schnellstraße von Iráklion nach Ágios Nikólaos ist das Aquarium gut ausgeschildert. Linienbusse von der Busstation im Hafen von Iráklion fahren tagsüber alle 15 Min. nach Liménas Chersonísou und Mália, von der Haltestelle Nr. 9 sind es noch 500 m Fußweg in Richtung Meer.
Öffnungszeiten April bis Okt. tägl. 9.30-16.30 Uhr, übrige Zeit 9.30-16 Uhr. Eintritt ca. 10 € (Nov. bis März 6 €), 5-17 J., Stud. u. über 65 J. 6 €, bis 4 J. frei. Tel. 2810-337788, cretaquarium.gr.
Um die lange Hauptstraße, die die Uferstraße mit der Old Road verbindet, gruppieren sich zahllose touristische Anbieter. Der schmale Sandstrand ist einen guten Kilometer lang und geht in den Strand von Anissáras über (→ Link).
Tipp: Das große Strandhotel „Lyttos Beach“ vermietet Fahrräder und veranstaltet Mountainbike-Touren (www.cyclingcreta.gr).
Old Road: Wenn man von Goúrnes die Old Road nimmt, passiert man etwas westlich von Liménas Chersonísou den beschilderten Abzweig zur Lassíthi-Hochebene (→ Link).
Danach überquert die Old Road eine Kuppe und plötzlich öffnet sich der kilometerweite Blick auf die Bucht von Mália. Kurz nach der Shell-Tankstelle zweigt links die Zufahrt zum langen Sandstrand von Anissáras ab (→ Liménas Chersonísou).
Dinosauria Park: Ein Stück landeinwärts vom Cretaquarium liegt an der Old Road dieser Vergnügungspark mit etwa 60 Dinosaurierfiguren. Mit Kindern mag der Besuch interessant sein, billig ist er aber nicht, zumal alle Sonderattraktionen wie Kino und Space-Ausstellung extra kosten.
♦ Mi-Mo 10-18 Uhr, Di geschl., Eintritt ca. 10 €, über 65 J. 8,50 €, Kind 3-12 J. 8 €. Tel. 2810-332089, www.dinosauriapark.com.
Kloster Ágios Ioánnis Theólogos (Moní Ágios Ioánnis Theólogos): Bei Anópoli, etwa 3 km landeinwärts von Goúrnes, steht das Kloster aus venezianischer Zeit etwas versteckt hinter einer kleinen Anhöhe. Gegründet wurde es von Mönchen, die sich vor Piratenüberfällen von der Küste zurückgezogen hatten. Es war eins der ersten, das in den Jahren der osmanischen Herrschaft eine Schule gründete. 1896 kam es zu einem Massaker, die Türken ermordeten 40 Einwohner der umliegenden Dörfer, darunter auch Mönche, die nach Zeitzeugnissen bei lebendigem Leib auf Ikonen gelegt und verbrannt wurden. Das gepflegte Kloster wird heute von zwei Mönchen bewohnt, die große Kirche besitzt Fußbodenmosaike und Wandmalereien, eine Kapelle oberhalb davon ist vollständig ausgemalt.
Goúves
Etwa 2 km landeinwärts der Old Road liegt das alte Dorf in steiler Hanglage unterhalb eines felsigen Kaps. Im Umkreis der Kirche kann man gemütlich essen, eine schöne Alternative zur überlaufenen Küste (Parkplatz gleich nach der Kirche links).
Essen & Trinken Efcaliptus, gemütliche Taverne direkt bei der Kirche. Nur eine Handvoll Tische, leckere Fleisch- und Fischgerichte vom Grill, netter Wirt Stelios. Tel. 6946-771481.
Avli, kleine Taverne rechts oberhalb der Kirche, ebenfalls sehr gastfreundliche Atmosphäre und authentische Küche. Tel. 6936-768479.
Höhle von Skotinó(Spílio Skotinoú)
Vom Ort Skotinó führt eine etwa 2 km lange Asphaltstraße (die letzten 300 m Schotter) zur Höhle von Skotinó, in der der Archäologe Paul Faure den Ursprung für das „Labyrinth des Minotauros“ gefunden zu haben glaubte. Bereits Arthur Evans hat sie untersucht und bei Grabungen im Jahr 1962 fand man Keramikscherben, Knochennadeln und spätminoische Bronzestatuetten. In minoischer Zeit soll die Höhle einmal jährlich als Tanzplatz gedient haben.
Die Skotinó-Höhle gehört mit ihrer Tiefe von über 130 m zu den größten Kretas, ist aber touristisch nicht erschlossen. Ein befestigter Weg führt unter Pinien und Tamarisken zum Eingang, von dem der Schlund schräg nach unten abfällt. Auf weiß markiertem Serpentinenweg mit improvisierten Stufen steigt man zwischen Geröll in den vorderen Höhlenraum hinein, wo man einige Tropfsteingebilde erblickt, Tauben gurren und Wasser tropft. Weiter ins Höhleninnere sollte man nicht vordringen, es geht steil hinunter! Gutes Schuhwerk und Taschenlampe sind sinnvoll.
Oberhalb der Höhle stehen eine alte Kapelle und eine erst 2004 errichtete Kirche. Geweiht sind sie der Agía Paraskeví. Am 26. Juli wird hier der Namenstag der Heiligen gefeiert.
Schlucht Aposelémi(Farángi Aposelémi)
Die längste Schlucht in der Umgebung von Iráklion verläuft zwischen Goúves und Liménas Chersónisou in Nord-Süd-Richtung und kann durchwandert werden. Teilweise erreichen die Steilwände eine Höhe von bis zu 200 m, die Talsohle ist aber weitgehend eben, es gibt einen angelegten Weg und Holzbänke am Anfang und Ende. Streckenlänge ca. 8-9 km, durchaus anspruchsvoll, aber für jeden halbwegs geübten Wanderer machbar. Der Einstieg liegt hinter Kaló Chorió in Richtung Lassíthi-Hochebene. Man muss etwa 2 km nach dem Ort links abbiegen und passiert bald die Taverne „Xerokamares“ und eine kleine Brücke. Unmittelbar danach beginnt linker Hand der Weg (Hinweisschild).
Von Kaló Chorió aus kann man auf wenig befahrener Straße ein einsames Tal entlang in die größere Stadt Kastélli fahren (→ Link).
Bucht von Mália → Link.
Im Palast von Knossós
Hinterland von Iráklion
Iráklions hügliges Hinterland ist ein einziges Weinfeld - überall bedecken grüne Reben die Hänge, gut geschützt vor den heißen Sommerwinden aus Süden.
Von geradezu magischer Anziehungskraft ist natürlich der minoische Palast von Knossós, wenige Kilometer südlich von Iráklion. Aber auch die archäologischen Entdeckungen bei Archánes (die in Fachkreisen als Sensation gewertet wurden), das Töpferdorf Thrapsanó, das Weinstädtchen Pezá und das Kazantzákis-Museum in Mirtiá sind besuchenswert.
Die sanfte Weinlandschaft liegt eingebettet zwischen zwei Gebirgen: im Westen der mächtige Psilorítis, im Osten die steilen Hänge des Díkti-Massivs mit der berühmten Lassíthi-Ebene. Ein oder zwei ausgiebige Touren lohnen auch hier: Eine schöne Fahrt führt beispielsweise ins hoch gelegene Bergdorf Anógia, Ausgangspunkt eines Ausflugs zur Nída-Hochebene mit der Höhle Idéon Ándron, in der Göttervater Zeus aufgewachsen sein soll. Von hier aus kann man außerdem den Tímios Stavrós (2456 m) besteigen, der zusammen mit dem Páchnes im Westen der höchste Berg Kretas ist.
Knossós
Die Palastanlage der sagenhaften minoischen Könige liegt nur wenige Kilometer südöstlich von Iráklion und ist eins der bedeutendsten Baudenkmäler der Frühgeschichte.
In über 30 Jahren mühevoller Kleinstarbeit wurde das riesige Areal Anfang des 20. Jh. freigelegt - eine Trümmerwüste mit verkohlten Grundmauern, zerstörten Innenräumen und leeren Säulenstümpfen, aber von unschätzbarer Bedeutung für Archäologie und Altertumswissenschaft. Was hier tief in der Erde Kretas geruht hatte, war eine Sensation und übertraf die kühnsten Erwartungen aller Forscher: der schlagende Beweis für die Existenz einer hoch entwickelten Zivilisation lange vor der klassischen Antike Griechenlands!
Die Bronzebüste des Ausgräbers
Dass sich ein Besuch von Knossós auch für fachlich nicht vorgebildete Besucher lohnt, ist das Verdienst des Ausgräbers, Sir Arthur Evans. Mit viel Fantasie, Enthusiasmus und großer Einbildungskraft machte er aus dem Palast, was er heute ist - die wohl umstrittenste Rekonstruktion eines geschichtlichen Bauwerks, die es gibt.
Wo andere Archäologen alles peinlichst genau im Originalzustand belassen hätten, zog Evans Zwischendecken ein, vervollständigte abgebröckelte Mauern mit Beton, stellte neue Säulen auf die Stümpfe, malte die Räume mit knalligen Farben aus. Kurz, er tat alles, um wenigstens Teile des Palastes so wiederherzustellen, wie sie gewesen sein könnten. Andererseits ließ er Mauern, die nicht in sein Bild vom Palast passten, rigoros verschwinden, ja kartografierte sie nicht einmal. Vor allem dies wird ihm heute schwer angekreidet. Was Evans an strenger Wissenschaftlichkeit zu wenig hatte, hatte er zu viel an Intuition und Spekulation. So schloss er aus dem Vorhandensein einer schlichten Tonwanne gleich auf die Funktion des Raumes - natürlich ein Badezimmer. Der fehlende Abfluss störte ihn dabei nicht. Ein eingestürztes Obergeschoss (Piano Nobile) richtete er wieder völlig her - ob es wirklich jemals so aussah, wissen die (minoischen) Götter ... Jedoch muss man fairerweise berücksichtigen, dass die archäologische Wissenschaft damals noch in den Kinderschuhen steckte. So dachte Evans, er könne die kostbaren Reste der Originalräume mit Stahlbetondecken vor heftiger Sonneneinstrahlung und Regenfällen schützen. Eben dieser schwere Beton gefährdet aber heute die uralten Grundmauern durch sein Gewicht auf bedenkliche Weise.
Wie dem auch sei, Evans’ gewagte und originelle Rekonstruktionen haben jedenfalls dazu beigetragen, Knossós „attraktiv“ zu machen. Sie sind bis heute nahezu unverändert, obwohl die Wissenschaft mittlerweile vieles anders sieht - und die meisten Besucher freuen sich daran, auch wenn Knossós die zweitteuerste archäologische Stätte Griechenlands ist (nach der Akropolis in Athen).
Geschichte
Der Palasthügel von Knossós war schon während der Jungsteinzeit besiedelt - unter dem Zentralhof hat man Reste von Wohnhütten gefunden. Nach 2000 v. Chr. entstand dann der erste Palast, gleichzeitig mit den Palästen von Festós und Mália. Bereits damals muss um den Hügel herum eine größere Siedlung existiert haben.
Um 1700 v. Chr. wurden Knossós und die anderen Paläste wahrscheinlich durch ein Erdbeben zerstört, bereits um 1600 aber wiederaufgebaut - noch schöner und wesentlich größer als vorher. Die Blütezeit der minoischen Kultur fällt in diese Zeit. Knossós war der Mittelpunkt der Insel, mit seinen beiden Häfen und weit über 100.000 Einwohnern hatte die Stadt um den Palast wohl annähernd so viele Einwohner wie das heutige Iráklion! Von Knossós aus sollen der sagenhafte König Mínos und seine Nachfolger die ganze Insel und das östliche Mittelmeer beherrscht haben.
Das Labyrinth des Minotauros
Laut Arthur Evans war Knossós der Schauplatz des grausigen Mythos um den Minotauros (→ Geschichte). Imponierend in seiner Größe und Vielfältigkeit wirkt der Palast auch heute noch. Aber wie mögen ihn erst die Festlandsgriechen empfunden haben, als sie ihn nach der rätselhaften Brandkatastrophe von 1450 v. Chr. durchstöberten? Eingestürzte Lichtschächte und Mauern, lange rätselhafte Gänge, verschüttete Etagen, Treppen ins Dunkel ... Evans vermutete, dass sie ihn damals nach den zahllosen Doppeläxten (= labrys), die überall in die Wände und Pfeiler geritzt waren, „Labyrinthos“ nannten. Allmählich wurde dieses Wort gleichbedeutend mit Chaos und Irrgarten, in dem sich kein gewöhnlicher Sterblicher mehr zurechtfindet - das Wort Labyrinth war entstanden. So weit die Theorie von Evans, allerdings gibt es dagegen gewichtige Einwände und die Vermutung, dass sich das Labyrinth von Kreta ganz woanders befand (→ Link).
1450 v. Chr. bricht eine bis heute rätselhafte Katastrophe über Kreta herein, nach älteren Theorien verursacht durch einen gewaltigen Vulkanausbruch auf der Insel Santoríni, der eine ungeheure Flutwelle erzeugt, die wenig später die kretische Nordküste erreicht und furchtbare Verwüstungen anrichtet. Neuere Untersuchungen stellen den Zusammenhang zwischen Vulkanausbruch und Zerstörung der Paläste jedoch entschieden in Frage (→ Geschichte). Was auch immer die Ursache gewesen sein mag, der Palast brennt jedenfalls bis auf die Grundmauern nieder. Brandspuren sind noch heute an der Westfront zu erkennen. Anders als die übrigen Paläste wird Knossós aber zum zweiten Mal wiederaufgebaut, wahrscheinlich von den Mykenern, die damals Kreta eroberten. Aus dieser Zeit stammen auch die berühmten Linear-B-Schrifttäfelchen, die man auf Kreta nur hier gefunden hat - wahrscheinlich die älteste Form des mykenischen Griechisch. In den 1950er Jahren konnte ein Brite die Schrift entziffern (→ allgemeiner Teil/Geschichte).
Um 1400 folgt dann die endgültige Zerstörung des Palastes, vielleicht durch wieder neue Eroberer. Die Siedlung Knossós bleibt jedoch bestehen, ebenso wie ihre Häfen. Die Dorer bewohnen fortan die noch immer mächtige Stadt. Sie überdauert sogar die Besetzung durch Römer und Byzantiner, bis sie im 9. Jh. n. Chr. von den Sarazenen zerstört und geplündert wird. 1271 wird sie erstmals urkundlich erwähnt und ist mit Unterbrechungen bis heute bewohnt.
Die Ausgrabungen
Das Vorhandensein einer mächtigen Stadt Knossós war schon lange bekannt. Homer hatte in seiner Odyssee von ihr als Hauptstadt Kretas und Sitz des sagenhaften Königs Mínos berichtet. Aber den uralten Mythen hatte jahrhundertelang niemand Glauben geschenkt - bis der deutsche Hobbyarchäologe Heinrich Schliemann Ende des 19. Jh. auf Grund seiner Homer-Studien Troja fand und mit seinen Ausgrabungen in Mykéne und Tíryns das Vorhandensein einer glänzenden Kultur lange vor der Zeit des „Klassischen“ Hellas bewies.
Schliemann war es schließlich auch, der dem Palast von Knossós auf der Spur war. Auf dem Hügel von Kephála, nahe bei Iráklion, sollte Knossós auf Grund der Überlieferung liegen. Hier waren auch schon eine Menge Funde gemacht worden - der Besitzer des Geländes, der kretische Kaufmann Minos Kalokairinos, hatte schon seit 1878 Probegrabungen vorgenommen und dabei mächtige Tonpithoi und Steine mit Steinmetzzeichen entdeckt. Aber die damaligen türkischen Behörden unterbanden die Ausgrabungen. 1886 kam Schliemann nach Iráklion und wollte das ganze Gelände kaufen. Der geforderte Kaufpreis erschien ihm jedoch zu hoch, zumal er skeptisch war, was den Fundort anging. Da er außerdem alle Funde den griechischen Behörden hätte abliefern müssen, reiste er ab - und beging damit den größten Fehler seiner Laufbahn!
1894 kam Arthur Evans nach Knossós. Er war der Sohn eines vermögenden Altertumsliebhabers, finanziell unabhängig und ein begeisterter Hobby-Archäologe. Sein besonderes Interesse galt eigenartigen Siegelsteinen mit merkwürdigen, nie gesehenen Schriftzeichen, die er bei einem Antiquitätenhändler in Athen entdeckt hatte. Auf die Frage, woher er diese Steine habe, antwortete ihm der Händler: „Aus Kreta.“ Auf Kreta angelangt, entdeckte Evans die rätselhaften Schriftzeichen auf den verschiedensten Zufallsfunden auf der ganzen Insel. Vor allem aber bemerkte er, dass viele Frauen in ländlichen Gegenden diese uralten, durchlochten Siegelsteine um den Hals trugen. Jetzt war sein Interesse gänzlich geweckt. Als er sah, was auf dem Hügel Kephála gefunden worden war, witterte er seine Chance. Er erwarb einen Teil des Geländes und sicherte sich damit das Recht, ein Veto gegen jegliche Ausgrabungen von anderer Seite einzulegen. Vier Jahre später verließen die Türken Kreta und er konnte das gesamte Gelände kaufen.
Im März 1900 begannen die Ausgrabungen. Noch im selben Monat wurde ihm klar, dass ein ganzes System von Gebäuden unter der Hügelkuppe ruhen musste. In seinem Tagebuch notierte er: „Nichts Griechisches, nichts Römisches finden wir hier - vielleicht eine einzige Scherbe unter zehntausenden Bruchstücken viel älterer Keramik. Nicht einmal Vasenfragmente aus der geometrischen Zeit (7. Jh. v. Chr.) - ein blühendes Knossós muss hier mindestens in frühmykenischen Zeiten existiert haben!“
Am 5. April die erste Sensation - zwei Stücke eines Kalkfreskos kommen zum Vorschein. Der erste „Minoer“ ist entdeckt: bronzefarbene Schultern, dichtes, schwarz gelocktes Haar, unnatürlich enge Taille - der „Rhytonträger“ aus dem Prozessionskorridor ist heute im Archäologischen Museum von Iráklion zu sehen. Am 13. April die nächste Überraschung: Ein anfangs als „Badezimmer“ angesehener Raum entpuppt sich als großes Kultbad. Daneben wird ein großer rechteckiger Raum entdeckt, der an drei Seiten von steinernen Bänken und kunstvollen Farbfresken eingerahmt ist. Vor allem aber steht hier ein kunstvoll gefertigter Thron aus Alabaster - 2000 Jahre älter als jeder andere Thron Europas! Kein Zweifel: Der Thronsaal des Mínos und seiner Nachfolger ist entdeckt, das innerste Zentrum des Palastes!
Der monumentale Südeingang des Palastes
Weitere spektakuläre Funde folgen - das große Treppenhaus im Ostflügel, anschließend die weiträumigen Königssuiten, der gepflasterte Zentralhof und immer wieder prächtige Fresken. Vor allem aber stoßen Evans und seine Mitarbeiter ständig auf Stierabbildungen auf Fresken, auf Siegelsteinen, als Skulpturen. Am bedeutendsten ist das großartige Stierspringer-Fresko, das einen jungen Mann beim Salto über einen anstürmenden Stier zeigt (Arch. Museum von Iráklion). Der rätselhafte Stierkult rückt damit in den Mittelpunkt des Interesses. Waren diese todesmutigen Springer vielleicht die athenischen jungen Männer und Frauen, die dem Minotaúros jedes Jahr zum Fraß vorgeworfen wurden? Oder waren es Akrobaten, die hier zirkusähnliche Schauspiele vor versammeltem Hofstaat vorführten? Hing der Stiermythos mit den häufigen Erdbeben der Region zusammen, versuchten die Minoer mit den Spielen, die unterirdische Gottheit, die Erdmutter, zu besänftigen? Fragen über Fragen, die bis heute nicht geklärt sind ...
Allmählich erkennt Evans, was hier auf ihn wartet, nämlich die vollständige Ausgrabung und Rekonstruktion eines der bedeutendsten Paläste der Frühgeschichte. Dazu kommen die Registrierung der Funde sowie die Erforschung und Datierung der bisher fast unbekannten minoischen Kultur. Über 30 Jahre verbringt Evans mit diesen gewaltigen Aufgaben - und verwendet einen Gutteil seines Vermögens dafür. Ob archäologische Gesellschaften oder der englische Staat so viel Mittel und Enthusiasmus aufgebracht hätten, mag bezweifelt werden. Architektonisch entpuppt sich der Palast als Juwel, denn über 1200 Räume legen Evans und seine Leute im Lauf der Jahre frei. Ein Höhepunkt wird die Entdeckung des schon erwähnten großartigen Treppenhauses, das zu den Königsgemächern hinunterführt.
Aber mit der Freilegung der Mauern, die Jahrtausende unter Erdmassen verborgen waren, kommen erst die eigentlichen Probleme. Zur Konstruktion des Palastes von Minos war nämlich viel Holz verwendet worden. Schwere Balken hatten große Mauermassen getragen, teilweise dem heutigen Fachwerk ähnlich. Dazu kamen die zahllosen Säulen, die ebenfalls aus Holz waren - Zypressenstämme, mit der Wurzel nach oben, nach unten sich verjüngend. Alle diese Holzteile waren im Feuersturm von 1450 v. Chr. verbrannt worden. Die spärlichen Reste waren durch Feuchtigkeit und Luft längst verfault. Kurz, der ganze Bau drohte zusammenzustürzen und die zahllosen Wunder der Minoer unter sich zu begraben.
Evans und sein Architekt versuchen alles - erst nehmen sie hölzerne Pfosten und Balken, aber diese verfaulen viel zu schnell. Dann versuchen sie es mit Backsteinmauern und sorgfältig eingepassten Steinsäulen - aber das wiederum ist zu teuer (sogar für Evans). In den 20er Jahren wird schließlich der Stahlbeton erfunden - er ist dauerhaft und stark und man kann ihn problemlos in alle Fugen und Hohlräume einfüllen. Er scheint das ideale Restaurierungsmittel zu sein. So ersetzen die Ausgräber alle ehemaligen Holzteile durch Beton und bemalen ihn noch dazu hellbraun, um das Holz zu imitieren. An vielen Stellen im Palast sieht man noch heute diese Betonfassungen.
Am schwierigsten wird die Rettung des großen Treppenhauses. Um den drohenden Zusammensturz zu vermeiden, müssen die unteren Stockwerke mit soliden Betonfundamenten abgestützt werden, dazu muss noch eine ganze Wand aus der Schräglage wieder in die Senkrechte gerückt werden.
Aber Evans will mehr: eine anschauliche, für das Auge interessante Rekonstruktion der ganzen Anlage. Keinen Trümmerhaufen, sondern das schaffen, was man sonst mit Fantasie dazudenken muss. So geht er daran, die Räume wieder mit Decken zu versehen, er lässt auf Grund der Originalfragmente großflächige Wandgemälde mit leuchtenden Farben herstellen, lässt die Schäfte der eingefügten Betonsäulen rot, die Kapitelle und Sockel schwarz bemalen u. Ä. Das „Disneyland für Archäologen“, wie es Spötter gerne nennen, nimmt seinen Anfang ...