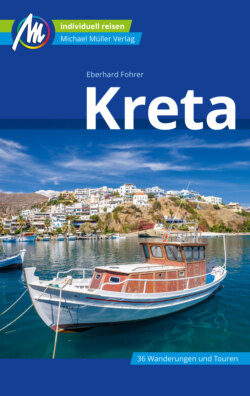Читать книгу Kreta Reiseführer Michael Müller Verlag - Eberhard Fohrer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Palast
Knossós liegt auf einer kleinen Anhöhe im weiten Tal des Kaíratos, gleich links neben der Straße, wenn man von Iráklion kommt. Vorbei an Tavernen und Souvenirshops gelangt man zum Eingang der Anlage, die man von der Westfront her betritt. Ein dichter Gürtel von Aleppokiefern versperrt den Blick auf den Palast, der mit 22.000 m2 Gesamtfläche, weit über tausend Räumen und bis zu vier Stockwerken bei weitem der größte der minoischen Paläste auf Kreta war. Völlig unbefestigt steht er da, ein Symbol für die allen Anzeichen nach gänzlich ungefährdete Stellung der Minoer - ihre Schiffe beherrschten das gesamte östliche Mittelmeer, Mauern hatten sie nicht nötig, so wird heute vermutet.
Das Grundschema des Aufbaus ist bei allen kretischen Palästen gleich: Um einen lang gestreckten, rechteckigen Zentralhof gruppieren sich die Gebäudeflügel im Viereck. In Knossós befinden sich an der westlichen Längsseite die Kulträume und Magazine, an der Rückfront (Ostseite) das große Treppenhaus, die Privaträume der Königsfamilie und Werkstätten. Fenster gibt es nur wenige, dafür wunderbar konstruierte Lichtschächte, die Luft und Sonnenlicht bis in die entlegensten Winkel des Palastes schicken - die ureigenste Erfindung der Minoer. Höchst eindrucksvoll ist auch die Kanalisation, deren modern anmutende Tonröhren und Abflussschächte man überall im Palast entdeckt.
Rekonstruktionen minoischer Fresken über dem Thronsaal
Anfahrt/Verbindungen Mit dem eigenen Fahrzeug nimmt man ab Eleftherias-Platz den breiten Leoforos Dimokratias, der direkt nach Knossós führt (etwa 6 km). Direkt am Eingang zum Palast gibt es einen großen, kostenlosen Parkplatz, eingerichtet von der Stadt Iráklion. Bereits etwa 100 m vorher wird man von der Taverne Pasiphae zum Parken in einem schattigen Olivenhain gewunken. Auch hier ist das Parken kostenlos, der Besuch der Taverne wird nicht eingefordert.
Bus 2 fährt in Iráklion von der ehemaligen Busstation am Hafen etwa alle 20 Min., er hält außerdem am Eleftherias-Platz und am Jesus-Tor. Fahrpreis einfach etwa 1,70 €, bei Kauf im Bus 2,50 €, Dauer der Fahrt im Stop-&-Go-Verkehr bis zu 45 Min.
Taxi kostet etwa 12 €.
Öffnungszeiten April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr, übrige Zeit Mo-Fr ca. 8-17, Sa/So 8.30-15 Uhr. Eintritt ca. 15 € (Nov. bis März 8 €), Senioren über 65 J. sowie Schül./Stud. und Pers. von 6-25 J. aus Nicht-EU-Ländern 6 €, freier Eintritt für Pers. bis 25 J. und Schül./Stud. aus EU-Ländern. Fotografieren und Video frei. Tel. 2810-231940.
Kombiticket mit Arch. Museum ca. 20 €, drei Tage gültig, für Schül./Stud. aus Nicht-EU-Ländern 10 € (im Winter 12 €/6 €).
Online-Ticket unter etickets.tap.gr
Freier Eintritt Nov. bis März am ersten So im Monat, außerdem 6. März, 18. April, 18. Mai, European Cultural Heritage Day (letzte Sept.-Woche) und 28. Okt.
Tipp: Am ruhigsten ist es in der Regel ab dem späten Nachmittag, da dann keine Ausflugsbusse mehr kommen. Vormittags gibt es in der HS oft Wartezeiten.
Trotz der schönen Pinien und Zypressen um den Palast ist die Anlage selbst völlig baum- und schattenlos, ein Sonnenschutz ist anzuraten.
Führungen Gruppenführungen kosten ca. 10 €/Pers. (für Stud. 5 €), Einzelführung ca. 25 €. Am Eingang wird man angesprochen, ob man sich in eine Gruppe einreihen will. Ob sich das lohnt, hängt ganz vom Führer ab.
Essen & Trinken Einige Tavernen liegen an der Straße gegenüber vom Palast, die Taverne Pasiphae passiert man kurz vorher. Abends sind alle Tavernen geschlossen.
Pasiphae, mit kostenlosem Parkplatz, 100 m vor dem Eingang zu Knossós. Interessante „minoische“ Küche, viel mit Hülsenfrüchten, kretisches Bier Charma, netter Service, nicht überteuert. Stühle mit minoischen Schriftzeichen, im Hintergrund läuft ein Video mit einer virtuellen Rekonstruktion des Palastes. Tel. 2810-323166.
Elia & Diosmos, im nahen Dorf Skaláni im Weinbaugebiet (ca. 15 Automin. ab Knossós), große Terrasse und bekannt für seine gute Küche. Tel. 2810-731283.
Kritiki gi, Alternative schräg gegenüber. Tel. 2810-731658.
Rundgangsiehe auch Karte
Bis heute orientiert sich die Interpretation der erhaltenen Bauten (Megaron des Königs und der Königin, Thronsaal, Zollstation etc.) an Evans’ Ideen - es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei aber nur um Hypothesen handelt.
Wegen Covid-19 waren 2020 interessante Teile des Palastes gesperrt. Erkundigen Sie sich ggf. vor Lösen des Tickets, man wird nicht darauf hingewiesen.
Westhof 1: Der gepflasterte Hof, den man als erstes betritt, diente vielleicht oft als Schauplatz feierlicher Kulthandlungen, denn ihn durchziehen etwas erhöhte Prozessionswege und in den drei ummauerten Gruben 2 linker Hand, „Kouloúres“ genannt, hat man Gefäße gefunden, die bei den Zeremonien verwendet wurden (andere Theorien sprechen von Getreidekammern oder Abfallreservoirs). In zwei der Gruben sind Ruinen frühminoischer Häuser aus der Vorpalastzeit zu erkennen. Außerdem stehen im Hof noch die Reste von zwei Altären 3, von denen Evans annahm, dass hier Tiere geopfert worden waren.
Westflügel: Von der Westfassade des Palastes sind nur die Grundmauern erhalten, der obere Teil und die Pfeilerstümpfe wurden von Evans rekonstruiert. Ins Innere des Palastes gelangte man an der rechten Seite der Fassade 4 auf einem heute für Besucher gesperrten Weg - eine Rundsäule stützte den Türstock, ihre Basis ist erhalten. Rechts liegen zwei kleine Räume, in denen wahrscheinlich die Torwachen saßen. Die Touristenströme werden außen herum geleitet, bis sie auf den langen Gang treffen, der wegen seiner Wandmalereien Prozessionskorridor 5 genannt wird. Mehr als 500 Figuren reihten sich hier aneinander (Reste der Fresken im Arch. Museum in Iráklion). Sein Boden ist anfangs mit weißen Alabasterplatten, grauen Schiefersteinen und rotem Mörtel nach dem mutmaßlichen Originalzustand rekonstruiert. An der dem Palast zugewandten Wegseite sind einige Originalteile erhalten. Im Weiteren geht man auf einem Holzweg zum Südpropylon. Am Südende führen Treppen hinunter zum South House 6, einem dreistöckigen Bau aus der Spätpalastzeit. Auf der südlichen Mauerkrone sieht man mächtige Kulthörner. Sie waren ein bedeutendes Symbol des minoischen Stierkults und wurden oft als Verzierungen oben auf die Palastfassaden gesetzt.
Vor dem Ende des Korridors wendet man sich nach links und kommt zum Südpropylon 7, dem monumentalen Südeingang des Palastes mit seinen meterdicken Mauern. Es besteht aus zwei Hallen mit je zwei Säulen (nur noch Fundamente vorhanden) und wurde von Evans teilweise rekonstruiert. Blickpunkt sind die großen Freskenkopien von Kultgefäßträgern, wahrscheinlich das Ende des Prozessionsfreskos, das bis hierher gereicht hat. Die betonierten Senkrecht- und Querbalken in den Mauern sollen frühere Holzbalken imitieren, die in der Art von Fachwerk den Mauern Elastizität gaben.
Über eine breite Treppe 8 gelangt man ins Obergeschoss, das sog. Piano Nobile, das völlig eingestürzt war und von Evans wiederaufgebaut wurde (Rekonstruktion sehr umstritten). Oben kommt man nach einigen Metern in einen Raum mit je drei Pfeiler- und Säulenbasen, wahrscheinlich ein Heiligtum 9. Rechts davon liegt die Schatzkammer 10 des Heiligtums. Westlich unterhalb im Erdgeschoss erkennt man einen langen Korridor 11, flankiert von 18 Magazinen 12, in denen mächtige Tonpithoi mit Wein, Öl und Getreide ihren Platz hatten. Einige sind noch im Originalzustand erhalten und stehen auch noch an ihrem ursprünglichen Platz. In die Böden sind gemauerte Kästen eingelassen - sie fungierten wahrscheinlich als „Safe“ für die wertvollsten Stücke des Palastes. Gefunden hat man allerdings nichts mehr, denn nach der großen Katastrophe wurden sie gründlich geplündert.
Rekonstruktion des Zentralhofs
Großes Treppenhaus
Ein Stück weiter nördlich im Piano Nobile befindet sich rechter Hand ein kleiner, überdachter Raum 13 direkt über dem Thronsaal (s. u.). Hier sind Kopien verschiedener Fresken untergebracht, sodass man einen Eindruck von der reichhaltigen Ausstattung der ursprünglichen Räume bekommt. In der rechten Hälfte des Raumes liegt ein mit Säulen abgegrenzter Lichtschacht - wenn man hinunterblickt, sieht man das Kultbecken des Thronsaals.
Über eine Treppe 14 gelangt man von der erhöhten Piano-Nobile-Terrasse hinunter in den Zentralhof. Gleich links neben der Treppe lagen in mehreren Stockwerken übereinander die ehemaligen Amtsräume des Palastes. Nur noch das Erdgeschoss mit dem berühmten Thronsaal ist erhalten. Heute darf man nur noch den Vorraum 15 zum Thronsaal betreten, muss dafür aber meist im Hof Schlange stehen. Durch die Füße der zahllosen Besucher ist der gut erhaltene Alabasterboden blank gescheuert, mittlerweile ist er durch einen darüber gelegten Laufgang geschützt. An der Seitenwand steht die hölzerne Nachbildung des ältesten Throns Europas. Hervorstechend ist der markante, wellenförmige Rand der Lehne, vor allem aber ist der Sitz der Körperform eines Menschen hervorragend angepasst.
Durch die Türöffnungen kann man in den Thronsaal 16 hineinsehen. Von Alabasterbänken eingerahmt steht hier der echte „Thron des Mínos“ aus der Älteren Palastzeit noch an der ursprünglichen Stelle. In der Mitte des Raumes ist ein großes Porphyrbecken erhalten, an den Wänden sind prächtige Fabelwesen aus spätminoischer/mykenischer Zeit aufgemalt - sog. Greifen mit Adlerkopf, Löwenkörper und Schlangenschwanz (sie versinnbildlichen die allumfassende Macht des Mínos im himmlischen, irdischen und unterirdischen Bereich). Auf den Bänken saßen die Priester bzw. Berater des Herrschers (vermutete Evans). Auf der anderen Seite des Saals, abgetrennt durch rekonstruierte Säulen, sieht man ein bestens erhaltenes Kultbad mit darüber liegendem Lichtschacht (Raum mit Fresken darüber). Diese Reinigungs- oder Lustrationsbecken hat man in allen minoischen Palästen gefunden, ihr genauer Zweck ist ungeklärt. Zum Baden wurden sie jedenfalls nicht verwendet, denn Boden und Wandverkleidungen sind nicht abgedichtet. Evans fand diesen Raum in chaotischem Zustand. Überall standen Kultgefäße verstreut, ein großer Ölkrug lag umgeworfen in der Ecke ... Evans Idee dazu: Versuchten hier die verzweifelten Priester in letzter Minute, schon während der großen Katastrophe, die Erdgottheit gnädig zu stimmen? Innerhalb weniger Stunden muss alles vorbei gewesen sein, der Palast ein Trümmerhaufen, der Thronsaal konserviert für Jahrtausende.
Auf der anderen (rechten) Seite der Treppe vom Piano Nobile in den Zentralhof stehen die Reste der Fassade des dreiteiligen Heiligtums 17. Es ist überdacht und kann nicht betreten werden. Hinter dem Vorraum mit Bänken erkennt man die Türöffnungen der sog. Pfeilerkrypten 18. Je ein massiver viereckiger Pfeiler steht dort in der Mitte der beiden Räume, eingeritzt sind kleine Symbole der heiligen Doppeläxte. Um die Basen der Pfeiler sind flache Gruben für das Blut von Opfertieren ausgehoben. Rechts vom Vorraum liegt im letzten ummauerten Abschnitt die Schatzkammer 19 des Heiligtums. In den rechteckigen Gruben hat man u. a. die berühmten „Schlangengöttinnen“ gefunden (Arch. Museum Iráklion).
Zentralhof: Der lang gestreckte Hof in der Mitte des Palastes diente der Belüftung und Beleuchtung der sich anschließenden Gemächer. Von seiner Pflasterung sind noch Spuren erhalten. Vielleicht fand hier neben anderen Kulthandlungen und Festen auch das berühmt-berüchtigte Stierspringen statt (→ Geschichte). Einige großartige Fresken sind erhalten, die das Gewimmel auf den Tribünen zeigen.
Großes Treppenhaus: Das überdachte Treppenhaus 20 ist der zentrale Abschnitt des Ostflügels von Knossós (s. u.) und das wohl großartigste Bauwerk des Palastes. Es ist nicht zugänglich, aber von oben kann man ein Stück weit hineinschauen. Die Treppenfluchten sind breit und ausladend, ein geräumiger Lichtschacht führt von oben nach unten und beleuchtet jedes Stockwerk. Die Absätze auf den einzelnen Stockwerken sind mit einer niedrigen Balustrade vom Lichtschacht abgetrennt, auf der wieder die rekonstruierten, leuchtend roten Säulen stehen. Eigenartigerweise bestehen die Stufen aus Alabaster, einem weichen, gipsartigen Material, das sich schnell abtritt. Diese Tatsache hat den deutschen Geologen Hans Georg Wunderlich zu seiner mittlerweile widerlegten Theorie über die Funktion des Palastes von Knossós als Totenstadt (Nekropole) geführt. Die Wände seitlich der Treppe waren wahrscheinlich mit Fresken bemalt. Weiter unten liegt die sog. Rampe der Königlichen Wache mit Fresken, die eigenartige Schilde in Form der Zahl Acht zeigen (die Aussparung in der Mitte diente der Gewichtsverringerung, noch Homer schreibt 800 Jahre später von ihnen!). Vielleicht waren hier die Wärter untergebracht, die den Zugang zu den königlichen Gemächern bewachten.
Das Megaron der Königin: luftig und lebensfroh
Südflügel: Vom großen Treppenhaus geht man über den Zentralhof in den südlichen Flügel. Im Korridor 21, der hier in den Hof führt, sieht man hinter Glas das bekannte Fresko des Prinzen mit den Lilien, heute natürlich ebenfalls eine Kopie (Original im Arch. Museum Iráklion). Es wurde so benannt wegen der schmucken Blumen- und Pfauenfedernkrone des jungen Mannes. Von hier aus steigt man, vorbei an dem Schrein der Doppeläxte 22, wo man Steinäxte und Idole gefunden hat, hinunter zu den sog. Königsgemächern im Ostflügel.
Ostflügel: Ursprünglich war er wohl fünf Stockwerke hoch - zwei Stockwerke ragten über den Zentralhof hinaus, drei weitere sind an den Rand des Hügels gebaut, der an dieser Seite steil zum Flussbett abfällt. Ein weit ausladendes, heute für Besucher gesperrtes Treppenhaus (s. o.) führt hinunter ins einstige Zentrum der Macht, wie Evans vermutete.
Hinweis: Megaron der Königin und Nebenräume, Megaron des Königs und Saal der Doppeläxte sind für Besucher gesperrt, können aber im Vorbeigehen von außen besichtigt werden.
Vom Südflügel aus erreicht man zunächst das sog. Megaron der Königin 23, das man durch die offene Fensteröffnung gut betrachten kann. Mit seinen Fresken, Ornamenten und leuchtenden Farben ist es heute zweifellos der Raum mit der dichtesten Atmosphäre - schon allein wegen des wunderschönen Delphinfreskos: dunkelblau auf hellblauem Grund, dazu Fische und stachlige Seeigel. Es besitzt eine rundum laufende Bank, außerdem mehrere Fenster und Lichthöfe an zwei Seiten. Evans empfand es als weiblich, deshalb das „Megaron der Königin“. Hier sind auch noch Evans’ frühe Holzrekonstruktionen zu sehen - und auch, wie der Zahn der Zeit daran genagt hat. Dies war der Grund, weshalb er im Weiteren ausschließlich mit Beton arbeitete.
Nebenan schließt sich ein winziges, von außen nicht einsehbares Zimmer an, nach Evans das Badezimmer der Königin! Die tönerne „Badewanne“, die hier steht, besitzt jedoch keinen Abfluss. Wunderlich hat das zum Anlass genommen, die Wanne als Sarkophag zu deuten - doch die minoischen Sarkophage hatten Abflusslöcher (zur besseren Verwesung).
Ein schmaler Gang führt in das sog. Ankleidezimmer der Königin 24, das ebenfalls nicht einsehbar ist. Und hier hat man etwas besonders Überraschendes gefunden - eine Toilette mit Wasserspülung! In der Wand gibt es eine Vorrichtung für einen hölzernen Sitz, unten ist ein Loch, das in Verbindung mit der Kanalisation steht, neben dem Sitz Platz für ein Gefäß zum Spülen. Die Röhren der Kanalisation führten zum benachbarten Fluss. Hinter der Toilette lag ein Archiv für Tontäfelchen.
Wenn man weitergeht, kommt man am Megaron des Königs 25 vorbei. Einfallsreich und charakteristisch für die minoische Bauweise ist die architektonische Gestaltung. In drei Wänden des Raumes befinden sich breite Türöffnungen. Wenn man die Holztüren öffnete, verschwanden sie fast völlig in den seitlichen Vertiefungen. Der Raum wirkte dann, als ob er nur von Säulen umgeben wäre, und muss wunderbar luftig gewesen sein. Überhaupt ist es hier im Untergeschoss schön kühl und schattig - im Sommer sicher der angenehmste Teil des Palastes. Diese sog. vieltürigen Räume findet man auch in den Palästen von Zákros, Mália, Agía Triáda und Festós.
Hinter dem Megaron liegt der Saal der Doppeläxte 26, so benannt nach den winzigen Symbolen, die in die Westwand des Lichtschachtes geritzt sind. Vielleicht war er eine Art Audienzsaal, denn an der Wand befindet sich unter Glas ein Kalksteingebilde, auf dem der Abdruck eines ehemaligen Thrones (oder Altars) erkannt worden ist.
Nördlich der Königssuiten befanden sich die ehemaligen Werkstätten. In der Steinmetzwerkstatt 27 hat man Basalt vom Peloponnes gefunden, der für die Herstellung von Siegelsteinen verwendet wurde. Nebenan lagen Töpferscheiben 28. An verschiedenen Stellen kann man im Boden Reste der Kanalisation erkennen, die noch vom ersten Palastbau stammen. Das benötigte Wasser wurde vom Berg Joúchtas aus in den Palast geleitet. Geradeaus liegen Magazine, in denen Tonpithoi mit vielen Griffen stehen 29. Nach rechts führt eine Treppe hinunter zur Ostbastion, von wo aus man zum direkt darunter liegenden Flussufer gelangen konnte (das Tor ist versperrt).
An der Treppe findet sich eins der bemerkenswertesten Beispiele minoischer Kanalisationskunst 30. An der rechten Seite der Stufen führt ein enger Kanal hinunter. Die minoischen Ingenieure haben ihn mit sinnreichen Biegungen (Parabelkurven) und Sinkbecken für mitgerissenes Erdreich so konstruiert, dass das Wasser nur halb so schnell strömt, als wenn es in gerader Linie herunterfließen würde. Außerdem kommt es unten so sauber an, dass es noch zum Waschen geeignet ist. Vielleicht lag hier die Wäscherei des Palastes.
Die Treppe wieder hinauf, gelangt man zum sog. Korridor des Schachbretts 31. Hier wurde das berühmte Spielbrett gefunden, das heute im Saal 4 des Arch. Museums zu bewundern ist. Im vergitterten Boden des Korridors sieht man wieder die modern anmutenden Tonröhren der Kanalisation. Benachbart gibt es ein Magazin 32, in dem große Pithoi mit Medaillonschmuck noch an der ursprünglichen Stelle stehen. Darüber (nicht mehr erhalten) lag ein großer freskengeschmückter Saal - vielleicht, im Gegensatz zum eher kultisch-religiös genutzten Thronsaal im Westflügel, der eigentliche Thronsaal des Herrschers, in dem die politischen Entscheidungen getroffen wurden.
Der Nordeingang
Nordflügel: Vom Zentralhof führt ein abschüssiger Korridor zum Nordeingang des Palastes 33. Links und rechts davon standen zwei hohe Bastionen, von denen Evans die westliche wieder aufgebaut hat, genannt Nordwestportikus 34. An der Wand hinter den Säulen sieht man den Teil eines rekonstruierten, aber mittlerweile stark beschädigten Relieffreskos, das vielleicht das Einfangen eines wilden Stieres zeigt. Am unteren Nordende des Korridors liegt ein großer Saal mit acht Pfeiler- und zwei Säulenstümpfen. Hier endete die Straße vom Hafen von Knossós und vielleicht diente dieser Saal zum Stapeln und Sortieren der ankommenden Waren. Evans nannte ihn Zollstation 35.
Westlich der Bastion mit dem Stierkopf ist ein weiteres (heute überdachtes) Kultbecken 36 erhalten. Es ist mit Alabaster verkleidet und war früher mit Fresken ausgemalt, vielleicht ein Reinigungsbecken für gerade angekommene Palastbesucher.
Heilige Straße: Wenige Meter nördlich vom Kultbecken verläuft die sog. Heilige Straße. Sie führte in minoischer Zeit von der „Zollstation“ Richtung Westen bis nach Amnissós, dem Hafen von Knossós. Wahrscheinlich zogen hier oft feierliche Prozessionen entlang. In ihrer Mitte verläuft eine Doppelreihe von rechteckigen Platten - so konnten hier auch Wagen bequem fahren. Unter der Straße hat man einen noch älteren Weg gefunden, er gilt als eine der ältesten Verkehrsadern Europas. Nördlich der Straße stößt man nach wenigen Metern auf das Theater 37. Um einen gepflasterten Hof erheben sich zwei rechtwinklig zueinander gebaute Stufenreihen, hier standen wohl die Zuschauer. Im Schnittpunkt der beiden Treppen war vielleicht die königliche Loge untergebracht. Der Sockel ist noch erhalten. Wahrscheinlich diente der Platz auch als Empfangs- und Versammlungsort bei kultischen Zeremonien, vielleicht sogar zeitweise als Gerichtshof. Die Heilige Straße zieht sich jetzt noch durch eine leichte Senke etwa 150 m nach Westen und endet dort an einem versperrten Tor an der Autostraße nach Iráklion. Bereits kurz hinter dem Theater führt linker Hand ein Weg zur Kasse zurück. Wer möchte, kann von diesem Weg zum Westhof abzweigen und sich noch einmal in den Palast begeben.