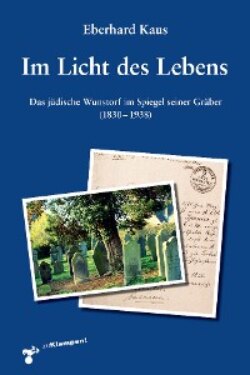Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sprache
ОглавлениеIn dem Dorf Luthe, eine halbe Stunde von Wunstorf, lebte die Familie von Leib Löwenstein, »Leibche Luthe« genannt. Auch bei hellstem Wetter ging er mit einem Regenschirm bewaffnet. Fragte man ihn nach dem Grunde, antwortete er mit etwas sonderbarem Deutsch: »Ich beabsichtige Regen!«125 (SPANIER 1937, S. 198)
Aus Meier Spaniers Darstellung wird nicht klar, ob das »sonderbare Deutsch« lediglich diese Standardantwort kennzeichnete oder allgemein für Levy Löwenstein (geb. 1804), den ältesten Sohn Abraham Löwensteins (siehe Nr. 9), charakteristisch war. Für Letzteres spricht, dass er in der Wunstorfer Gemeinde mit dem Spitznamen »Leibche Luthe« bedacht wurde. Offenbar handelt es sich dabei zumindest um den Rest eines jüdischen »Jargons«, der nach Spanier z. B. auch von Michael Goldschmidt (geb. 1809; Nr. 51) verwendet wurde:
Seine Erzählungen, immer im unverfälschten Jargon, unterbrach er auch nicht, wenn Kunden in die Werkstätte meines Vaters kamen. Der Vater machte dann wohl ein ärgerliches Gesicht, aber dem ehrwürdigen, überdies sehr empfindlichen alten Mann, den er schätzte, sagte er natürlich kein mahnendes Wort. (SPE, S. 29; RICHARZ, S. 207)
Das von der jüdischen Bevölkerung im Alltag ursprünglich verwendete Jüdischdeutsch oder Westjiddisch126 schwand seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend, hielt sich auf dem Land in Resten allerdings länger als in der Stadt. Darüber hinaus blieb es Bestandteil des Fachjargons, etwa der jüdischen Viehhändler.127 Meier Spaniers Schilderungen zeigen einerseits, dass er die genannten Sprecher als Ausnahmen empfand, und andererseits, dass der Gebrauch des Westjiddischen bzw. eines jüdischen Soziolekts, der Reste davon bewahrte, zumindest im Kontakt zu Nichtjuden von Jüngeren wie Meier Spaniers Vater Leser (geb. 1822, Nr. 50) als unpassend empfunden wurde. Da im Kontakt mit der nichtjüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert auf dem Land das Plattdeutsche noch die eigentliche Umgangssprache war und auch die westjiddischen Dialekte sich im Unterschied zu dem, was wir heute unter Jiddisch verstehen, also dem Ostjiddischen, stärker von dem Dialekt der jeweiligen Umgebung beeinflusst waren,128 kann man davon ausgehen, dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Sprache der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, von einzelnen religiösen Begriffen wie oren (»beten«), benschen (»segnen«) oder kaschern (»[Kochgeschirr etc.] koscher [im religiösen Sinn ›rein‹] machen«) abgesehen, immer mehr anglich. Im Einzelfall mögen freilich bei Zugewanderten dialektale Unterschiede erhalten geblieben sein, die sich aber nur im Fall einer zugezogenen Gruppe länger gehalten haben dürften, wie dies Fritz Goldschmidt für die Jüdinnen und Juden in Stolzenau bezeugt, von denen die Älteren sich bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts eines »frankfurterischen« Dialekts bedient hätten.129 Zumindest bei den jüdisch-deutschen Frauennamen scheint die dialektale Färbung jedoch in traditionsbehafteten Kontexten länger erhalten geblieben zu sein.130
Der Wille, sich zunehmend des von der Schule geförderten Standarddeutschen zu bedienen, war bei Angehörigen der jüdischen Minderheit sicher höher als beim Rest der Bevölkerung, da sie von der Mehrheitsbevölkerung auch nach weitgehender Verdrängung des Westjiddischen häufig pauschal mit einer ihnen eigentümlichen Sprache in Verbindung gebracht wurden.131
Was sich länger hielt als Anklänge an das Westjiddische, war die »jüdische Schrift«, d. h. die Wiedergabe des Deutschen in hebräischer (Kursiv-)Schrift, die z. B. auch Leser Spanier oder Michael Goldschmidt zuweilen verwendeten,132 und die noch 1854 auf dem Lehrplan der jüdischen Religionsschule stand (siehe dazu unten im Abschnitt »Die Schule«).
Die Kenntnisse des im religiösen Bereich vorherrschenden Hebräischen dürften angesichts der problematischen Situation in der einklassigen jüdischen Religions- bzw. Volksschule im Durchschnitt nicht sehr hoch gewesen sein. Meier Spaniers (geb. 1864) Annahme, in seiner Jugend hätten die meisten (männlichen) Gemeindemitglieder trotz ihrer ansonsten nur geringen religiösen Kenntnisse zumindest »die fünf Bücher Moses mit etwas Raschi und das Gebetbuch« übersetzen können133, dürfte in dieser Verallgemeinerung zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf das Vertrauen des Kindes in die Fähigkeiten der Eltern und gleichaltriger Erwachsener zurückgehen. Man kannte aus dem Religionsunterricht sicher die wichtigsten Textstellen und Gebete, die einmal erworbenen Sprachkenntnisse dürften, von der reinen Lesefähigkeit abgesehen, im Alltag bei den meisten jedoch weitgehend verloren gegangen sein. Eine Ausnahme stellte sicher der schon oben erwähnte Michael Goldschmidt dar, von dem es bei Meier Spanier heißt:
Er hatte im Hebräischen wohl etwas mehr gelernt als die andern und gab oft Proben seines Wissens. Die Stelle ›kilohauch haschaur‹134 (Num 22,4) wollte er aus der Anschauung erklären, ›wie der Ochse frisst‹, nämlich die Zunge nach beiden Seiten streckend, was er zu unserer Freude uns auch vormachte. (SPE, S. 29, RICHARZ, S. 207)
Wie die in Meier Spaniers »Erinnerungen« zitierten hebräischen Textstellen belegen, verwendete man, wie auch anderenorts in mittel- und osteuropäischen Gemeinden, eine Variante der aschkenasischen Aussprache, die sich durch Akzent und Vokalisierung deutlich von der sefardischen unterscheidet, die seit Reuchlin der hebräischen Schulaussprache im christlichen Bereich und weitgehend der Aussprache des heute in Israel gesprochenen Modernhebräischen (Iwrit) zugrunde liegt.135 Dabei dürfte sich auch in Wunstorf die Aussprache je nach Vorbeter und Grad der Formalität etwas unterschieden haben, wie es Werner WEINBERG für seine westfälische Heimatstadt Rheda beschreibt.136