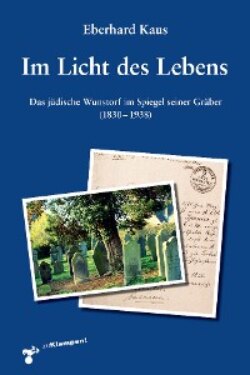Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Synagoge und Gottesdienst
ОглавлениеDie Synagoge, der »Juden-Tempel«, befand sich von ca. 1810 bis 1913 in Haus Nr. 200. 1828 erwarb die jüdische Gemeinde noch das angrenzende Haus Nr. 199 von dem zeitweiligen Gemeindevorsteher Kaufmann Samuel Moses (Spanier, s. zu Nr. 3 und 4). Beide Hausstellen lagen im Bereich der heutigen Nordstr. 14.137 Ab 1913 wurde in der neuen Synagoge, Küsterstr. 9, Gottesdienst gefeiert.
In beiden Synagogengebäuden befanden sich auch Lehrerwohnung und Schule, eine Konstellation, die in ländlichen Gemeinden des 18./19. Jahrhunderts die Regel war.138 Es war die geringe Finanzkraft der Gemeinden, die diese Multifunktionalität, vergleichbar der Verbindung von Lehrer-, Vorbeter- und Schächteramt im Personalbereich, notwendig machte. Die schlichte Fachwerkbauweise der alten Wunstorfer Synagoge, die sich häufig bei norddeutschen und hessischen Landsynagogen findet, hat ihren Grund ebenfalls in den ärmlichen Verhältnissen.139 Typisch war auch das sonstige äußere Erscheinungsbild, das sich kaum von dem eines Wohnhauses unterschied, was im Falle Wunstorfs weniger erstaunlich ist, da es sich bei beiden Synagogengebäuden tatsächlich um umgewidmete Wohnhäuser handelt.140 Das unauffällige Erscheinungsbild kann in diesem Fall daher nicht als Anzeichen für eine gewollte Abgrenzung von christlichen Kirchenbauten oder den Wunsch nach »Unsichtbarkeit« in einer tendenziell feindlichen Umgebung gewertet werden.141 Dies gilt auch für die rückwärtige Lage des eigentlichen Betraums bzw. eventuelle bauliche Ergänzungen, da diese aus Raumgründen kaum zur Straßenseite hin hätten erfolgen können.142
Über die Innenraumgestaltung der alten Synagoge gibt es nur wenige Anhaltspunkte in den archivalischen Quellen. Erwähnt wird 1858 die durch ein Geländer abgetrennte, also wohl etwas erhöht eingerichtete »Frauen-Schule«,143 eine Entsprechung zur Frauenempore der 1913 eingeweihten Synagoge in der Küsterstraße. Über deren Ausstattung gibt eine bei BURKHARDT (im Anhang) abgedruckte Skizze nähere Auskunft, die auf Karl-Heinz Heußmann, Großenheidorn, den 1922 geborenen Sohn der von ca. 1921 bis 1955 im Dachgeschoss des Hauses wohnenden (christlichen) Familie, zurückzugehen scheint.144 Danach war die Blickrichtung der Gottesdienstbesucher durch die Anordnung der Bänke nach Osten zum Toraschrein (Aron ha-kodesch) hin ausgerichtet. Dies ist die gängige Sitzordnung in aschkenasischen Synagogen und keineswegs Kennzeichen einer Reformsynagoge, wie die Autorinnen und Autoren der an der TU Braunschweig erstellten Studienarbeit zur Synagoge in der Küsterstraße annahmen.145 An der Westseite war die Frauenempore, die einen von der »Männersynagoge« getrennten Eingang hatte. Die Apsis zeigte auf blauem Grund – vermutlich weiße – Sterne. Der Toraschrein, zu dem zwei oder drei Stufen hinaufführten, bestand aus einem zweitürigen Holzschrank, der von einem roten Samtvorhang verdeckt wurde. In der Mitte des Synagogenraumes befand sich der Almemor (auch Almemar, bzw. Bema oder Bima/Kanzel für die Toralesung und das Vorbeten), über dem ein Kronleuchter hing. Der Skizze nach hing auf beiden Seiten des Toraschreins je eine Öllampe. Das »Ewige Licht« (Ner tamid), das sonst – als einzelne Lampe – meist146 vor dem Toraschrein hängt147, scheint sich hier also an dessen Seiten befunden zu haben. Vielleicht kann man dies auf Einflüsse aus Polen zurückführen, wo die Lampen allerdings eher in (gemauerten) Wandnischen angebracht wurden.148 Auf den Einfluss »polnischer Rebbes« auf die Wunstorfer Gemeinde und ihre Bräuche verweist Meier Spanier in seinen »Erinnerungen«.149 Insgesamt spricht die Raumgestaltung mit der strikten Trennung von Männer- und Frauenbereich und der zentralen Stellung des Almemors eher für eine orthodoxe bzw. konservative Ausrichtung150 der Gemeinde, und man darf annehmen, dass sie aus der alten Synagoge übernommen wurde.
Meier Spaniers »Erinnerungen« verdanken wir auch Einblicke in das religiöse Leben und die Gottesdienste der Gemeinde:
Gebetet wurde damals noch in der Synagoge an den Wochentagen morgens und abends, später (noch in meiner Jugend) Montags und Donnerstags, am Sabbathtage dreimal. (Heute ist man froh, wenn Minjan151 am Freitagabend und Sabbathmorgen erreicht wird.) […] Man passte sehr scharf auf, dass der besondere Brauch im Auslassen und Hinzufügen bestimmter kleiner Gebete genau innegehalten wurde. Selbstverständlich wurden sämtliche Pijutim152 (kein Mensch konnte die oft gekünstelte Sprache dieser religiösen Dichtungen verstehen) mit besonderer Andacht und Leidenschaftlichkeit gebetet. […] Beim Maudim- und Olenu-Gebet153 machte der Vorsteher Loewenberg154, der an den hohen Feiertagen seine Gaben für das palästinensische Grab Rabbi Meirs des Wundertätigen stiftete, eine tiefe, lang währende Verbeugung, von der ich schon in frühester Jugend den Eindruck hatte, dass sie mehr gymnastischen als religiösen Wert habe. […] Doch hatte besonders der Gottesdienst an den hohen Feiertagen, wenn die Alten in ihren Sterbemänteln155 in echter Andacht beteten, seine Weihe. Und wenn vor dem Kolnidre-Gebet156 die drei ältesten Männer der Gemeinde vor die heilige Lade traten und mit ihrer vor Alter zittrigen Stimme das Bijschiwo schel maalo157 dreimal sprachen, so war das ein Eindruck voll mystischen Erschauerns, der haften blieb.158