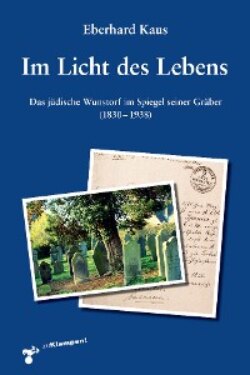Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von »Schutzjudentum« zu (eingeschränktem) Bürgerrecht
ОглавлениеStellte die Rückkehr zum diskriminierenden Sonderstatus der jüdischen Minderheit im nunmehrigen Königreich Hannover (abgesehen vom sog. Leibzoll2) eine herbe Enttäuschung aller fortschrittlichen Kräfte dar, so wirkten der Modernisierungsschub des westfälischen »Modellstaates«3 und aufklärerische Ideen von einer »bürgerlichen Verbesserung der Juden«4 doch in einem gewissen, wenn auch sehr bescheidenen Maße nach. Bereits die auf dem Wiener Kongress im Juni 1815 verabschiedete Bundesakte enthielt in Art. 16 die – vage – Absichtserklärung, die Bundesversammlung darüber beraten zu lassen,
wie auf eine möglichst übereinstimmende Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sey, und wie insonderheit denselben der Genuß der bürgerlichen Rechte gegen die Übernahme aller Bürgerpflichten in den Bundesstaaten verschafft und gesichert werden könne5.
Als die Landdrosteien im März 18286 auf Beschluss des Kgl. Kabinettsministeriums den Oberhäuptern der jüdischen Familien oder jüdischen Einzelpersonen im jeweiligen Bezirk, sofern sie ein Bleiberecht genossen, zur Pflicht machte, einen Familiennamen zu wählen, scheint dies als Zeichen eines – wenn auch im Vergleich zu anderen deutschen Staaten späten – Emanzipationswillens gedeutet worden zu sein.7 Denn in den Folgejahren nahmen die jüdischen Gemeinden – wohl zusätzlich motiviert durch die französische Juli-Revolution von 18308 und die hannoversche Verfassungsdiskussion des Jahres 18329 – ihre bereits seit 181310 immer wieder erfolglos eingereichten Petitionen auf Gewährung bürgerlicher Rechte erneut auf.11 So gehörte auch die Wunstorfer Gemeinde mit ihrem Vorsteher Moses David Spanier (Nr. 37) zu den 26 jüdischen Gemeinden, die sich 1832 auf dem Petitionsweg an die Ständeversammlung in Hannover wandten.12
In der zeitgenössischen Argumentation um rechtliche Zugeständnisse an die jüdische Bevölkerung wird, wie Albert Marx hervorhebt13, der aufklärerische Gedanke einer »bürgerlichen Verbesserung« meist zur Begründung der Beharrung auf dem Status quo verwendet, indem auf Defizite in Bildung oder Moral der »Israeliten« verwiesen wird. Diese Haltung klingt auch in der Bemerkung an, die die Ständeversammlung im Januar 1833 ihrem Schreiben anlässlich der Weiterleitung der oben erwähnten Petitionen an die Regierung einfügte und in der sie bat,
die Vorlegung des im 25sten Postscripte vom 30sten Mai v. J. verheißenen Gesetz-Entwurfs über die künftigen Verhältnisse der Israeliten möglichst beschleunigen zu wollen, damit durch das demnächst zu erlassende Gesetz die Lage der Israeliten, so weit es mit dem allgemeinen Wohle verträglich [Hervorhebung E. K.], verbessert, vor Allem aber rechtlich festgestellt und möglichst gleichmäßig, in den verschiedenen Theilen des Königreichs geordnet werde.14
Die angesprochenen Defizite wurden dabei auch von jüdischer Seite nicht in Abrede gestellt. Im Vormärz waren es besonders jüdische Intellektuelle wie der Berliner Jurist Eduard Gans (1797 bis 1839), die auf die Notwendigkeit entsprechender Anstrengungen hinwiesen.15 Im Unterschied zu manchen christlichen Politikern und Publizisten machten sie jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht ein bestimmter »Volkscharakter«, sondern der jahrhundertealte Ausschluss von Zünften, Gilden oder Grundbesitz sei, der die »typisch jüdische« Beschränkung auf (Trödel-)Handel, Geldverleih oder das – aus religiösen Gründen Juden gemeinhin gestattete – Schlachterhandwerk verursacht habe.16
Eingriffe der Regierung in jüdische Religionsangelegenheiten, wie sie mit der Neubegründung des hannoverschen Landrabbinats 1829 erfolgten, wurden daher von reformorientierten Mitgliedern der jüdischen Gemeinden durchaus begrüßt.17 Besonders die in der »Instruction für den Land-Rabbiner zu Hannover«18 vom 15. April 1831 (§ 4) verordnete Sorge für einen regelmäßigen Schulbesuch und die Verwendung der deutschen Sprache in Schule und Synagoge verhieß eine stärkere Breitenwirkung religiöser, moralischer und allgemeiner Bildung. Sie stellte neben weiteren Faktoren eine Grundlage für den im 19. Jahrhundert zu verzeichnenden erfolgreichen Aufstieg zahlreicher Angehöriger der jüdischen Unter- und Mittelschicht in das gehobene Bürgertum19 dar; ein Phänomen, das allerdings eher das städtische als das Landjudentum betroffen haben dürfte20, zu dem die Wunstorfer Jüdinnen und Juden zu zählen sind.21
Wie u. a. der am 20. März 1828 verfügte Ausschluss jüdischer Juristen von der Zulassung als Advokat22 zeigt, lag eine Emanzipation noch in weiter Ferne. Selbst das am 30. September 1842 erlassene »Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden«23 hob zwar das diskriminierende »Schutzverhältnis« (§ 5) – bei vorläufigem Weiterbestehen der daran gebundenen Zahlungen – auf, gewährte jedoch keine rechtliche Gleichstellung. Immerhin konnten Juden in ihrer Gemeinde das Bürgerrecht erwerben (§ 8) und »zünftige oder unzünftige Gewerbe gleich wie die christlichen Landeseinwohner erlernen und betreiben« (§ 51); dennoch blieben sie von politischen Rechten ausgeschlossen und unterlagen weiterhin Sonderregelungen, wie der obrigkeitlichen Genehmigung bei Niederlassung, Geschäftsgründung oder Verehelichung. Der Wunstorfer Magistrat bezog sich in seinem Bericht an die Hannoversche Landdrostei, »das Gesuch des Schutzjuden Aaron Rosenberg [Nr. 59/60] hieselbst um Erlaubniß zum Ankauf eines Hauses betreffend«, vom 31. Oktober 1842 ausdrücklich auf das jüngst erlassene Gesetz und ließ einen generellen Vorbehalt erkennen:
Wir sind im Allgemeinen dem Ankauf von Häusern durch Israeliten abgeneigt, da noch viele Bürger sich anzukaufen wünschen. Da nun der § 50 des Königlichen Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Juden vom 30sten September 1842 es rücksichtlich des Erwerbes von Grundeigenthum durch Juden bei dem bestehenden Rechte gelassen hat; so geben wir ganz gehorsamst anheim, dem Supplicanten den Ankauf eines hiesigen Hauses überhaupt hochgefälligst abzuschlagen.24
Erst 1847 wurden die nach Beseitigung des »Schutzverhältnisses« verbliebenen Zahlungsverpflichtungen aufgehoben, das Zeugnis eines Juden dem eines Christen gleichgestellt und der (beschränkte) Erwerb von Haus- und Grundbesitz gestattet.25
Für die jüdischen Gemeinden kam dem Gesetz von 1842 demgegenüber große Bedeutung zu, da es u. a. in §§ 35–49 das Synagogen-, Schul- und Armenwesen neu ordnete. So wurde nicht nur die Schulpflicht jüdischer Kinder derjenigen der christlichen gleichgestellt, sondern auch für jüdische Schulen die Anstellung geprüfter Lehrer gefordert, die in der Lage waren, neben den religiösen auch allgemeine Kenntnisse zu vermitteln, wobei Letzteres in der Anfangszeit wegen des Fehlens geeigneter Kandidaten in den Gemeinden zu Problemen führte. So kam es z. B. in Wunstorf erst mit dem Reskript der Kgl. Hannoverschen Landdrostei vom 4. September 1856 zur Einführung einer jüdischen Elementarschule.26 Ferner wurde die Stellung der Vorsteher gestärkt, die nun Verstöße gegen die Synagogenordnung im Einvernehmen mit Landrabbiner und Obrigkeit sanktionieren konnten (§ 37), und (»soweit nötig«) die Neuordnung der Gemeindebezirke verordnet (§ 35). Letzteres führte am 24. November 1843 zur (Neu-)Bildung einer Synagogengemeinde aus den Ortschaften Wunstorf und Luthe.27