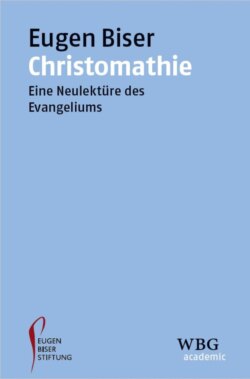Читать книгу Christomathie - Eugen Biser - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Der integrative Leser
ОглавлениеDie Antwort kann nur lauten: im Sinne dieses Doppelaspekts! Einerseits begegnet Jesus dem Leser in der Überlegenheit dessen, der die Todesgewalten dadurch bezwungen hat, daß er sich selbst aus dem Tod zu neuem Leben erhob, und der dem Leser dadurch wie kein anderer dazu verhelfen kann, den lebendigen Geist aus dem toten Buchstaben zu erwecken, wodurch er den Leseakt in eine ausgesprochen österliche Perspektive rückt. Und gerade so entspricht es der These James M. Robinsons, wonach schon die Logienquelle – und in der Konsequenz dessen erst recht die Evangelien – als das literarische Osterwunder zu gelten habe25. Dann spiegelt sich tatsächlich in jedem ihrer Sätze das Ereignis, dem sie letztlich ihre Entstehung zu verdanken haben, so daß diese Sätze nicht angemessener als im hermeneutischen Nachvollzug dieses Ereignisses gelesen werden können. Das strahlt auf die Gestalt des Retters zurück, der nun, wie es seinem hermeneutischen Aspekt entspricht, als Inbegriff aller Sinnhaftigkeit erscheint. Und damit erscheint er so, wie er von Paulus als der „für uns zur Weisheit Gewordene“ (1Kor 1,30) wahrgenommen wurde, und wie ihn die Paulusschule als denjenigen rühmte, in dem „alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind“ (Kol 2,3).
Mit dem Stichwort „verborgen“ ist die Gegenperspektive angesprochen, die den Retter als den „Verwundeten“ und Mitbetroffenen erscheinen läßt. Er kann nach Hebr 4,15 mit allen mitfühlen, weil er die Angefochtenheit des kontingenten Daseins durchlitten und ausgestanden hat und dadurch jene Mitwisserschaft erlangte, die ihn der Notwendigkeit enthob, über den Menschen belehrt zu werden. In dieser mitwissenden Nähe erweist er sich am meisten dort, wo der Mensch versucht, seine Todverfallenheit zu bewältigen, und sei es auch nur in der Form, daß er versucht, dem toten Buchstaben den lebendigmachenden Geist einzuhauchen26.
Wenn sich dieser Versuch darauf konzentriert, den toten Buchstaben des Evangeliums im Licht dessen zu lesen, der in seiner Auferstehung die Todesgewalt bezwang, ergibt sich eine einzigartige Konstellation, die zu einer Verdoppelung der Figur des Lesers führt. Zwar bleibt dieser nach wie vor der um das Textverständnis bemühte menschliche Leser des Evangeliums. Doch rückt nun der zunächst nur als Interpretament und dann als Interpret in Anschlag Gebrachte zusehends in seine Position ein, so daß sein Leseakt von jenem mitübernommen wird und er als „Funktionär“ dessen erscheint, der durch ihn das von ihm handelnde Evangelium liest. Gleichzeitig tritt dieser integrative Leseakt in einen größeren Zusammenhang, der die Selbstverständigung des Geglaubten in den Glaubenden betrifft. Wie der Glaube nach Röm 10,17 aus dem Hören kommt und dieses der Stütze der Texte und ihrer Lektüre bedarf, so ist der Leseakt umgekehrt eingebunden in das Zutun dessen, der sich des menschlichen Lesers „bedient“, um sich durch ihn über das über ihn Veröffentlichte zu verständigen. In der Interaktion mit ihm und seiner Lektüre liest der Retter somit seine eigene Geschichte, wie sie von Ohrenzeugen seiner Verkündigung und den Augenzeugen seiner Auferstehung überliefert wurde, und damit, in letzter Vereinfachung gesprochen, sich selbst.
Auf der Ebene literarischer Produktion bieten sich dafür zwei verdeutlichende Modelle an: ein erstes in Gestalt des von Marie-Émile Boismard zur Erklärung des Problems der futurischen und präsentischen Eschatologie des Johannesevangeliums eingeführten Begriffs der „relecture“, der Neulektüre, der den Gegensatz darauf zurückführt, daß der Verfasser – oder dessen Schüler – den Grundtext des Evangeliums einer späteren Nachprüfung unterzog, wodurch die Zukunftsaussage im Sinn einer präsentischen, also sich schon gegenwärtig ereignenden Wiederkunft revidiert wurde27. Die Differenz der Aussage geht somit auf eine Verdoppelung des Leseaktes zurück und wird durch diese behoben. Das zweite Modell bietet der späte Nietzsche, der – so eine Überlegung Giorgio Collis – angesichts der sich zerschlagenden Hoffnung auf die Schaffung eines systematischen Hauptwerks seine veröffentlichten Schriften einer Neulektüre unterzog, wobei er sich der eigenen Person nach Art eines Prismas bediente28. So gelingt es ihm, seinen Schriften im Mittelteil seines „Ecce homo“ unerwartete Glanzlichter aufzusetzen, die nicht unerheblich zu ihrem besseren Verständnis beitragen.
So sehr das zweite Modell durch sein Ergebnis besticht, ist doch das erste noch beweiskräftiger, vorausgesetzt, daß die Neulektüre einem Schüler des Evangelisten zuzuschreiben ist. Denn in diesem Fall handelt es sich um einen Verfasser, der sich unter Preisgabe der eigenen Identität völlig in die Person und Position des Evangelisten hineinspielte, so daß er als Autor kaum noch von diesem zu unterscheiden ist. Im umgekehrten Größenverhältnis trifft das auf die vorgeschlagene Neulektüre des Evangeliums zu: Wo sich dort der Schüler mit dem Evangelisten bis an den Rand der Selbstaufgabe identifiziert, reißt hier der Hauptautor die Kompetenz des empirischen Verfassers an sich, so daß dessen Aktivität als Folge seiner Initiative erscheint.
Der Gedanke mußte auf diese Spitze getrieben werden, weil nur so der Spielraum entsteht, innerhalb dessen das Evangelium tatsächlich aus der Sicht Jesu neu gelesen, verstanden und – worauf es besonders ankommt – zur Sprache gebracht werden kann. Aus dem Kontext ergibt sich dann unmittelbar, daß dies im Blick auf Jesu Gestalt als Retter geschehen muß. Mittelbar gilt das aber nicht weniger von seiner Gestalt als Helfer und Befreier. Dies sind jedoch nur drei herausragende Aspekte dessen, was er auf eine begrifflich und sprachlich nicht zu fassende, dafür aber einleuchtende, aufrichtende und ergreifende Weise ist.
1 R. Schnackenburg, Der Sinn der Versuchung Jesu bei den Synoptikern, in: ders., Schriften zum Neuen Testament. Exegese in Fortschritt und Wandel, München 1971, S. 101–128; L. Schenke, Die Urgemeinde, a.a.O., S. 295ff.
2 Dazu: N. Hyldahl, Die Versuchung auf der Zinne des Tempels (Mt 4,5–7/Lk 4,9-12), in: Studia Theologica 15 (1961), S. 113–127. So wurde – nach dem Bericht des Hegesipp – auch der „Herrenbruder“ Jakobus von der Tempelzinne zu Tode gestürzt (a.a.O., S. 114f; S. 125).
3 Dazu nochmals: R. Schnackenburg, Der Sinn der Versuchung Jesu bei den Synoptikern, in: ders., Schriften zum Neuen Testament, a.a.O., S. 101–128.
4 Da der Tempel bei der Eroberung Jerusalems nicht niedergerissen, sondern niedergebrannt wurde, spricht alles für die Authentizität dieser Vorhersage.
5 Dazu: E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus (1956), in: ders., Zur Frage nach dem historischen Jesus, a.a.O., S. 154ff.
6 K. Rahner, Theos im Neuen Testament, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 1, a.a.O., S. 114; dazu meine Ausführungen in: Die Suspendierung der Gottesfrage, in meinem Sammelband: Glaubensimpulse, a.a.O., S. 190f.
7 Dazu: R. Gögler, Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes, Düsseldorf 1963, S. 264; ferner: H. Merklein, Jesus, Künder des Reiches Gottes, in: ders., Studien zu Jesus und Paulus, Tübingen 1987, S. 127–156, S. 153.
8 Dazu meine Schrift: Provokationen der Freiheit. Antriebe und Ziel des emanzipatorischen Bewußtseins, München u.a. 1974, S. 24–28. <Über die Freiheit schreibt E. Biser an dieser Stelle, „daß sie das schlechthin Unverrechenbare ist, das die eingespielten Strategien durchkreuzt und […] etablierte Systeme in Frage stellt […] Kein Wunder, daß sie von den Fürsprechern einer total und universal verwalteten Ordnungswelt stets als der große Stein des Anstoßes empfunden wurde“ (a.a.O., S. 24f). Den Großinquisitor sieht Biser dabei als die „alptraumhafte Verkörperung institutionalisierten Christentums“ (ebd.).>
9 A. a. O., S. 29–57.
10 R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949, S. 207.
11 Diese Aversion tritt besonders in den abwertenden Ausführungen über die Formel „in Christus“ zutage: R. Bultmann, a.a.O., S. 184.
12 Dazu: F. Overbeck, Über die Anfänge der patristischen Literatur (1882), Darmstadt 1984; Ph. Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter, Berlin u.a. 1975.
13 Dazu der Abschnitt: Habt ihr das alles verstanden?, in meinem Sammelband: Die Entdeckung des Christentums, a.a.O., S. 76–91.
14 Darauf bezieht sich schon der Auftritt des Lieblingsjüngers, mit und in dem sich der Sterbende der Mutter übereignet (Joh 19,26f), vor allem der Appell des sich auf einen Bürgen (ekeinos) höchster Autorität berufenden Zeugen (heorakos), der den Leser gerade an dieser Stelle zum Glauben auffordert (Joh 19,35); dazu mein Jesusbuch: Das Antlitz, a.a.O., S. 26f.
15 Dazu meine Abhandlung: Die Bibel als Medium. Zur medienkritischen Schlüsselposition der Theologie, Heidelberg 1990, S. 19.
16 R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, a.a.O., S. 183f.
17 Der Gedanke der „Abbreviatur“ findet sich bei Hilarius von Poitiers, der Gedanke der „Extension“ bei Gregor von Nyssa. Gott nahm sich, so Hilarius, im Akt seiner Menschwerdung zurück und „verengte“ sich bis zu „Empfängnis und Wiege und Kindheit“, um sich der Menschheit verständlich zu machen (Zwölf Bücher über die Dreieinigkeit IX, 4, aus dem Lateinischen übs. v. A. Antweiler, BKV, 2. Reihe, Bd. 6, II, München 1933, S. 69). Im Gegenzug zu dieser Kontraktion dehnte sich Gott im Kreuz seines Sohnes aus, so Gregor von Nyssa, um in der äußersten Erniedrigung seine unverkürzte Allgegenwart zu beweisen (Große Katechese c. XXXII, 2, in: Des heiligen Bischofs Gregor von Nyssa Schriften, aus dem Griech. übs., BKV, 1. Reihe, Bd. 56, München 1927, S. 1–85, S. 64).
18 Zitiert nach: G. Ebeling, Luther, a.a.O., S. 145.
19 J. W. v. Goethe, Faust I, Studierzimmer, V. 1728f, in: ders., Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, hrsg. u. kommentiert v. E. Trunz, Jubiläumsausg., unveränd. Nachdruck, München 2010, S. 57f.
20 F. D. E. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), Sonderdr. aus: Schleiermachers Werke, hrsg. v. O. Braun, unv. Abdruck d. 2. Aufl., Leipzig 1911, S. 77.
21 F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung (1921), Frankfurt a. M. 3/1990, S. 3.
22 Von dieser furchtbaren, für ihn unannehmbaren Szene berichtet Martin Buber in: ders., Begegnung. Autobiographische Fragmente, Heidelberg 4/1986, S. 71–75, insbes. S. 72.
23 Nach johanneischer Darstellung setzt Jesus der auf ökonomische und politische Abhilfe gerichteten Erwartung der Volksmenge das Anerbieten seiner selbst als Alternative entgegen, die er durch die Einladung zum Sorgentausch und durch seine Vision des sich gewaltlos durchsetzenden Gottesreichs unterstreicht. Selbst in dieser vom vierten Evangelium aufgeworfenen Perspektive muß es bei solchen Prämissen zum Scheitern kommen.
24 <So die gleichnamige Schrift E. Bisers: Dasein auf Abruf. Der Tod als Schicksal, Versuchung und Aufgabe, Düsseldorf 1981.>
25 J. M. Robinson, Der wahre Jesus?, a.a.O., S. 21.
26 Dazu meine Abhandlung: Die Bibel als Medium, a.a.O., S. 19ff.
27 Nach R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium Teil 1: Einleitung und Kommentar zu Kap. 1–4 (Herders theol. Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 4.1), Freiburg i. Br. u.a. 2/1967, S. 57.
28 Dazu: G. Colli, Nachwort: Die Schriften von 1888, in: KSA 6, S. 447–458, S. 456; ferner meine Schrift: Nietzsche für Christen. Eine Herausforderung, Leutesdorf 2000, S. 57f.