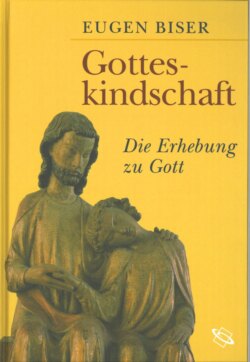Читать книгу Gotteskindschaft - Eugen Biser - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der anthropologische Weg
ОглавлениеMit der Gotteskindschaft ist einem utopischen Begriff vom Menschen das Wort geredet, der ihn nicht in seiner faktischen Verfassung begreift, sondern ihn auf seine höchsten, nur noch religiös zu begründenden Möglichkeiten hin anvisiert. Nicht umsonst setzt sich der johanneische Ausruf, wonach wir dank der uns umhegenden Liebe des Vaters Gottes Kinder nicht nur heißen, sondern sind, in den Vorbehalt fort:
Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes; doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden (1Joh 3,2).
Das setzt ein Verständnis des Menschen voraus, das zu dem der klassischen Anthropologie quersteht. Denn diese fragt seit ihrer mythischen Vorzeit mit der Sphinx des Ödipus-Mythos „Was ist das?“ und damit nach dem durch Definitionen zu fassenden „Wesen“ des Menschen. Doch das Wesen ist nach Hegel stets das „Gewesene“ und damit die „alt und grau“ gewordene Gestalt des Erfragten, die von dessen gegenwärtigem Seins- und Besitzstand bereits überholt ist60. Um diesen einzuholen, muß anders, und zwar so wie im biblischen Bericht vom Sündenfall nach ihm gefragt werden. Denn dort ergeht an den sündig gewordenen Menschen, der sich nach Buber nicht nur vor seinesgleichen, sondern vor Gott schämte und sich deshalb „unter den Bäumen des Gartens“ versteckte, die – nach Buber auch von Rosenzweig in ihrer vollen Triftigkeit begriffene – Frage: „Wo bist du?“ (Gen 3,9)61. Damit ist er nicht nur nach dem Ort seiner primordialen Geborgenheit befragt, sondern auch nach dem, wo es mit ihm letztlich „hinauswill“, also nach dem Sinn seines Lebens. Und damit ist zugleich die ganze Dimension seiner Werdemöglichkeiten aufgerissen. „Du kannst dich“, so sagt zu ihm der Schöpfer in dem Traktat „Über die Würde des Menschen“ des Renaissancephilosophen Pico della Mirandola, „in die Niederungen des Tierischen fallen lassen; du kannst dich aber auch zur Höhe des Göttlichen erheben“62.
Danach steht der auf das „Grenzgebirge der Welt“ (Novalis) entrückte Mensch am Wendepunkt zwischen der Fallstrecke, die ihn dazu verlockt, sich den desintegrativen Tendenzkräften der Gesellschaft, insbesondere der Verführung durch Propaganda, die öffentliche Meinung und die Medienszene zu überlassen, und der Sternenbahn, die ihm die Optimierung seiner selbst bis hin zur Gotteskindschaft verspricht. Dabei warnt ihn sein Existenzgewissen davor, sich fallen zu lassen und, wie ihm vielstimmig eingeredet wird, sich aufzugeben, während es ihn dazu ermutigt, den steilen Weg der „Annahme seiner selbst“ (Guardini) und der „Tugendskala“ (Johannes Climacus) zu beschreiten.
Dabei leuchtet ihm die als sein Hochbild aufscheinende Gotteskindschaft voran. Sie verdeutlicht ihm, daß er noch längst nicht das ist, was er aufgrund seiner Selbstentschließung und der sich seiner annehmenden „Liebe von oben“ (Goethe) sein kann. Und sie vermag das schon kraft der von ihr ausgehenden Faszination, erst recht aber, weil sie nach Art eines Sakraments bewirkt, was sie bezeichnet. Damit stößt das Hochbild in eine der schwersten Krisen der gegenwärtigen conditio humana, die durch den überhandnehmenden Reduktionismus, zusammen mit der alles lähmenden Resignation und Lebensangst heraufbeschworen und nur oberflächlich vom gegenwärtigen Hedonismus überdeckt wird. So kommt es zur Einebnung der gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Verhältnisse und zur Entleerung des kulturellen und personellen Ideenhimmels. Der Olymp der profilierten Leitgestalten hat sich auf erschreckende Weise entvölkert und einer „Oligarchie“ der Mittelmäßigen Platz gemacht. Die philosophische Szene hat es aufgegeben, die mit großen Lettern an die Wände der Epoche geschriebenen „Zeichen der Zeit“ (Lk 12,56) zu deuten und sich statt dessen mit narzistischer Selbstbespiegelung begnügt. Und die Theologie ist nach dem postkonziliaren Lichtblick in signifikanten Vertretern der Faszination durch die „Dunkelseite“ Gottes erlegen63.
Hinter dieser regressiven Gesamtsituation verbirgt sich allerdings ein noch gravierenderes und jetzt den Menschen unmittelbar betreffendes Problem: die sich seit der Romantik anbahnende und jetzt zu epidemischem Ausmaß angewachsene Identitätskrise. Angesichts dieser Diagnose verwundert es nicht, daß Dichtungen des kompetentesten Sprechers dieser Krise Heinrich von Kleists – wie „Die Verlobung von San Domingo“, „Die Marquise von O.“ und „Das Erdbeben von Chili“ – zu Gegenständen der heutigen Opern- und Medienszene wurden64. Zeugen der Brisanz dieser Vergegenwärtigung sind aber auch Max Frisch mit seinem „Homo faber“, Hans Erich Nossack mit seinem „Jüngeren Bruder“ und, um ein hervorragendes Musikwerk hinzuzufügen, das „dem Andenken eines Engels“ gewidmete Violinkonzert von Alban Berg65.
Der heutige Mensch ist nicht nur, wie Gustav Mahler sang, der „Welt“, sondern sich selbst „abhanden gekommen“ und einem Selbstzerwürfnis verfallen, das durch die ihm von der Konsumindustrie angebotenen Klischees und Surrogate nur notdürftig verdeckt wird. Gleichzeitig versetzt ihn die Medienszene in den Zustand einer nahezu perfekten Selbstentfremdung, die ihn hindert, sich seines Notstandes auch nur bewußt zu werden, geschweige denn Initiativen zu seiner Überwindung zu ergreifen. Ihm müßte in des Wortes tiefstem Sinn „heimgeleuchtet“ werden. Und damit begänne auch schon die von der Diagnose geforderte Therapie. Wie kein anderer Impuls könnte ihm dazu das mit der Gotteskindschaft etablierte Hochbild verhelfen. Nur müßte es, um im therapeutischen Sinn wirksam zu werden, mit apotropäischer Energie eingesetzt werden, ganz so, wie Paulus den vom Abfall bedrohten Adressaten seines Galaterbriefs das Kreuz entgegenhielt, um sie von ihrer „Verhexung“ zu befreien (Gal 3,1)66.
Das ist dann aber umgekehrt Anlaß, der Bildqualität der Gotteskindschaft auf den Grund zu gehen und sie nach ihrer Effizienz zu befragen. Davon ist zwar keine Klärung der eidetischen Implikation des Ausdrucks zu erwarten, so daß das mit ihm Bezeichnete spontan ins Bild träte und schaubar würde, wohl aber die Einsicht in seinen Überhang zu existentieller Verifizierung. Was Gotteskindschaft ist, will nicht so sehr veranschaulicht als vielmehr gelebt und getätigt werden. Die Existenz ist das Medium ihrer Sichtbarwerdung. Wer aus ihr lebt, bezeugt sie, und indem er sie bezeugt, tritt sie in ihm in Erscheinung. Gerade dafür bietet der Paulus des Galaterbriefs den sprechenden Beleg. Wenn er den Adressaten den Gekreuzigten mit beschwörender Gebärde vor Augen hält, denkt er nicht nur an die Verkündigung seines Evangeliums, sondern kaum weniger an sich selbst. Denn am Ende des Briefs präsentiert er sich definitiv als den „mit Christus Gekreuzigten“ (Gal 2,19). Er wolle sich, wie er mit großer Betonung versichert, „allein des Kreuzes Christi“ rühmen, durch das ihm die Welt gekreuzigt sei und er der Welt (6,14). Und dann, im Blick auf die ihm von seiner Tortur verbliebenen Narben, noch entschiedener:
In Zukunft falle mir niemand mehr zur Last; denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib (Gal 6,17)67.
Der Rückbezug auf die Gotteskindschaft führt über die gewagte, aber wohlbegründete Annahme Bultmanns, daß unter allen historischen Gestalten keine so sehr wie Paulus der Figur des johanneischen Lieblingsjüngers entspricht68. In diesem Fall war aber die Kunst noch hellsichtiger, sofern sie in den spätmittelalterlichen Darstellungen der „Johannesminne“ die Figur des Lieblingsjüngers aus dem Jüngerkreis herauslöste und mit Jesus zu einer geradezu symbiotischen Konstellation verschmolz69. Die Gruppe bezieht sich thematisch wie kompositionell – sie kann als Symbolfigur der „Gottesfreunde“ gelten – auf die Anrede Jesu, in der er die Jünger seine Freunde nennt (Joh 15,15); doch geht die Darstellung deutlich über die Begründung des Freundestitels „weil ich euch alles gesagt habe, was mir von meinem Vater mitgeteilt worden ist“ (ebd.) hinaus. Denn sie schließt den an die Brust Jesu wie schlafend hingesunkenen Jünger mit diesem zu einem strömenden Kreislauf zusammen. Da die geschlossenen Augen den mystischen Sinn der Gruppierung betonen, ist zum Ausdruck gebracht, daß der Jünger den ganzen Lebensstrom aus dem Herzen Jesu empfängt – hintergründig sprechen sinnverwandte Aussagen (wie Joh 7,32 und 19,34ff) mit –, während dieser durch die Hingabe des Jüngers zu sich selbst erwacht. Das aber trifft im Vollsinn nicht schon auf die Gottesfreundschaft, sondern erst auf die Gotteskindschaft zu. So gesehen hat die Gruppe als Konfiguration dieses Motivs zu gelten, die deren Ikone in Gestalt des Kindes aus Runges „Morgen“ ebenbürtig an die Seite tritt.
Das verleiht dem Ausruf „Seht doch, welch große Liebe der Vater zu uns hegt“ (1Joh 3,1) einen qualifizierten Sinn: Was das Motiv der Gotteskindschaft besagt, kann, ohne daß etwas vom Postulat seiner Tätigung zurückgenommen wird, tatsächlich geschaut und schauend wahrgenommen werden. Doch der Ausruf weist zugleich auf den Eingang des johanneischen Briefs zurück, in dem ein schwer einzugrenzendes Kollektiv den Anspruch erhebt, das „Wort des Lebens“ gehört, geschaut und mit Händen betastet und es damit Paulus in seinem akustischen (Gal 1,16), optischen (2Kor 4,6) und haptischen (Phil 3,12) Ostererlebnis gleichgetan zu haben70. Damit wird nicht nur der Aufruf zur Schau der Gotteskindschaft unterbaut, sondern zugleich die Frage nach ihrer akustischen Qualität aufgeworfen. In welchem Sinn kann sie nicht nur ersehen, sondern auch gehört und vernommen werden?
Das ist die Frage nach den Wegen transkritischer Erschließung des Schriftworts, also die Frage nach Zugängen jenseits der weithin zur Alleinherrschaft gelangten historischkritischen Methode71. Im Grunde ist diese schon durch die Wendung „Wort des Lebens“ (1Joh 1,1) überholt, weil damit nicht der neutestamentliche Niederschlag der Verkündigung Jesu gemeint, sondern dieser selbst zu deren Inbegriff erklärt und demgemäß eine auf ihn bezogene Hermeneutik gefordert ist72. Ähnliches gilt aber auch vom Schriftwort, dem die neuerdings in das Schwerefeld der analytischen Sprachtheorie geratene historische Kritik nur die informative Oberfläche, nicht jedoch die performative und mystische Tiefendimension entnimmt. Auf eine transinformatorische Sprachqualität wies aber schon Nietzsche hin, als er in einer Nachlaßaufzeichnung versicherte:
Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern Ton, Stärke, Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Worten gesprochen werden – kurz die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: alles das also, was nicht geschrieben werden kann73.
In diesem transinformativen Sinn ist das Motiv der Gotteskindschaft nicht nur (nach 1Joh 3,1) zu sehen, sondern auch zu hören. In ihm erklingt eine Musik, die ihrerseits von der Leistung dessen ausgeht, der die an ihn Glaubenden in seine Lebensgemeinschaft aufnimmt und einbezieht. Denn der Erhöhte will, wie Kierkegaard in seiner „Einübung im Christentum“ betonte, von seiner „Hoheit“ alle an sich ziehen. Um sie dazu zu bewegen, spricht er nicht nur belehrend, sondern auch bewegend und erhebend zu ihnen, so daß ihnen die Musik hinter seinen Worten hörbar wird. Wenn aber dies geschieht, ergeht es ihnen wie dem Sterbenden, dem Augustin eine erhöhte Sensibilität für die innere Resonanz des artikulierten äußeren Wortes zuerkennt:
Er hebt das Ohr zu dem inwendigen Ruf Gottes, er hört in sich den geistigen Gesang. Denn es dringt etwas durch das Schweigen zu ihm herab, so daß er, sobald er jenen Gesang vernimmt, von Ekel über die Leibeswelt befallen wird und über das ganze ihm wie ein Getümmel erscheinende Erdenleben, welches das Vernehmen dieses süßen, dieses unvergleichlichen, unaussprechlich schönen Gesanges von oben dämpft74.
Die Gotteskindschaft gehört, wie sich mit zunehmender Deutlichkeit zeigt, nicht nur zu jenen Ideen, die sich zu Idealen kristallisieren und als solche die brachliegenden Energien des Rezipienten freisetzen und für sich einnehmen, sondern die darüberhinaus auch für sich einstehen und zu sich provozieren75. Indem die Gotteskindschaft solcherart für sich wirbt, betreibt sie zugleich das Werk des Glaubens, der ebenso zu ihr hinführt wie er von ihren Impulsen lebt.