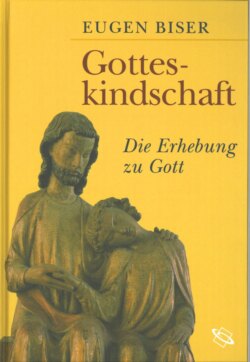Читать книгу Gotteskindschaft - Eugen Biser - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Der Vorgriff
ОглавлениеWenn dem Menschen in Gestalt der Gotteskindschaft sein eigenes Hochbild entgegentritt, konnte es nicht ausbleiben, daß sich Spuren und Hinweise darauf schon in christlicher Vorzeit, und hier noch vor den vor allem auszuforschenden alttestamentlichen Schriften schon im Mythos und der auf ihn zurückblickenden Philosophie, finden25. Dabei liegt dem Mythos die dunkle, noch ganz unreflektierte Überzeugung zugrunde, daß die Schöpfung, so sehr auch sie um Formen der Ins-Werk-Setzung weiß, ihre Existenz nicht so sehr einem schöpferischen Machtwort als vielmehr einem Zeugungsakt verdankt oder doch einem genealogischen Verhältnis zu ihrem Urheber entgegenstrebt. Darin dürfte es begründet gewesen sein, daß der Hochgott als Vater der Götter und Menschen gesehen und mit dem Vaternamen angerufen wurde. Ein profiliertes Sohnesverhältnis zu ihm hatten vor allem die als Heilbringer geltenden Halbgötter wie Herakles, Dionysos und Prometheus. Obwohl das väterliche Profil bei dem aus dem indogermanischen Gott des leuchtenden Himmels hervorgegangenen Zeus plastisch hervortrat, fehlt im Mythos das die persönliche Beziehung artikulierende Wort „Gotteskind“, das nur „gelegentlich in den Mysterienreligionen als hieratischer Titel oder als Bildwort“ begegnet (Pax)26. Während der Hochgott den von ihm erzeugten Männern „kein Erbarmen“ entgegenbringt (Schadewaldt), hat er diese Eigenschaft an seine Töchter wie insbesondere an Artemis und Athene abgetreten. Jene beschenkt ihren Liebling Hippolyt, besonders in seiner Todesstunde, mit ihrer tröstenden Nähe und Freundschaft, um sich dann im Augenblick des Sterbens jedoch von ihm abzuwenden, da ihr, der Göttin, „Tränen nicht erlaubt“ sind27. Bei Athene gewinnt die Beziehung zu dem von ihr beschirmten und immer wieder an sein besseres Selbst erinnerten Odysseus sogar eine den Horizont des Mythos übergreifende Qualität, die bisweilen wie eine antike Vorwegnahme des Verhältnisses Beatrices zu Dante wirkt28.
Wie Dietrich Rusam deutlich machte, übernimmt aber auch Philons platonische Rezeption des Mythos dessen Grundgedanken, wonach Gott als Schöpfer der Welt diese mit Einschluß des Menschen „gezeugt“ habe29. So sehr Philon zögert, den Menschen in der Konsequenz dessen „Sohn Gottes“ zu nennen (Hengel), bezeichnet er dann doch die um die Vaterschaft Gottes Wissenden als seine Kinder. Von ihrer eher pantheistischen Gottesvorstellung her kommt die Stoa zu ähnlichen Ergebnissen. Wer bedenkt, daß er Gottes Sohn ist, versichert Epiktet, kann das nicht fürchten, was Menschen ihm anhaben können. Denn wer Gott „zum Vater und Pfleger“ hat, sollte sich von Leid und Furcht frei fühlen. Wie der Zauberstab des Hermes alles in Gold verwandelt, so verwandelt der Weise kraft seiner Gottesbeziehung alles Übel in Gutes (Bultmann):
Was gilt ihm Liebesfreude, was Finsternis?
Was gilt ihm Ruhm oder Schande?
Was gilt ihm Lob? Was gilt ihm Tod?
Über all das kann er Sieger sein30.
Das klingt wie eine Vorwegnahme des Pauluswortes:
In alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hunger, in Überfluß und Entbehrung, alles vermag ich in dem, der mich stärkt (Phil 4,12).
Und doch ist es bei allem Gleichklang wegen des fehlenden Personalbezugs davon grundverschieden. Denn der Stoiker erlangt seinen Gleichmut (ataraxia) gegenüber den Wechselfällen des Schicksals aufgrund seiner Übereinstimmung (symphonia) mit dem Weltgesetz, während Paulus seinen Halt in dem findet, der für ihn zum „Leben“ geworden ist (Phil 1,21). Darin kommen ihm die Mysterienreligionen ungleich näher als die Stoa. An Isis, die mütterliche Allgottheit, richtet der Myste sein Dankgebet, das in den Worten gipfelt:
Dein göttliches Antlitz und deine allerheiligste Gestalt will ich in meiner Brust geheime Tiefe schließen, dort ständig hüten und mir vor Augen stellen31.
Der Dank, den der Myste am liebsten „mit tausendfachem Mund“ erstatten möchte, bezieht sich nicht nur auf den Schutz der Gottheit in den „Stürmen des Lebens“ und der Entflechtung der „Fäden des Schicksals“, sondern insbesondere darauf, daß er sich in ihrer Obhut als einen „Wiedergeborenen“ und „Vergotteten“ erfährt32. Mit diesem „Wandel des Existenzverständnisses“ (Bultmann) hängt es zusammen, daß im Vokabular der Mysterienreligionen der schon von der Stoa verwendete, aber naturhaft gefaßte Begriff Gotteskindschaft eine dem christlichen Verständnis angenäherte Konnotation gewinnt. Doch noch stellt sich die Frage nach der Anbahnung des Motivs in den alttestamentlichen Schriften.