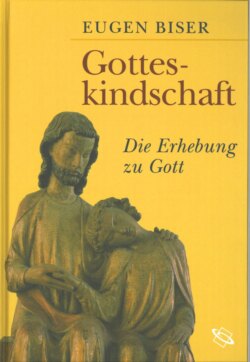Читать книгу Gotteskindschaft - Eugen Biser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die Motivgeschichte
ОглавлениеDie großen Leitmotive der Theologie erleiden im Lauf ihrer Geschichte ein dramatisches Schicksal. Wie Kometen tauchen sie aus dem Geflecht der übrigen auf, verschwinden dann wieder, gehen Verbindungen mit andern ein, verlieren an Leuchtkraft und Profil, um dann erneut und oft in verwandelter Form in den Vordergrund zu treten und alles zu überstrahlen.
Machtvoll intonierte das Motiv der dabei auf das Erlebnis seiner Neuschöpfung durch den Auferstandenen gestützte Paulus (2Kor 5,17), der im Galaterbrief das Ziel der Sendung des Gottessohns darin erblickt, „daß wir die Sohnschaft erlangten“ (Gal 4,5) und der uns im Römerbrief durch den „Geist der Sohnschaft“ zusprechen läßt, „daß wir Kinder Gottes sind“ (Röm 8,15). Wenn er dem hinzufügt: „wenn aber Kinder, dann auch Erben: Erben Gottes und Miterben Christi“ (8,17), läßt er keinen Zweifel daran, daß mit der Gotteskindschaft der Zenit des Menschseins bezeichnet und erreicht ist11.
Nur scheinbar widerspricht Paulus dem in der Korrespondenz mit Korinth, wenn er seinen Adressaten nach dem Blick in das, „was kein Auge geschaut, kein Ohr vernommen und keines Menschen Herz jemals empfunden hat“ (1Kor 2,9), vorwirft, daß er zu ihnen nicht wie zu Geistesmenschen, sondern nur wie zu Kindern reden könne, denen er anstelle der harten Kost seiner Weisheitslehre die Milch des Allgemeinverständlichen verabreichen müsse (3,1)12. Dasselbe gilt von der Klage des Hebräerbriefs über seine „schwerhörigen“ Adressaten, die immer noch mit der Milch der „Anfangsgründe“ abgespeist werden müssen, obwohl sie aufgrund ihres Alters längst Lehrer sein könnten (Hebr 5,11– 14). Denn in beiden Fällen geht es nicht um den Fortschritt von einem Anfangsstadium zum Reifezustand, sondern um die Beanstandung eines Fehlverhaltens – Streitsucht und Schwerhörigkeit –, das den Aufstieg zum Werdeziel – hier der Schau, dort der Meisterschaft – verhindert.
Eine tatsächliche Gegenperspektive eröffnet dagegen der Epheserbrief, wenn er den Zweck der unterschiedlichen Dienstleistungen darin erblickt,
daß wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Gottessohns gelangen, zur vollen Mannesreife und zum Vollalter Christi (Eph 4,13),
und wenn er das mit der Mahnung unterbaut:
Wir sollen dann nicht mehr unmündige Kinder sein, die sich durch windige Lehrmeinungen, durch menschliches Trugspiel und irreführende Verführungskünste umtreiben lassen; vielmehr sollen wir uns in jeder Hinsicht an die Wahrheit halten und in Liebe in den hineinwachsen, der das Haupt ist: Christus (Eph 4,14f)13.
Das erweckt tatsächlich den Eindruck eines allmählichen, von kindlicher Unmündigkeit zu vollem Selbstbesitz fortschreitenden Reifungsprozesses, der, wie es Paulus in seinem frühen Liebeshymnus für sich selbst in Anspruch nimmt, das Stadium des Kindseins mit seinen kindlichen Denk- und Verhaltensweisen zugunsten eines anzustrebenden Reifestadiums hinter sich läßt (1Kor 13,10)14. Wenn aber Nietzsche mit seinem Wort von dem „in sich rollenden Rad“ die Grundform des Kindseins zutreffend bestimmt, täuscht doch der Eindruck des über das Anfangsstadium hinausführenden progressiven Reifungsprozesses. Dann beschreibt dieser Prozeß vielmehr eine Kreisbewegung: die Rück- und Einkehr in den Anfang, der bereits alles enthält, in dieser Fülle jedoch erst im Rückbezug begriffen werden kann.
Wenn William Wrede mit seiner Sinnbestimmung des Lebenswerkes Jesu recht behält, wonach er seine Gottessohnschaft aufgab und Mensch wurde, „damit wir, die Menschen, Söhne Gottes werden“, ging aber der erste Anstoß zur Konzeption der Gotteskindschaft noch vor Paulus von Jesus selber aus15. Dadurch fällt auf seine Zuwendung zu den von der antiken Gesellschaft vernachlässigten Kindern neues Licht16. Auch ist in diesem Zusammenhang mit Rudolf Schnackenburg an die Rede der Synoptiker von den „Söhnen des Reiches“ zu erinnern17. Vor allem aber tritt nun die johanneische Lehre von der Gotteskindschaft in den Vordergrund. Während das Evangelium, seltener als der Brief, den Ausdruck „Kinder Gottes“ nur zweimal verwendet (Joh 1,12; 11,52), hebt es doch im Nikodemusgespräch auf die Sache mit allem Nachdruck ab. Auf den bereits erwähnten Einwand des Fragestellers antwortet Jesus:
Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen (Joh 3,5).
Angefangen mit dieser Aussage und dem Gespräch mit der Samariterin (Joh 4,13f), dem Auftritt Jesu beim Laubhüttenfest (7,37f) und der Fußwaschung (13,3ff) durchzieht das Motivwort „Wasser“ das ganze Evangelium bis zur Durchbohrung der „Blut und Wasser“ verströmenden Seite Jesu (19,33f)18. Wenn man davon ausgeht, daß die Fußwaschung als das johanneische Äquivalent zum synoptischen Abendmahlsbericht zu verstehen ist, gilt von ihr Gleiches wie von dem Deutewort über das gebrochene Brot, mit dem Jesus seinem nahen Tod die authentische Deutung gibt. Dann aber hat das Wort von der Neugeburt aus dem Wasser und dem Geist nur vordergründig mit der Taufe zu tun, grundsätzlich aber mit dem (nach Röm 6,3ff) darin symbolisierten Ereignis von Tod und Auferstehung Jesu, so daß die Gotteskindschaft als deren vorzüglichste Frucht erscheint. Nur scheinbar verschwindet das Motiv dann im weiteren Gedankengang des Johannesevangeliums. Wenn Jesus den Jüngern in den Abschiedsreden erklärt:
Nicht mehr Knechte nenne ich euch; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Freunde habe ich euch genannt, weil ich euch alles gesagt habe, was mir von meinem Vater mitgeteilt worden ist (Joh 15,15),
charakterisiert er die ihnen zugesprochene Freundschaft vielmehr in derselben Weise, wie dies nach Paulus auf den der kreatürlichen Heteronomie und Angst entrückten Status der Gotteskindschaft zutrifft (Röm 8,15). Die vor allem in der mittelalterlichen Spiritualität hochgeschätzte Gottes- und Jesusfreundschaft erscheint dann geradezu als das Ziel einer Beziehung, die mit der Gotteskindschaft ihren Anfang nahm. Wiederholt sich dann aber nicht das Problem, das sich bereits vor dem Hintergrund der glaubenstheoretischen Schlüsselaussage des Epheserbriefs (Eph 4,13) abgezeichnet hatte? Ist die Freundschaft dann nicht das Endstadium, auf das die Kindschaft als Anfangs- und Ausgangsstadium hinführt?
Anders als im ersten Fall bedarf es hier nicht der Argumentationshilfe Nietzsches. Denn bei der Freundschaft ist ohnehin klar, daß sich in ihr lediglich das lebens- und bewußtseinsgeschichtlich entfaltet, was in der Kindschaft seinshaft vorgegeben und angelegt ist. In der Gottesfreundschaft wird man zu dem, was man als Gotteskind bereits besitzt und ist. In ihr schreitet man nicht über sich hinaus, sondern kehrt im Sinn einer Spiralbewegung auf höherer Stufe zu dem zurück, was man schon ist. Nicht umsonst imaginieren die spätmittelalterlichen Darstellungen der „Johannesminne“ eine Beziehung, die weit mehr der von Kind und Mutter als der von Freund zu Freund entspricht19.
Daß das Motiv der Kindschaft auch im gnostischen Umfeld des Christentums eine Rolle spielt, bestätigt das gnostische Thomasevangelium, wenn es in einem auch von Hippolyt überlieferten Logion berichtet:
Jesus sprach: der Greis wird in seinen Tagen nicht zögern, ein kleines Kind von sieben Tagen nach dem Ort des Lebens zu fragen, und er wird leben (7),
und wenn es Maria zu Jesus in Erwartung seiner Auskunft sagen läßt:
Wem sind deine Jünger gleich? Jesus sprach: Sie sind Kindern gleich, die sich auf einem Feld aufhalten, das ihnen nicht gehört. Wenn die Herren des Feldes kommen, werden sie sagen: Laßt uns das Feld! Sie sind nackt vor ihnen, daß sie es ihnen lassen und ihnen ihr Feld geben (21)20.
Unter den in der Folgezeit der Christenverfolgung hervortretenden Apologeten stellt Theophil von Antiochien die Frage, die für den Aufbau dieser mit der Besinnung auf die Gotteskindschaft einsetzenden Trilogie entscheidend war:
Wenn du aber sagst: „Zeige mir deinen Gott!“ so erwidere ich: „Zeige mir zuerst deinen Menschen, dann werde ich dir meinen Gott zeigen!“21
Diese Abfolge legt sich besonders nah, wenn man sich von dem Hermeneutiker Ernst Fuchs davon überzeugen läßt, daß „das Innerste Gottes das Menschliche ist“22. Wenn das zutrifft, steht das Menschsein grundsätzlich im Licht der göttlichen Selbstverständigung, so daß es von dorther, und das heißt, von seiner Bestimmung zur Gotteskindschaft her erschlossen werden muß. Nichts Schlimmeres, so Irenäus von Lyon, kann dem Menschen daher widerfahren, als wenn er sich dem Geschenk der Kindschaft verweigert und so sich selbst um seine „Erhebung zu Gott betrügt“. Wie in einem Vorgriff auf Wredes Sinndeutung der Lebensleistung Jesu begründet er das mit der Feststellung:
Dazu ist nämlich das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort Gottes in sich aufnehme und, an Kindesstatt angenommen, zum Sohn Gottes werde23.
Dabei nimmt er auch schon das Motiv der Einwohnung in den Blick, wenn er fortfährt:
So machte das Wort Gottes, das im Menschen wohnte, den Menschen fähig, den Vater zu begreifen, und wurde zum Menschensohn, damit der Mensch sich dazu bereit finde, Gott aufzunehmen, und Gott sich dazu herablasse, im Menschen zu wohnen24.
Das unterbaute Irenäus durch seine weitgreifende Rekapitulationstheorie25. Danach erreichte der Erlöser das Ziel seines Rettungswirkens dadurch, daß er alle Seinsbereiche und insbesondere alle menschlichen Lebensalter einholte, indem er für die Kinder zum Kind, für die Jugendlichen zum Jüngling, für die Erwachsenen zum Gereiften und so zum vollkommenen Meister (perfectus magister) für alle wurde. Zu diesem Ziel starb er auch, um durch seinen Tod zum Erstgeborenen von den Toten (primogenitus ex mortuis) zu werden26. So glich er sich in seiner Erniedrigung den Menschen an, damit der ihm dadurch gleichgewordene Mensch in den Augen Gottes kostbar (pretiosus) dastehe27.
So sehr die Gotteskindschaft dem Erlösten nach Origenes, dem größten Denker der antiken Christenheit, nur auf abkünftige Weise zukommt, empfangen für ihn doch alle, die den Sohn im Glauben annehmen, auch den Geist der Sohnschaft und die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Durch die Einwohnung des Logos dem „Bild des Bildes“ gleichgestaltet, ahmen sie seine Sohnschaft nach. So erlangen sie die den (nach Mt 6,9) Friedensstiftern verheißene Gotteskindschaft, die sich in Tugend, Glaube und Erkenntnis bewährt.
Auch für Athanasius, den Vorkämpfer gegen den Arianismus, besteht die erste und wichtigste Großtat Christi an den Menschen darin, daß er durch seinen Geist in ihnen wohnt und sie dadurch zu Kindern Gottes und Teilhabern des göttlichen Lebens macht. Wer den Geist empfängt, wird zum Sohn Gottes, wenn auch nicht wie der Logos unmittelbar, sondern durch die Vermittlung seines Geistes28.
Nach Cyrill von Jerusalem gestaltet sich die Gotteskindschaft zu einem Dialog zwischen Gott und dem von ihm der Sklaverei entrissenen Menschen. Während Gott zu ihm in der Taufe sagt: „Dieser ist jetzt mein Sohn geworden“ (Catech. 3.14), bejahen das die Erlösten mit dem Bekenntnis: „Aus Glauben wurden wir gewürdigt, aus freien Stücken Gottes Kinder zu werden“. Daraus ergibt sich für Cyrill die Verpflichtung: „In dieser Erkenntnis laßt uns geistlich wandeln, damit wir uns der Sohnschaft würdig erweisen“ (7,14).
Ihren ersten und kaum je wieder überbotenen Höhepunkt erreicht die Motivgeschichte sodann in Gregor von Nyssa, dem Mystiker unter den Kappadokiern, der die Gotteskindschaft ebenso auf ihren Ursprung zurückführt wie er sie auf ihre Praxis anwendet. Das betont er in seiner Auslegung des Hohelieds, wenn er erklärt:
Das uns eingeborene Kind ist Jesus, der in denen, die ihn aufnehmen, auf unterschiedliche Weise an Weisheit, Alter und Gnade heranwächst. Doch ist er nicht in einem jeden der Gleiche. Vielmehr erscheint er je nach dem Gnadenmaß dessen, der ihn aufnimmt und nach seiner Aufnahmefähigkeit einmal als Kind, dann als Heranwachsender und schließlich als Vollendeter29.
Stärker noch als bei Irenäus ist hier das Motiv mit dem der Einwohnung verknüpft und zugleich stadienhaft entfaltet. Vor allem aber ist der johanneische Gedanke von der Neugeburt (Joh 3,3) zu dem der Gottesgeburt fortgebildet und dadurch erst in seiner evolutiven Entfaltung vom Kind zum Heranreifenden und Vollendeten glaubhaft gemacht. Damit stellt sich dann aber auch spontan die Frage nach der Praxis, die der Nyssener in seiner Betrachtung über die Seligpreisungen auf geradezu ekstatische Weise bei seiner Würdigung der „mit der Gnadenkrone der Gotteskindschaft gekrönten“ Friedensstifter beantwortet. „Was gäbe es, um Gott für diesen Hulderweis zu danken“, fragt er, „da aus einem Sterblichen ein Unsterblicher, aus einem Vergänglichen ein Unvergänglicher, aus einem Menschen ein Gott wird?“ Dabei genügt es, den Menschen an die ihm als Gotteskind zukommende Würde zu erinnern, weil sich die damit verbundene Aufgabe dann von selbst ergibt30. Denn damit versetzt Gott den Empfänger dieser Gaben in den Quellgrund und Ursprung des Friedens, der ihn drängt, das, was er ist, an die Welt weiterzugeben und die Friedlosen zu „liebevoller Übereinstimmung“ zu bewegen. Wie die Finsternis vor dem Licht schwindet, müssen in seinem Umkreis dann auch die dem Frieden entgegenstehenden Widerstände weichen31.
Die stadienhafte Entfaltung des Motivs durch den Nyssener erinnert an die Rekapitulationslehre des Irenäus, nach der Jesus jedes Lebensalter durchschritt, um für die Kinder ein Kind, für die Jugendlichen ein Jüngling und für die Erwachsenen ein Vollendeter zu sein und um sich im Durchschreiten dieser Altersstufen als Lehrmeister und Vorbild aller zu erweisen.32 Gleiches gilt für Athanasius, der diese Sicht mit der Begründung unterbaute, daß Christus dadurch auf die Menschen einwirkte, daß er ihnen durch seinen Geist einwohnt, um sie, zu Gotteskindern geworden, am göttlichen Leben teilnehmen zu lassen.33
An diese perspektivenreiche Schau der Gotteskindschaft knüpft auch der ins mörderische Getriebe der christologischen Kämpfe geratene Maximus Confessor an, wenn er im Anschluß an das Wachstumsmodell Gregors Jesus alle Himmel durchschreiten und übersteigen und so „jenen Gipfel, den kein Wort und kein Verstand jemals aussprechen und begreifen kann“, erreichen sieht. Dabei durchmißt er die vom Nyssener beschriebenen Stadien der Gotteskindschaft, doch so, daß er sie zugleich als deren Ursprung und Inbegriff erweist:
Vom Nahen zum Fernen ausgreifend und vom Geringeren zum Höheren aufsteigend vereinigte er in sich alle Extreme, um sie in die gemeinsame Einigung in Gott ausmünden zu lassen. Als letzter ist der Mensch in die Schöpfung eingetreten, um als Bindeglied zwischen den Extremen zu vermitteln und sich schließlich mit dem ungeschaffenen Sein zu vereinigen und Gott ganz in sein Wesen aufzunehmen, ja ihn an die Stelle seines eigenen Selbst zu setzen, so daß er als Siegespreis für seinen Aufstieg zu Gott nichts anderes als Gott selbst erhält, ihn als den unerschütterlichen Standort alles sich zu ihm Bewegenden und als das Ende und die Grenze alles durch ihn Begrenzten (Or. 39, c.13).34
In der lateinischen Patristik bezieht sich Cyprian von Karthago mit Nachdruck auf das von der Christenheit mißachtete Herrenwort, daß der zum Gotteskind Gewordene niemand außer seinem väterlichen Gott „auf Erden Vater nennen“ dürfe (Mt 23,9)35. Auch für Hilarius von Poitiers bekundet sich die Wiedergeburt zum Gotteskind primär in der Anrufung „Abba – Vater“: Deswegen sind seine Taten letztlich gottgewirkt und als solche „opera secundum spiritum dei gesta“ (De trinitate 6,44). Ebenso greift Augustin in seiner für das Theorem des „inwendigen Lehrers“ grundlegenden Frühschrift „De magistro“ auf diese Aussage des von ihm vielfach gerühmten, bisweilen aber auch berichtigten Märtyrers Cyprian zurück, während er sich in seinem Johanneskommentar als Traditionszeuge der Gotteskindschaft profiliert36. So schon bei seiner Erklärung des Prologs, die in dem Satz gipfelt:
Wundere dich also nicht, o Mensch, daß du durch die Gnade zum Gotteskind wirst, daß du aus Gott geboren wirst nach seinem Worte. Zuerst wollte das Wort selbst von Menschen geboren werden, damit du gewiß aus Gott geboren würdest und zu dir sagen könntest: Nicht grundlos wollte Gott von Menschen geboren werden, und zwar aus keinem anderen Grund, weil er mich für wert hielt, für mich sterblich geboren zu werden, um mich unsterblich zu machen37.
Sodann, und jetzt aus thematischem Anlaß bei seiner Deutung des Nikodemusgesprächs, bei der er zu bedenken gibt:
Wohlan, Bruder, also wollte Gott Sohn des Menschen sein, und die Menschen sollten nach seinem Willen Söhne Gottes sein. Er stieg unsretwegen herab; wir sollten seinetwegen hinaufsteigen.
Auch die an Jesus Glaubenden sind in seinen Aufstieg hineingenommen, weil sie „in und mit ihm“ eins sind38. Darauf stimmt sich der aus der nach ihm benannten erzbischöflichen Kapelle in Ravenna bekannte Petrus Chrysologus mit dem Bekenntnis ein: „Kaum hast du dich zu Gott, dem wahren Vater des Sohnes bekannt, so bist du selbst als Sohn Gottes des Vaters angenommen“ (Sermo 68). All das klingt schließlich bei Johannes von Damaskus, dem letzten östlichen Kirchenvater nach. Gestützt auf Gedanken des Pseudo-Dionysius, des Gregor von Nazianz und des Maximus Confessor, betont er ebenso die in der Gotteskindschaft erlangte Überwindung der Heteronomie wie den durch sie stimulierten Fortschritt, wobei er nicht nur Jesus an Alter, Weisheit und Gnade fortschreiten sieht, sondern ihn zugleich als Prinzip des menschlichen Heranreifens begreift39. Das krönt er mit einer Danksagung an den, dem diese nach seiner Überzeugung auch im Gebet vollzogene Erhebung zu verdanken ist:
Wohlan, Christus, Wort Gottes, Weisheit, Macht und allherrschender Gott. Wie sollen wir Arme dir dies vergelten? Denn dein ist alles, und du verlangst von uns nichts, als daß wir uns retten lassen, und auch dies gibst du selbst und weißt in deiner unsäglichen Güte den Empfängern sogar Dank. Dank sei dir, der du das Sein gegeben und das Wohlsein geschenkt hast und die, die dies verloren, in deiner unaussprechlichen Herablassung wieder hierzu zurückgeführt hast40.
Über die Jahrhunderte hinweg bestätigt dies Meister Eckhart, wenn er im Gottessohn auch uns zu „Gottes Söhnen“ geworden sieht und dies mit den Worten begründet:
Er allein ist im eigentlichen Sinn das Bild des Vaters, wir aber sind die Söhne nach seinem Bild … Er ist der Sohn von Geburt und deshalb von Natur, wir sind es durch Adoption und Wiedergeburt, die sich auf die Ähnlichkeit mit der Natur bezieht. Er ist der Erbe, wir sind die Miterben, sofern wir Söhne und Glieder in ihm sind … Davon spricht Augustinus oft, wenn er das Wort behandelt: „Für sie heilige ich mich“ und dazu als Grund hinzufügt: „weil sie Ich sind“: alle Menschen ein Mensch, und dieser Mensch ist Christus41.
Einen neuen und bisher letzten Höhepunkt erreichte die Motivgeschichte in Nikolaus von Kues, der dem Thema erstmals eine eigene Schrift „De filiatione Dei“ widmete42. Seinen Grundgedanken faßte der Kusaner in die Worte:
Meiner Ansicht nach werden wir nicht in dem Sinn Kinder Gottes, daß wir etwas anderes würden als das, was wir jetzt sind; wohl aber werden wir dann in einem anderen Maß und Verhältnis das sein, was wir jetzt in der unserem heutigen Zustand angemessenen Seinsweise sind43.
Das wirkt wie ein Nachklang der Umschreibung der Gotteskindschaft durch Augustin:
Wir werden nicht in dem Sinne Gottes teilhaftig, daß wir das vollständig würden, was er ist, sondern so, daß wir ihn auf die innigste, wunderbare und intelligible Weise berühren und von seiner Wohltat und Liebe zutiefst erleuchtet und ergriffen werden44.
Daraus leitet der Kusaner schließlich seine definitionsartige Bestimmung der Gotteskindschaft ab:
Die Kindheit ist somit die Aufhebung aller Andersheit und Verschiedenheit und das Aufgehen von allem in eins, was zugleich den Aufgang des Einen in alles besagt45.
Unüberhörbar klingt in dieser Definition das Pauluswort von der vom „Geist der Kindschaft“ bewirkten Aufhebung der Heteronomie und Angstanfälligkeit nach (Röm 8,15), das damit seine wirkungsgeschichtliche Effizienz beweist. Denn der Kusaner steht an der Schwelle jener Epoche, die in Descartes mit der philosophischen und kirchlichen Tradition brach, um die Sache des Denkens konsequent auf dieses selbst zu begründen, und die in Kants Definition der Aufklärung ihre Identität im „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ erblickte. Als Inbegriff des emanzipierten Geistes, der, paulinisch ausgedrückt (1Kor 2,15), für sich in Anspruch nimmt, alles zu beurteilen, während er sich von niemand beurteilen läßt, ist die Aufklärung allerdings ohne den von Joachim von Fiore her nachwirkenden Impuls nicht zu erklären. Denn Joachim hatte in seiner Drei-Stadien-Lehre bereits ein Zeitalter des Gesetzes, dann des Glaubens und schließlich der Freiheit unterschieden und für dieses das in der Apokalypse angesagte „ewige Evangelium“ (Apk 14,6) postuliert. In seiner „Erziehung des Menschengeschlechts“ (§ 87) bezieht sich Lessing darauf, und noch in Heines „Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland“ findet sich eine gleichsinnige Anspielung, wenn er prophezeit:
Ja, kommen wird auch der dritte Mann, der das vollbringt, was Luther begonnen, was Lessing fortgesetzt. Der dritte Befreier – Ich sehe schon seine goldne Rüstung, die aus dem purpurnen Kaisermantel hervorstrahlt, wie die Sonne aus dem Morgenrot 46.
Als diesen dritten Mann hätte sich Hegel fühlen können, sofern er den Sinn der Geschichte als Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit erblickte und das mit dem Christentum angebrochene „Greisenalter des Geistes“ als Höhepunkt dieses „Stufengangs“ bezeichnete und sofern er zugleich als Denker dieses Endstadiums die Aufhebung der Theologie in Philosophie betrieb47. Nach einer flüchtigen Annäherung bei Kant, der mit seiner Forderung einer „Revolution der Gesinnung“ und Denkungsart den Begriff der Wiedergeburt einzuholen sucht und mit der Bezeichnung Gottes als „Herzenskündiger“ dem Motiv des inwendigen Lehrers nahekommt, verschwindet der Gedanke der Gotteskindschaft im Zug dieser Aufhebung dann jedoch bis auf wenige philosophische und theologische Ausnahmen aus dem spekulativen Disput48. Zu jenem gehört in erster Linie Johann Gottlieb Fichte, der in seiner „Bestimmung des Menschen“ (1800) die Aristie des Menschseins mit einem All-Einheitserlebnis gleichsetzt, in dem sich das Ich mit allem verwandt, von allem erblickt und „wie die Morgensonne in tausend Tautropfen“ gespiegelt fühlt. Das konkretisiert er in seiner „Anweisung zum seligen Leben“ (1806) im Sinn seiner spekulativen Christologie. Darin sieht er seine Gegenwart vom Christentum als „mächtigem Prinzip“ durchwirkt, und dies mit der Folge, daß alle, „die seit Jesus zu Gott gekommen, nur durch ihn und vermittelst seiner dazugekommen“ sind. Dabei ist „Jesus von Nazareth auf eine ganz vorzügliche, durchaus keinem Individuum außer ihm zukommende Weise“ seinerseits dazu gekommen, der „eingeborene und erstgeborene Sohn Gottes“ zu sein, dessen Großtat darin bestand, alle anderen „in ihm, und durch die Verwandlung in sein Wesen, mittelbar, Kinder Gottes werden“ zu lassen49.
An theologischen Ausnahmen ragen, repräsentativ für andere, vor allem Albert Schweitzer und Matthias Joseph Scheeben hervor50. Schweitzer, für den Paulus mit der sich von der ozeanischen Gottesmystik unterscheidenden Lehre von der Gotteskindschaft „wie ein Leuchtturm“ die einzig richtige Wegweisung gibt, und der sich damit dann doch im Sog der alles überflutenden Rechtfertigungsdiskussion nicht behaupten konnte. Und Scheeben, der die innere Antithetik der Gotteskindschaft mit den einfühlsamen Worten herausstellt:
Schon sind wir aus Gott gezeugt; dennoch erwarten wir noch die vollendende Wiedergeburt. Schon lebt Christus, der Sohn Gottes in uns; dennoch ist er als „unser Leben“ noch nicht erschienen. Schon tragen wir das Bild des Sohnes in uns; doch ist es noch nicht zur vollen Mannesreife ausgebildet. Schon erfreuen wir uns der Freiheit der Gotteskinder und doch seufzen wir noch nach ihrer Vollendung.
Dennoch blieb ihm trotz dieser eindrucksvollen Profilierung des Motivs eine nachhaltige Wirkung versagt. Dasselbe Schicksal erlitt dann aber auch das in beständigem Gespräch mit ihm gestaltete Werk von Hermann Kuhaupt, der seine Energie im Versuch, bei der Bestimmung der „Formalursache der Gotteskindschaft“ den Anteil der ungeschaffenen Gnade von dem der geschaffenen abzuheben, verzehrte51.
Bei allem Engagement scheitern Scheeben und Kuhaupt auf ungemein aufschlußreiche Weise bei ihrem Versuch, das sie persönlich zutiefst bewegende Motiv unter den Bedingungen der zu einer ideologischen Verhärtung tendierenden neuscholastischen Denkweise zur Geltung zu bringen. Ihnen standen geistige Barrieren im Weg, wie sie Paulus (nach 2Kor 10,4f) niederzuringen sucht. Denn die Gotteskindschaft ist, auf den Problemkern zurückgeführt, ein Zentralmotiv der Wahrheit Christi und damit der aus dem hermeneutischen Umgang mit Jesus gewonnenen Wahrheit, nicht jedoch ein Derivat der christlichen Wahrheit, die aus der Auslegung des Evangeliums mit Hilfe platonisch-aristotelischer Kategorien hervorging. Hier gilt die Antithese, die Franz Rosenzweig aus vergleichbarem Anlaß in seinem „Stern der Erlösung“ in die Worte faßte:
Wahrheit thront über der Wirklichkeit. Und so wäre denn die Wahrheit – Gott? Nein. Die Wahrheit ist nicht Gott. Gott ist die Wahrheit.52
Die sich daraus aufbauenden Denkbarrieren brachten es mit sich, daß die unaussagbar gewordene Gotteskindschaft aus dem Interessen- und Themenfeld der Theologie, der von ihr geprägten Verkündigung und, schlimmer noch, der von ihr reglementierten Spiritualität verschwand, sofern sie nicht auf die schiefe Ebene eines regressiven Infantilismus geriet, wie ihn Lutterbach im Sog dieser Entwicklung ebenso eingehend wie kenntnisreich untersuchte.